|
|
|
Rezension
Die im medienpädagogisch ausgewiesenen GEP-Verlag („medien praktisch“) erschienene (ge)wichtige Dissertation des langjährigen Mitarbeiters des Landesfilmdienstes Hessen ist auch praktisch-theologisch von erheblicher Bedeutung: Mythen und Symbole werden nicht nur in Form der Symboldidaktik seit Ende der 70er Jahre wieder entdeckt, die Praktische Theologie versteht sich zunehmend als „Kunst der Wahrnehmung“ (Albrecht Grözinger) und gibt der Ästhetik den ihr gebührenden Raum zurück, die Religionspädagogik klärt sich zunehmend massenmedial und medienpädagogisch auf und die Semiotik hält Einzug in die Theologie. So geht es dieser Rezension weniger um die der Studie eigene Binnendifferenzierung der Theoriebildung innerhalb der Medienpädagogik, wobei Röll zugunsten eines wahrnehmungsorientierten Ansatzes und einer präsentativen (statt diskursiven) Symbolik votiert (Ernst Cassirer / Susanne K. Langer), als vielmehr um Relevanz und Konsequenzen für die Theologie, wie sie in Folgendem deutlich werden:
Kap. 1: Forschungsleitende Annahmen (13-23) zeigt die Bedeutung einer ästhetischen, symbolorientierten Aneignungsweise von Lebenswelt als Medienkompetenz auf; der sinnlich-ästhetische Lernprozeß aktiviert über das Bild und aktive Imagination Erkenntnisprozesse. So entsteht Wahrnehmungsbildung. Kap. 2 zeigt die Relevanz des Bildlichen (25-65) inmitten der Mediatisierung von Gesellschaft und Lebensalltag, den Paradigmenwechsel vom Wort zum Bild und die damit verbundene Herausforderung ästhetischer, wahrnehmungskompetenter Erziehung auf. Kap. 3 beschreibt kurz Stadien der Bildbedeutung (67-79): Funktionen von und Zugangsweisen zu Bildern. Der Bilder- und „Immanentismusstreit ist heute genauso aktuell wie vor 1200 Jahren“ (74). Moderne Ikonodulen und Ikonoklasten (z.B. Neil Postman) streiten um die Einheit von Bild und Wesen, um Bilderverbot und Bildimmanentismus, der davon ausgeht, daß zwischen medialen Abbildern und den sie darstellenden Objekten eine unmittelbare Beziehung besteht. Heute aber geht es nach Röll nicht mehr um die Verwechslung von Bild und Abbild, sondern um die zusätzliche Aufladung der Bildbedeutung mit symbolischen Subtexten, also polyseme, nicht monomythische Bilder. Kap. 4 skizziert unter der Überschrift Funktion und Bedeutung des symbolischen Denkens (81-145) verschiedene Symboltheorien: kulturanthropologische (E. Cassirer, S. K. Langer), religions- und mythenwissenschaftliche (M. Eliade, J. Campbell), psychologische (C. G. Jung), strukturalistische (C. Lévi-Strauss, R. Barthes), psychoanalytische (A. Lorenzer) und hermeneutische (Th. Ziehe). Kap. 5 Symbolik in medialen Alltagskulturen (147-294) findet als materialreicher Hauptteil des Buchs auf ca. 150 S. vielfältige Mythen und Symbole in Film (5.1: Terminator 2, Indiana Jones), Videoclip (5.2.: M. Jackson, Madonna u.a.), Werbung (5.3), Videokunst (5.4), Computeranimation (5.5) und Musik (5.6). Kap. 6 Zur Instrumentierung einer symbolorientierten Medienpädagogik (295-405) beschreibt den praxisnahen, medienpädagogischen Ansatz des Verfassers im Sinne präsentativer Symbolik und wahrnehmungsorientierter Kompetenzerweiterung durch Lebenswelterkundung und praktisches Produzieren von Medien. Hier spielt der Verfasser (etwas einseitig) symbolhaft-assoziativ-synthetische gegen diskursiv-reflexiv-analytische Erkenntnisprozesse aus. Kap. 7 Medien und Identität (407-425) zieht Schlußfolgerungen, stellt abschließend die Bedeutung der Medien für die Identitätsbildung heraus und fordert nochmals entsprechende Wahrnehmungskompetenz: „Medien sind ausgezeichnete Prothesen bei der Suche nach dem Standpunkt zur Welt“ (415). „In unserer Gesellschaft ... übernehmen die Medien die Aufgabe, die Jugendlichen in die Gesellschaft zu integrieren“ (416). Dabei ist Identität Folge sozialer Praxis und interkommunikativer Prozesse, - nicht autonomer Entwurf eines Subjekts (G. H. Mead). Wenn die Medienkultur die Wortkultur überformt, Kommunikation überwiegend medial geschieht, dann gibt es kein Entrinnen vor dem Mythos, sondern nur Arbeit am und mit dem Mythos. Hier erzieht inmitten der entgrenzten Medien, des multiplen Ichs und der postmodernen Vielfalt der aktive Umgang mit Medien zum mehrdimensionalen Blick und der christliche Monomythos erodiert zugunsten polymythischer Produkte. „Unter diesen Gesichtspunkten könnte Wahrnehmungsschulung, gesteigertes Zeichenbewußtsein und polysynthetische Einbildungskraft zu einem unverzichtbaren Instrument jeglicher pädagogischer und politischer Bildung werden ... Diejenigen, die sich mit den damit in Beziehung stehenden kommunikativen Veränderungen nicht auseinandersetzen, könnten recht schnell zu den Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden.“ (418f). – In religionspädagogischer Perspektive, aus der Rezensent urteilt, hat die Theologie noch deutliche Defizite hinsichtlich Wahrnehmungskompetenz (vor allem der kommunikativen Veränderungen), Ästhetik, Lebensweltorientierung, Paradigmenwechsel von Wort zu Bild, Medienpädagogik und virtuelle Welten. Im Sinne einer semiotisch kritisierten (Michael Meyer-Blanck), sich um kreative Wahrnehmung bemühenden und sich massenmedial öffnenden Symboldidaktik (vgl. Peter Biehl, Festsymbole. Zum Beispiel: Ostern. Kreative Wahrnehmung als Ort der Symboldidaktik, Neukirchen-Vluyn 1999) könnte hier die Wahrnehmung des „wahrnehmungsorientierten Ansatzes in der Medienpädagogik“ Abhilfe schaffen. Gerd Buschmann für lehrerbibliothek.de, aus: International Journal of Practical Theology 4/2000, Issue 1, 155-157 Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Forschungsleitende Annahmen und Darstellungsziele
2. Kapitel: Zur Relevanz des Bildlichen 2.1 Aktuelle Mediatisierungstendenzen 2.1.1 Mediennutzung 2.1.2 Bildkommunikation als Handlungsstrategie 2.2 Wandlungen in der Aneignung von Wirklichkeit 2.2.1 Segmentierung und Inselerfahrung 2.2.2 Kulturelle Modernisierung von Jugend 2.2.3 Leben als Film Film als Leben 2.2.4 Welt als Kopie und Simulation 2.3 Zur Bedeutung der Wahrnehmung 2.3.1 Welt und ihr Abbild in der Wahrnehmung 2.3.2 Wahrnehmung und Erkenntnis 2.3.3 Wahrnehmung und Kognition 2.3.4 Wahrnehmungsdispositionen 2.4 Ästhetische Erziehung als Herausforderung 3. Kapitel: Stadien der Bildbedeutung 3.1 Bild und Wesen 3.2 Bildimmanentismus 3.3 Bild als Differenz 3.4 Reanimismus des Bildes 4. Kapitel: Funktion und Bedeutung des symbolischen Denkens 4.1 Der Mensch als "animal symbolicum" 4.2 Symbol und Kollektivität 4.2.1 Die Macht der Mitte 4.2.2 Mythologie als Steuerungssystem 4.2.3 Das kollektiv Unbewußte die Archetypenlehre 4.2.4 Der Beitrag des Strukturalismus 4.2.4.1 Strukturale Anthropologie 4.2.4.2 Mythen des Alltags 4.3 Mythos und Aufklärung 4.4 Das Konzept einer präsentativen Symbolik 4.5 Symbolbildung und Subjektkonstitution 4.5.1 Sinnlich-unmittelbare Symbole 4.5.2 Bildsymbole und intrapsychisches Erleben 4.6 Das Symbol im Spannungsfeld zwischen Regression und Progression 4.7 Symbole, Hilfsmittel für Perspektivenwandel 5. Kapitel: Symbolik in medialen Alltagskulturen 5.1 Das Geheimnis des erfolgreichen Films 5.1.1 Terminator 2 Tag der Abrechnung (Cameron) 5.1.2 Indiana Jones Jäger des verlorenen Schatzes (Spielberg) 5.2 Videoclip synästhetische Klangbilder 5.2.1 Zur Stellvertreterfunktion von Popidolen 5.2.1.1 Der androgyne Gott (Michael Jackson) 5.2.1.2 Die erwachende Göttin (Madonna) 5.2.2 Animus/Anima-Thematik im Videoclip 5.2.2.1 Suche nach weiblicher Identität (Kate Bush) 5.2.2.2 Hegel meets Buddha (Guesch Patti) 5.2.2.3 Suche nach männlicher Identität (Depeche Mode) 5.3 Werbung die Macht der schönen Bilder 5.3.1 Die neuen Bilder der Werbung 5.3.2 Mythische und symbolische Subtexte in der Werbung 5.3.2.1 Religiöse Subtexte in der Werbung 5.3.2.2 Strukturell-anthropologische Subtexte 5.3.2.3 Geschlechtsrollensuche in der Werbung 5.4 Videokunst Video heißt nicht, ich sehe, Video heißt, ich fliege 5.4.1 Buddha Die Erfahrung des Closed-Circuit 5.4.2 Labyrinthian Space Orbit Fernseher 5.4.3 Tränen aus Stahl elektronische Körperfaszination 5.5 Computeranimation Die digitale Schöpfung 5.5.1 Anthropomorphismus Luxo Junior 5.5.2 Parthenogenese Particle Dream 5.5.3 Das multiple Ich Green Movie 5.6 Subtext und Symbolik in der Musik 5.6.1 Musik in Spielfilmen die akustische Brille 5.6.2 Klassische Musik in der Werbung das Konzert der Verführer 5.6.3 Symbolik in der Rockmusik Sympathy for the Devil 5.7 Medienkonsum und symbolische Identität 6. Kapitel: Zur Instrumentierung einer symbolorientierten Medienpädagogik 6.1 Bausteine einer präsentativen Kompetenzerweiterung 6.1.1 Medienpädagogik als Lebensgestaltungsfunktion 6.1.2 Lebensweltbezug und ästhetischer Lernprozeß 6.1.3 "Alphabetisierung" (audio)visueller Kompetenzen 6.1.3.1 Emotionale Strategien der Filmgestaltung 6.1.3.2 Hinweise zur normativen Kraft der Ästhetik 6.2 Seminarkonzept symbolorientierter Medienpädagogik 6.2.1 Visuelle Animation 6.2.2 Raumwahrnehmungen 6.2.2.1 Topographischer Raum als symbolischer Raum 6.2.2.2 Inszenierung des Zufalls 6.2.2.3 Der symbolische Raum der Bilder 6.2.3 Clustering und Mind-mapping 6.2.4 Montage die Dialektik der Bilder 6.2.4.1 Montage als Sinnproduktion 6.2.4.2 Horizontale Montage Verdichtung von Raum u. Zeit 6.2.4.3 Vertikale Montage Klangbilder und Bildklänge 6.2.5 The Final Cut Öffentlichkeit 6.3 Wahrnehmungsorientierte Medienprojekte 6.3.1 Filme als Anstiftung zur Kommunikation 6.3.1.1 Kinderkino in der Provinz 6.3.1.2 Erlebnisraum Kinderkino 6.3.1.3 Sinnlich-ästhetische Aneignung imaginärer Bildwelten 6.3.2 Fotografie als sozialästhetische Annäherung 6.3.2.1 Fotografie als Ontologie 6.3.2.2 Fotografische Grenzerfahrungen 6.3.2.3 Fotografische Inszenierungen 6.3.3 Audiovision Bilder lernen laufen 6.3.3.1 Bildhauerei in Licht und Zeit 6.3.3.2 Kompositionsregeln und Subtexte in der Dia-AV 6.3.3.3 Triade 6.3.3.4 Musikeinsatz in Triade 6.3.4 Video Ich sehe, also bin ich 6.3.4.1 Kompilation und Kreativität 6.3.4.2 Every Week 6.3.4.3 Da werden die Augen Ohren machen 6.3.5 True-Multimedia 6.3.5.1 Sein oder Design 6.3.5.2 Multimediale Inszenierungen Gewalt auf der Spur 6.4 Ästhetische Erfahrung als progressiver Lernprozeß 7. Kapitel: Medien und Identität 7.1 Identität im Medienzeitalter 7.2 Initiation und Identität 7.3 Das Subjekt im Zeitalter der entgrenzten Medien Literaturverzeichnis |
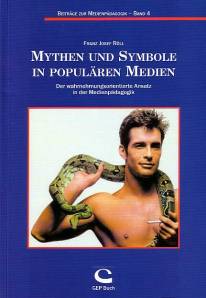
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen