|
|
|
Umschlagtext
Dürfen wir vorstellen: Die Psychologie - ein Fach mit spannenden Fachgebieten und
kontroversen Diskussionen, eine fundierte Wissenschaft, eine Möglichkeit, sich mit eigenen Erfahrungen und fremden Kulturen auseinanderzusetzen. Das einführende Lehrbuch von David Myers stellt das Fach so komplett wie kein anderes vor: alle Grundlagenfächer und die 3 großen Anwendungsfächer Klinische, Pädagogische und Arbeitsund Organisationspsychologie. Leicht lernen: Mit leicht verständlichen, unterhaltsamen Kapiteln, klar formulierten Lernzielen, Merksätzen, deutsch-englischem Glossar und Zusammenfassungen. Mit interaktiver Lernwebsite und umfangreichem Zusatzmaterial. Mit Spaß - über 900 Abbildungen und Cartoons bringen Psychologie auf den (witzigen) Punkt! Psychologisch denken: Durch zahlreiche Denkanstöße und Übungen zeigt Myers, wie das Wissen angewendet wird, wo Psychologie im Alltag zu erfahren ist. Ob Sie Psychologie studieren oder zu denen gehören, die schon immer wissen wollten: Was machen die Psychologen da eigentlich? – Der MYERS ist Ihr Einstiegsbuch in die Psychologie! Website zum Buch mit umfangreichen Lernmaterialien, weiterführenden Links u.v.m. Rezension
"Myers Psychologie" ist die deutsche Version eines umfassenden amerikanischen Lexikons der Psychologie. Die Grundlagen aller großen Bereiche der Psychologie (wie Neurowissenschaft, Entwicklungs-, Wahrnehmungs-, Persönlichkeits-, Sozial-, Organisations- und Pädagogische Psychologie) werden darin kompetent vermittelt, beginnend mit einem kurzen historischen Abriss und einer Skizze dessen, was wissenschaftliche Fragestellung in der Psychologie bedeutet. Kompetente Vermittlung bedeutet dabei vor allem, dass das Lehrbuch gleich zu Beginn seine Leser (und Lerner!) an die Hand nimmt und ihnen erklärt, wie das Lehrbuch aufgebaut ist und wie sie damit am besten lernen und erfolgreich Prüfungen meistern können. Dies ist ganz im Sinne der Pädagogischen Psychologie und für die Schule ebenso relevant: Leitfragen zu Beginn jedes Kapitels geben einen roten Faden vor, Bilder, Beispiele und Zitate veranschaulichen den Lernstoff, wichtige Ergebnisse werden kompakt zusammengefasst. Trocken ist dieses Lehrbuch daher wirklich nicht, wird man doch schon zu Beginn eines Kapitels mit einem Beispiel ins Thema eingeführt und am Ende mit einer Impulsfrage zum Weiterdenken aus ihm entlassen. Ergänzt wird das Lehrbuch online durch Antworten auf Prüfungsfragen sowie weitere Angebote (www.lehrbuch-psychologie.de). Damit stellt "Myers Psychologie" eine kompakte wie kompetente Einführung in die Psychologie dar.
M.Förg, Lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Über dieses Lehrbuch * Der ideale Einstieg in die Psychologie für Studierende und andere Neugierige * Mit den 3 großen Anwendungsfächern Klinische Psychologie, Pädagogische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie * Neues Kapitel: Psychologie als Beruf * Interaktive Lernwebsite mit umfangreichem Zusatzmaterial Dürfen wir Ihnen vorstellen: Die Psychologie ... ... ein Fach mit spannenden Fachgebieten und kontroversen Diskussionen, eine fundierte Wissenschaft mit aktuellen Erkenntnissen und interessanten Persönlichkeiten, eine Möglichkeit, sich mit eigenen Erfahrungen und fremden Kulturen auseinanderzusetzen. So lernen Sie alles - Alle Grundlagenfächer - Aktuelle neurowissenschaftliche und verhaltensgenetische Ansätze - Die 3 großen Anwendungsfächer: Klinische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und Pädagogische Psychologie So lernen Sie leicht - Anschaulicher, leicht verständlicher und unterhaltsamer Text - Merksätze, deutsch-englisches Glossar, Zusammenfassungen - Interaktive Website mit zusätzlichen Lernmaterialien (MC-Quiz, Verständnisfragen, kommentierte Links u.v.m.) So denken Sie psychologisch Denkanstösse, Kontroversen, Übungen: Wenden Sie Ihr Wissen an! Wo ist Ihnen ein Phänomen in Ihrem Alltag schon begegnet? Was würden Sie als Psychologin oder Psychologe in Forschung und Praxis tun? So macht Psychologie Spaß - Comics, kluge Sprüche und Zitate: Psychologie auf den (witzigen) Punkt gebracht - Über 900 Abbildungen und Cartoons! Ob Sie Psychologie studieren oder zu denen gehören, die schon immer wissen wollten: Was machen die Psychologen da eigentlich? – Der MYERS ist Ihr Einstiegsbuch in die Psychologie! Geschrieben für: Studierende der Psychologie und anderer Fächer (z.B. Nebenfachstudenten Sozialwissenschaften, Pädagogik, BWL) Schlagworte: * Arbeitspsychologie * Biologische Psychologie * Einführung * Entwicklungspsychologie * Klinische Psychologie * Organisationspsychologie * Persönlichkeitspsychologie * Pädagogische Psychologie * Sozialpsychologie Inhaltsverzeichnis
Kapitelübersicht
Prolog: Eine kurze Geschichte der Psychologie – 1 1 Kritisch denken mit wissenschaftlicher Psychologie – 17 2 Neurowissenschaft und Verhalten – 55 3 Anlage, Umwelt und die Vielfalt der Menschen – 101 4 Entwicklung – 149 5 Wahrnehmung: Sinnesorgane – 213 6 Wahrnehmung: Organisation und Interpretation – 257 7 Bewusstsein – 291 8 Lernen – 339 9 Gedächtnis – 379 10 Denken und Sprache – 429 11 Intelligenz – 467 12 Motivation – 511 13 Emotion – 547 14 Persönlichkeit – 587 15 Sozialpsychologie – 635 16 Stress und Gesundheit – 691 17 Klinische Psychologie: Psychische Störungen – 743 18 Klinische Psychologie: Therapie – 795 19 Pädagogische Psychologie – 841 20 Arbeits- und Organisationspsychologie – 885 Inhaltsverzeichnis Prolog: Eine kurze Geschichte der Psychologie . . . . . . 1 Wurzeln der Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vorwissenschaftliche Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Geburtsstunde der wissenschaftlichen Psychologie . . . . . . 5 Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie . . . . . . . 7 Moderne Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Große Themen der Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Drei zentrale Analyseniveaus der Psychologie . . . . . . . . . 11 Arbeitsfelder der Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 Kritisch denken mit wissenschaftlicher Psychologie . . 17 1.1 Brauchen wir die wissenschaftliche Psychologie? . . . . . . . 18 1.1.1 Grenzen der Intuition und des gesunden Menschenverstandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.1.2 Wissenschaftliches Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.1.3 Wissenschaftliche Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.2 Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.2.1 Einzelfallstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.2.2 Befragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.2.3 Beobachtung in natürlicher Umgebung (Feldbeobachtung) . 29 1.3 Korrelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.3.1 Korrelation und Kausalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1.3.2 Illusorische Korrelationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.3.3 Wahrnehmung von Ordnung bei zufälligen Ereignissen . . . 35 1.4 Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1.4.1 Ursache und Wirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1.4.2 Therapieevaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.4.3 Unabhängige und abhängige Variablen . . . . . . . . . . . . . 38 1.5 Grundlagen statistischer Argumentation . . . . . . . . . . . . . 40 1.5.1 Datenbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.5.2 Inferenzstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1.6 Häufig gestellte Fragen zur Psychologie . . . . . . . . . . . . . 45 2 Neurowissenschaft und Verhalten . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.1 Neuronale Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.1.1 Neuron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.1.2 Wie Nervenzellen kommunizieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.1.3 Wie uns Neurotransmitter beeinflussen . . . . . . . . . . . . . . 60 2.2 Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2.2.1 Peripheres Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.2.2 Zentrales Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.3 Endokrines System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.4 Gehirn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2.4.1 Forschungswerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.4.2 Ältere Hirnstrukturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.4.3 Zerebraler Kortex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2.4.4 Zur Zweiteilung des Gehirns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3 Anlage, Umwelt und die Vielfalt der Menschen . . . . . . 101 3.1 Verhaltensgenetik: Die Vorhersage individueller Unterschiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.1.1 Gene: Unsere Codes für das Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.1.2 Zwillingsstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3.1.3 Adoptionsstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3.1.4 Studien zum Temperament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.1.5 Erblichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.1.6 Anlage-Umwelt-Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3.1.7 Molekulargenetik: Eine neue Herausforderung . . . . . . . . . 112 3.2 Evolutionspsychologie: Wie man die Natur des Menschen versteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.2.1 Natürliche Selektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.2.2 Evolutionstheoretische Erklärung der menschlichen Sexualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3.2.3 Kritik am evolutionspsychologischen Ansatz . . . . . . . . . . 120 3.3 Eltern und Gleichaltrige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3.3.1 Eltern und frühe Erfahrungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3.3.2 Einfluss der Gleichaltrigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.4 Kulturelle Einflüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.4.1 Kulturübergreifende Unterschiede . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3.4.2 Zeitübergreifende Veränderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.4.3 Kultur und Selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3.4.4 Kultur und Kindererziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 3.5 Entwicklung des sozialen Geschlechts . . . . . . . . . . . . . . 136 3.5.1 Geschlechtsbezogene Ähnlichkeiten und Unterschiede . . . 136 3.5.2 Biologische Grundlagen des Geschlechts . . . . . . . . . . . . . 139 3.5.3 Soziale Einflüsse auf das Geschlecht . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3.6 Überlegungen zu Anlage und Umwelt . . . . . . . . . . . . . . 145 4 Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.1 Pränatale Entwicklung und erste Lebenswochen . . . . . . . . 150 4.1.1 Zeugung und Empfängnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.1.2 Pränatale Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.1.3 Fähigkeiten des Neugeborenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4.2 Kleinkindzeit und Kindheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.2.1 Körperliche Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.2.2 Kognitive Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4.2.3 Soziale Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.3 Adoleszenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4.3.1 Körperliche Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.3.2 Kognitive Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4.3.3 Soziale Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4.3.4 Übergang ins Erwachsenenalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4.4 Erwachsenenalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.4.1 Körperliche Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4.4.2 Kognitive Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 4.4.3 Soziale Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.5 Zwei wichtige Themen der Entwicklungspsychologie . . . . . 209 4.5.1 Kontinuierliche und stufenweise Entwicklung . . . . . . . . . 210 4.5.2 Stabilität und Veränderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5 Wahrnehmung: Sinnesorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5.1 Grundprinzipien sensorischer Wahrnehmung . . . . . . . . . . 215 5.1.1 Schwellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 5.1.2 Sensorische Adaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 XXII 5.2 Sehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 5.2.1 Reizinput Lichtenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 5.2.2 Auge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 5.2.3 Visuelle Informationsverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 5.2.4 Farbensehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 5.3 Hören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 5.3.1 Reizinput Schallwellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 5.3.2 Ohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 5.3.3 Schwerhörigkeit und Gehörlosenkultur . . . . . . . . . . . . . . 240 5.4 Andere wichtige Sinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 5.4.1 Tastsinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 5.4.2 Geschmackssinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 5.4.3 Geruchssinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 5.4.4 Lage und Bewegung des Körpers im Raum . . . . . . . . . . . 254 6 Wahrnehmung: Organisation und Interpretation . . . . 257 6.1 Selektive Aufmerksamkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.2 Wahrnehmungstäuschungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 6.3 Wahrnehmungsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.3.1 Formwahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 6.3.2 Tiefenwahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.3.3 Bewegungswahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6.3.4 Wahrnehmungskonstanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 6.4 Wahrnehmungsinterpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 6.4.1 Sensorische Deprivation und wiederhergestelltes Sehvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 6.4.2 Wahrnehmungsadaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 6.4.3 Wahrnehmungsset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 6.4.4 Wahrnehmung und der Faktor Mensch . . . . . . . . . . . . . . 282 6.5 Gibt es außersinnliche Wahrnehmung? . . . . . . . . . . . . . . 286 6.5.1 Was ist außersinnliche Wahrnehmung? . . . . . . . . . . . . . . 286 6.5.2 Vorahnungen oder Einbildungen? . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 6.5.3 Außersinnliche Wahrnehmung auf dem Prüfstand . . . . . . . 288 7 Bewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 7.1 Bewusstsein und Informationsverarbeitung . . . . . . . . . . . 292 7.2 Schlaf und Träume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 7.2.1 Biologische Rhythmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 7.2.2 Schlafrhythmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 7.2.3 Wozu brauchen wir den Schlaf? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 7.2.4 Schlafstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 7.2.5 Träume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 7.3 Hypnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 7.3.1 Fakten und Fehlinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 7.3.2 Ist Hypnose ein veränderter Bewusstseinszustand? . . . . . . 319 7.4 Drogen und Bewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 7.4.1 Abhängigkeit und Sucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 7.4.2 Psychoaktive Substanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 7.4.3 Welche Faktoren beeinflussen den Drogenkonsum? . . . . . . 331 7.5 Nahtoderfahrungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 8 Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 8.1 Wie lernen wir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 8.2 Klassische Konditionierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 8.2.1 Pawlows Experimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 8.2.2 Aktuelle Erweiterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 8.2.3 Anwendungsbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 8.3 Operante Konditionierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 8.3.1 Skinners Experimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 8.3.2 Shaping (Verhaltensformung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 8.3.3 Bestrafung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 8.3.4 Aktuelle Erweiterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 8.3.5 Anwendungsbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 8.3.6 Gegenüberstellung von klassischer und operanter Konditionierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 8.4 Beobachtungslernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 8.4.1 Banduras Experimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 8.4.2 Anwendungsbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 9 Gedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 9.1 Das Phänomen Gedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 9.1.1 Informationsverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 9.2 Enkodieren: Information in den Speicher überführen . . . . . 385 9.2.1 Wie wir enkodieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 9.2.2 Was wir enkodieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 9.3 Speichern: Information aufbewahren . . . . . . . . . . . . . . . 394 9.3.1 Sensorisches Gedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 9.3.2 Arbeitsgedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 9.3.3 Langzeitgedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 9.3.4 Die Speicherung von Erinnerungen im Gehirn . . . . . . . . . 397 9.4 Abrufen: Informationen auffinden . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 9.5 Vergessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 9.5.1 Scheitern der Enkodierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 9.5.2 Speicherzerfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 9.5.3 Scheitern des Abrufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 9.6 Konstruktion von Erinnerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 9.6.1 Auswirkungen von Fehlinformationen und Imagination . . . 417 9.6.2 Quellenamnesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 9.6.3 Echte und falsche Erinnerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 9.6.4 Kinder als Augenzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 9.6.5 Verdrängte oder konstruierte Erinnerungen an Missbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 9.7 Gedächtnistraining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 10 Denken und Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 10.1 Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 10.1.1 Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 10.1.2 Problemlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 10.1.3 Entscheidungsfindung und Urteilsbildung . . . . . . . . . . . . 436 10.1.4 Überzeugungsbias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 10.2 Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 10.2.1 Sprachstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 10.2.2 Sprachentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 10.3 Denken und Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 10.3.1 Einfluss der Sprache auf das Denken . . . . . . . . . . . . . . . . 455 10.3.2 Denken in Bildern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 10.4 Denken und Sprache bei Tieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 10.4.1 Können Tiere denken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 10.4.2 Verfügen Tiere über Sprache? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 10.4.3 Das Beispiel der Affen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 11 Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 11.1 Was ist Intelligenz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 11.1.1 Intelligenz als eine umfassende oder als verschiedene spezifische Fähigkeiten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 11.1.2 Intelligenz und Kreativität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 11.1.3 Ist Intelligenz neurologisch messbar? . . . . . . . . . . . . . . . 478 11.2 Intelligenzmessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 11.2.1 Ursprünge der Intelligenzmessung . . . . . . . . . . . . . . . . 481 11.2.2 Moderne Tests der geistigen Fähigkeiten . . . . . . . . . . . . . 484 11.2.3 Prinzipien des Testaufbaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 11.3 Intra- und interindividuelle Intelligenzunterschiede . . . . . 490 11.3.1 Stabilität oder Veränderung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 11.3.2 Intelligenzextreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 11.4 Genetische und umweltbedingte Einflüsse auf die Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 11.4.1 Genetische Einflüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 11.4.2 Umweltbedingte Einflüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 11.4.3 Gruppenunterschiede bei Intelligenztests . . . . . . . . . . . . 499 11.4.4 Probleme der Verzerrung in Intelligenztests . . . . . . . . . . . 505 12 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 12.1 Sichtweisen der Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 12.1.1 Instinkte und Evolutionspsychologie . . . . . . . . . . . . . . . 513 12.1.2 Triebe und Anreize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 12.1.3 Optimale Erregung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 12.1.4 Maslows Bedürfnishierarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 12.2 Hunger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 12.2.1 Physiologie des Hungers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 12.2.2 Psychologie des Hungers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 12.3 Sexuelle Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 12.3.1 Physiologie der Sexualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 12.3.2 Psychologie der Sexualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 12.3.3 Sexualität im Jugendalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 12.3.4 Sexuelle Orientierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 12.3.5 Sexualität und die Wertvorstellungen von Menschen . . . . . 539 12.4 Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 12.5 Leistungsmotivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 13 Emotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 13.1 Emotionstheorien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 13.2 Emotion und Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 13.2.1 Emotionen und das autonome Nervensystem . . . . . . . . . 551 13.2.2 Physiologische Ähnlichkeiten zwischen spezifischen Emotionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 13.2.3 Physiologische Unterschiede zwischen spezifischen Emotionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 13.2.4 Kognition und Emotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 13.3 Emotion und Ausdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 13.3.1 Nonverbale Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 13.3.2 Emotionsausdruck im kulturellen Kontext . . . . . . . . . . . . 564 13.3.3 Mimischer Ausdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 13.4 Emotion und Erfahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 13.4.1 Angst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 13.4.2 Wut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 13.4.3 Glücklichsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 14 Persönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 14.1 Psychoanalytischer Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 14.1.1 Erforschung des Unbewussten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 14.1.2 Neofreudianische und psychodynamische Theorien . . . . . 594 14.1.2 Erfassung unbewusster Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 14.1.4 Bewertung des psychoanalytischen Ansatzes . . . . . . . . . . 597 14.2 Humanistischer Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 14.2.1 Abraham Maslows Konzept der Selbstverwirklichung . . . . 603 14.2.2 Carl Rogers’ personzentrierter Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . 604 14.2.3 Erfassung des Selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 14.2.4 Bewertung des humanistischen Ansatzes . . . . . . . . . . . . 605 14.3 Trait-Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 14.3.1 Exploration von Merkmalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 14.3.2 Erfassung von Merkmalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 14.3.3 Das Fünf-Faktoren-Modell (»The Big Five«) . . . . . . . . . . . . 613 14.3.4 Bewertung des Trait-Ansatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 14.4 Sozial-kognitiver Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 14.4.1 Reziproke (wechselseitige) Beeinflussung . . . . . . . . . . . . 619 14.4.2 Persönliche Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 14.4.3 Erfassung von Situationseinflüssen auf das Verhalten . . . . . 625 14.4.4 Bewertung des sozial-kognitiven Ansatzes . . . . . . . . . . . . 626 14.5 Das Selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 14.5.1 Die Vorteile des Selbstwertgefühls . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 14.5.2 Kultur und Selbstwertgefühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 14.5.3 Selbstwertdienliche Verzerrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 15 Sozialpsychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 15.1 Soziales Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 15.1.1 Attribution von Verhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 15.1.2 Einstellungen und Handlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 15.2 Sozialer Einfluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 15.2.1 Konformität und Gehorsam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 15.2.2 Gruppeneinfluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 15.3 Soziale Beziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 15.3.1 Vorurteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 15.3.2 Aggression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 15.3.3 Konflikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 15.3.4 Interpersonale Anziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 15.3.5 Altruismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 15.3.6 Frieden stiften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 16 Stress und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 16.1 Stress und Krankheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 16.1.1 Stress und Stressoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 16.1.2 Stress und Herzkrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 16.1.3 Stress und Krankheitsanfälligkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 16.2 Gesundheitsförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 16.2.1 Bewältigung von Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 16.2.2 Umgang mit Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 16.2.3 Änderung gesundheitsschädigender Verhaltensweisen . . . 720 17 Klinische Psychologie: Psychische Störungen . . . . . . . 743 17.1 Was sind psychische Störungen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 17.1.1 Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 17.1.2 Erklärungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 17.1.3 Klassifikation psychischer Störungen . . . . . . . . . . . . . . . 749 17.1.4 Probleme und Gefahren der Etikettierung . . . . . . . . . . . . 753 17.2 Angststörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 17.2.1 Generalisierte Angststörung und Panikstörung . . . . . . . . . 757 17.2.2 Phobien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 17.2.3 Zwangsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 17.2.4 Posttraumatische Belastungsstörung . . . . . . . . . . . . . . . 759 17.2.5 Erklärungsansätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 17.3 Affektive Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 17.3.1 Major Depression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 17.3.2 Bipolare Störung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 17.3.3 Erklärungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 17.4 Schizophrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 17.4.1 Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 17.4.2 Subtypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 17.4.3 Erklärungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 17.5 Persönlichkeitsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 17.6 Prävalenz psychischer Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 18 Klinische Psychologie: Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 18.1 Psychotherapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 18.1.1 Psychoanalytische Therapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 18.1.2 Humanistische Therapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 18.1.3 Verhaltenstherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 18.1.4 Kognitive Therapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 18.1.5 Gruppen- und Familientherapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 18.2 Therapieevaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 18.2.1 Wie wirksam ist die Psychotherapie? . . . . . . . . . . . . . . . . 813 18.2.2 Welche Therapie für welche Störung? . . . . . . . . . . . . . . . 818 18.2.3 Was bringen alternative Therapien? . . . . . . . . . . . . . . . . 819 18.2.4 Gemeinsamkeiten verschiedener Therapieformen . . . . . . . 822 18.2.5 Kultur und Wertvorstellungen in der Psychotherapie . . . . . 824 18.3 Biomedizinische Therapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 18.3.1 Medikamentöse Therapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 18.3.2 Stimulation des Gehirns: Elektrokrampftherapie . . . . . . . . und transkranielle Magnetstimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 18.3.3 Psychochirurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 18.4 Prävention psychischer Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 19 Pädagogische Psychologie: Übersicht und ausgewählte Themen . . . . . . . . . . . . . 841 19.1 Überblick über die Pädagogische Psychologie . . . . . . . . . 842 19.1.1 Gegenstand und Aufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 19.1.2 Geschichte der deutschsprachigen Pädagogischen Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 19.1.3 Pädagogische Psychologie in der Praxis: Das Arbeitsfeld der Schulpsychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 19.2 Bedeutung der elterlichen Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . 849 19.2.1 Spielt die elterliche Erziehung eine Rolle? . . . . . . . . . . . . 849 19.2.2 Welcher Erziehungsstil ist am günstigsten? . . . . . . . . . . . 852 19.3 Erziehungseinflüsse auf die Internalisierung . . . . . . . . . . . von moralischen Regeln und Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 19.3.1 Hoffmans Theorie zum Einfluss der elterlichen Erziehung auf die Internalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 19.3.2 Überprüfung, Kritik und Erweiterungen der Theorie Hoffmans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 19.3.3 Pädagogische Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . 866 19.4 Aggressionen und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 19.4.1 Gespielte und ernsthafte Aggressionen . . . . . . . . . . . . . 869 19.4.2 Mobbing unter Kindern – eine besondere Form der Gewalt . 870 19.4.3 Das Early-Starter-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 19.4.4 Längsschnittbeobachtungen zu elterlichen Einflüssen auf die Genese von Problemverhalten . . . . . . . . . . . . . . . 874 19.5 Neue Aufgaben und Herausforderungen der Pädagogischen Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 19.5.1 Auswirkungen der außerfamiliären Kleinkindbetreuung . . . 878 19.5.2 Modelle zur Erklärung von Schulleistungsunterschieden . . . 880 20 Arbeits- und Organisationspsychologie . . . . . . . . . . . 885 20.1.1 Arbeitsmotivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 20.1.2 Arbeitszufriedenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 20.2 Arbeit und Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 20.2.1 Stress und Stressoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 20.2.2 Mobbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 20.2.3 Work-Life-Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 20.3 Veränderte Arbeitsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 20.3.1 Neue Technologien: Wann sind Innovationen erfolgreich? . . 905 20.3.2 Arbeitszeit und Arbeitsplatz: Mehr Flexibilität . . . . . . . . . . 907 20.3.3 Arbeitslosigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 20.4 Psychologie in Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 20.4.1 Organisationsform und Organisationsstruktur . . . . . . . . . 916 20.4.2 Teams, Gruppen und Qualitätszirkel . . . . . . . . . . . . . . . . 918 20.4.3 Führung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 20.5 Arbeit und Persönlichkeit: Auswahl und Auswirkungen . . . 925 20.5.1 Personalauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 20.5.2 Wer kommt wann voran? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 20.5.3 Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung . . . . . . . . . . . . . . 935 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Psychologie als Beruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 Quellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Namenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weitere Titel aus der Reihe Springer-Lehrbuch |
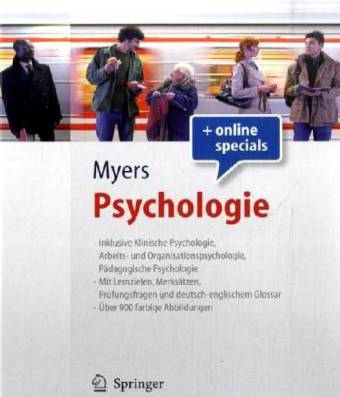
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen