|
|
|
Umschlagtext
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen orientiert sich konsequent an Gleichstellung, Teilhabe und Selbstbestimmung von Mädchen und Buben sowie Frauen und Männern mit Behinderung.
Die Auseinandersetzung über die damit verbundenen Konsequenzen für Politik und Gesellschaft hat eben erst begonnen. Auch für die Integrations- und Inklusionsforschung stellt das internationale Übereinkommen eine Herausforderung dar, wie die vielfältigen Beiträge zu folgenden vier Schwerpunkten zeigen: • Inklusive Gesellschaft • Inklusive Schule • Inklusive Forschung • Arbeiten mit dem Index für Inklusion Die Herausgeberinnen Petra Flieger, Mag.a, freie Sozialwissenschaftlerin; Schwerpunkte: Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen Gesellschaftsbereichen, partizipatorische Forschung. Volker Schönwiese, A.Univ.-Prof. Dr., Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck; Aufbau des Lehr- und Forschungsbereichs der Inklusiven Pädagogik und Disability Studies. Rezension
Nach Meinung der Herausgeber gilt: Die UNO-Regeln sind ein wichtiges Gesetz für Menschen mit Behinderungen. Sie gelten auch für die Forschung. Wissenschaftler und Forscherinnen müssen nun überlegen, was die UNO-Regeln für ihre Arbeit bedeuten. - Schulen und Universitäten sollen wirklich für alle Menschen offen sein. Alle sollen beim Lernen die Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Das nennt man inklusive Bildung. - Menschen mit Behinderung sollen überall miutwirken können. Auch in der Forschung sollen sie dabei sein. Das ist nicht einfach und kann Angst machen. Es ist wichtig, dass man über diese Angst nachdenkt und redet. Dann werden die Ergebnisse der Forschung besser.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
Marianne Schulze Menschenrechte für alle: Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 11 Petra Flieger und Volker Schönwiese Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Eine Herausforderung für die Integrations- und Inklusionsforschung 27 2 Aspekte inklusiver Gesellschaft Bettina Bretländer und Ulrike Schildmann Geschlechtersensible Inklusionsforschung vor dem Hintergrund der neuen UN-Konvention (vor allem Artikel 6, 23, 24, 27, 28) 39 Marion Sigot Die UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen und ihre Auswirkungen auf die Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten 47 Natalia Postek Die UN-Konvention und politische Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten 53 Petra Flieger Zum Stand der Umsetzung von Artikel 19 der UN-Konvention in Österreich 59 Alina Kirschniok Analyse sozialräumlicher Behinderungen und Ressourcen 67 Imke Niediek Das Subjekt in der Hilfeplanung 75 Kirsten Puhr und Wolfgang Rathke Unterstützung selbstbestimmter Teilhabe durch ein Persönliches Budget!? 83 3 Aspekte Inklusiver Schule Natascha Korff und Katja Scheidt Inklusive (Fach-)Didaktik und LehrerInnenexpertise: Ergebnisse zweier Pilotstudien 91 Tanja Sturm Differenzkonstruktionen in unterrichtlichen Praktiken 99 Bernadette Hörmann und Stefan T. Hopmann Marginalisierungsprozesse von Menschen mit Behinderungen im Rahmen von „School-Accountability“-Maßnahmen 105 Helga Fasching Beiträge der Forschung zu inklusiven Übergangsprozessen von der Schule in Ausbildung und Beruf 111 Anette Hausotter UN-Konvention und Inklusion – Aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse im Rahmen inklusiver Bildung in Europa 119 Lea Schäfer Inklusion International. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Spanien 125 Reinhard Markowetz Inclusive Education: Schulentwicklung in Burkina Faso/Westafrika 131 4 Aspekte Inklusiver Forschung Oliver Koenig und Tobias Buchner unter Mitarbeit von Filiz Cay, Franz Hoffmann, Michaela Koenig, Wolfgang Orehounig, Daniela Pittl, Simon Prucker und Monika Rauchberger Die Bedeutung von Lebensgeschichten für die UN-Konvention 139 Wiebke Curdt Integrativ oder inklusiv: Integration in ein Forschungsvorhaben 153 Markus Eichinger und Gertrude Kremsner Vier Semester inklusive Forschung in einem Seminar an der Universität Wien: Rück- und Ausblick 161 5 Arbeiten mit dem Index für Inklusion Ines Boban und Andreas Hinz „Index für Inklusion“ – ein breites Feld von Möglichkeiten zur Umsetzung der UN-Konvention 169 Maria-Luise Braunsteiner und Stefan Germany Wiener Neudorf und United Nations aus dem Blickwinkel des begleitenden ForscherInnenteams – ausgewählte Ergebnisse der Begleitforschung zum Projekt „INKLUSION – Vernetzung der Bildungseinrichtungen der Gemeinde Wiener Neudorf“ 177 Jo Jerg, Sabine Kaiser und Stephan Thalheim Organisatorische, pädagogische und gemeinwesenorientierte Inklusionsentwicklungen in Kindertageseinrichtungen: Modellprojekt IQUAnet 197 Clemens Dannenbeck und Carmen Dorrance Inklusion in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit – ein Fortbildungsmodul 205 Andreas Hinz Eine Region Schleswig-Holsteins auf dem inklusiven Weg 213 Ines Boban und Andreas Hinz Arbeit auf der Basis des Index für Inklusion mit Schulen im Land Sachsen-Anhalt 219 Edith Brugger-Paggi Projekt „Index für Inklusion“ Eine Ressource zur Entwicklung einer inklusiven Schule, eines inklusiven Kindergartens und ein Instrument zur Selbstevaluation 227 Dietlind Gloystein Gesucht werden … Pankower Schulen auf dem Weg zur Inklusion 231 Barbara Brokamp Ein kommunaler Index für Inklusion – oder: Wie können sinnvoll kommunale inklusive Entwicklungsprozesse unterstützt werden? 237 Andrea Platte und Christian-Peter Schultz Inklusive Bildung an der Hochschule – Impulse für LehrerInnenbildung und Soziale Arbeit 245 Liste der Autorinnen und Autoren 253 Leseprobe: 1 Einführung Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 11 Marianne Schulze Menschenrechte für alle: Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung in Leichter Sprache Menschenrechte sind die Rechte, die man hat, weil man Mensch ist. Die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen werden oft übersehen. Deshalb gibt es eine Konvention. Eine Konvention ist eine Vereinbarung von Regeln zwischen Staaten. In der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen vereinbart. Der folgende Text erklärt die Geschichte und die Regeln der Konvention. Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) hat den Zweck, die „… volle und gleichberechtigte Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung ihrer angeborenen Würde zu fördern“ (Artikel 1 CRPD). Menschenrechte sind jene Rechte, die man kraft Menschseins hat. Sie sind die Grenze, die das Individuum vis-à-vis dem Staat zieht und die der Staat mit dem Ziel, ein Leben in Würde für jeden und jede zu ermöglichen, zu beachten und zu wahren hat. Es gibt keinen Lebensbereich, der nicht in irgendeiner Form von den mehr als 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erfasst ist. Die Lektüre der Morgenzeitung – ein Produkt der Meinungsfreiheit, der morgendliche Kaffee – ein Aspekt des Menschenrechts auf Nahrung, das Recht durch die Teilnahme an Wahlen die politische Vertretung zu bestimmen ... Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. „Alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren“, beginnt die oft zitierte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurde. Seither wurde in Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 12 Marianne Schulze zahlreichen anderen Verträgen, Verfassungen und auch Gesetzen in verschiedensten Varianten darauf hingewiesen, dass alle gleich an Rechten sind und dieselben Chancen haben sollen, diese zu verwirklichen. Was auf dem Papier vielversprechend aussieht und wohl klingt, ist im Alltag oft ein schlecht oder gar nicht erfüllter – moralischer – Anspruch. Die Durchsetzung von Menschenrechten ist ihrer Natur nach schwierig und eine Herausforderung, die niemals endet. Wiewohl es in allen Ländern der Welt – teilweise dramatischen – Verbesserungsbedarf für die Umsetzung von Menschenrechten gibt, ist eine stetige Verbesserung der Behauptung der Rechte des Einzelnen – und der Einzelnen – gegenüber dem Staat in den letzten Jahrzehnten eindeutig festzustellen. Vor allem gesetzliche Verbesserungen sind oft auf eine wachsende Anerkennung von Menschenrechten zurückzuführen, man denke z.B. an die Verbesserung des Gleichstellungsrechts oder den Schutz des und der Einzelnen im Bereich Datenschutz. 1 Der mangelnde Schutz der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen Eine kritische Betrachtung des Menschenrechtsdiskurses der letzten 60 Jahre macht unter anderem deutlich, dass Menschen mit Behinderungen und die Barrierefreiheit von Menschenrechten wenig Beachtung gefunden haben. Ein wesentlicher Faktor dafür ist die Tatsache, dass der Anfangsklausel der Menschenrechtserklärung – „Alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren“ – eine unvollständige Anti-Diskriminierungsklausel folgt. Die Gründe, nach denen nicht diskriminiert werden soll, erfassen unter anderem Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft, nicht jedoch Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen. In einer Auffangklausel wird auf „andere Gründe“ verwiesen, jedoch ist dieses Auffangnetz über die Jahrzehnte ungenutzt geblieben. Auch deshalb wurde Menschen mit Behinderungen vielfach die ausdrückliche Anerkennung ihrer Menschenrechte verwehrt. Darüber hinaus wird in Dokumenten aus den 1960er- bis 1980er-Jahren deutlich, dass es an Bewusstsein über Barrieren jedweder Natur – sozialer, kommunikativer oder intellektueller sowie baulicher – mangelte. Auch deshalb sind Menschen mit Behinderungen in den meisten Menschenrechtsverträgen, die seit 1948 beschlossen wurden, nicht erwähnt. Ein seit 1966 – und in Österreich seit 1978 – verbindlicher Vertrag über politische und bürgerliche Rechte (CCPR) erwähnt Menschen mit Behinderungen genauso wenig wie der im selben Jahr beschlossene Vertrag über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) oder die Menschenrechtskonvention gegen Rassismus (CERD), die auch in dieser historischen Phase beschlossen wurde. Vielfach zitiert ist auch eine ca. zehn Jahre später beschlossene Konvention über die Rechte von Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 Menschenrechte für alle 13 Frauen (CEDAW) – auch diese erwähnt „Behinderungen“ bzw. Beeinträchtigungen nicht. Eine Ausnahme ist die Kinderrechtskonvention (CRC), die 1989 beschlossen wurde und die in einem eigenen Artikel (23 CRC) auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen eingeht. Sie sieht unter anderem die Förderung der Selbstständigkeit von Kindern mit Behinderungen vor. Auch das Recht von Kindern mit Behinderungen, die für die Betreuung notwendigen Mittel auf Antrag zu erhalten, wird in dieser Konvention anerkannt (Artikel 23 Abs. 2 CRC). Weiters sind Ausbildung, Gesundheitsversorgung, Rehabilitation, die Vorbereitung auf das Berufsleben in Hinblick auf eine möglichst umfassende soziale Integration1 und individuelle Entfaltung des Kindes in dieser Konvention als Rechte verbrieft, die explizit auch für Kinder mit Behinderungen Wirklichkeit werden sollen. Die Kinderrechtskonvention ist in fast allen Staaten der Welt anerkannt; die unrühmliche Ausnahme sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Jedoch blieb der erhoffte Effekt in Sachen Barrierefreiheit für und Inklusion von Kindern mit Behinderungen – sowie von Menschen mit Behinderungen generell – aus: Die Umsetzung dieser Bestimmung ist in fast allen Ländern – wenn überhaupt – Stückwerk geblieben. Die erhoffte Etablierung von Barrierefreiheit als notwendigen Aspekt der Umsetzung von Menschenrechten blieb völlig aus. Wie Theresia Degener und Gerard Quinn (2002) in einer Studie für das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte feststellten, sind Verweise auf Behinderungen in den allgemeinen Diskussionen der Menschenrechtsgremien sehr sporadisch. Der – versuchten – Vollständigkeit halber sei auch darauf verwiesen, dass Resolutionen der UN-Generalversammlung und Beschlüsse anderer internationaler Gremien über hilflos wirkende Versuche, die Anliegen von Menschen mit Behinderungen zu thematisieren – die fast ausschließlich auf dem medizinischen Modell aufbauen – nicht hinauskamen (vgl. von Bernstorff 2007). Daran anknüpfend werden Menschen mit Behinderungen in diesen Dokumenten überwiegend als wohlfahrtsbedürftige Objekte dargestellt, von Rechten in einer umfassenden Form ist nicht einmal ansatzweise die Rede. Eine rühmliche Ausnahme bilden die Erläuterungen des Komitees zum Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu Menschen mit Behinderungen: „Sowohl die de iure als auch de facto Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen hat eine lange Geschichte und nimmt viele verschiedene Formen an. Sie reicht von verletzenden Diskriminierungen, wie z.B. der Verweigerung von Bildungschancen zu den eher ‚subtilen’ Formen, wie z.B. Segregierung und Isolierung, bedingt durch physische und soziale 1 Die Übersetzung verwendet den Ausdruck „Integration“, da der Originaltext auch von „social integration“ spricht, vgl. Artikel 23 (3) Kinderrechtskonvention (CRC). Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 14 Marianne Schulze Barrieren ... Durch Gleichgültigkeit, Vorurteile und falsche Vorstellungen sowie Exklusion bzw. Separierung werden Menschen mit Behinderungen sehr oft daran gehindert, ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu verwirklichen. Die Auswirkungen von behinderungsbedingter Diskriminierung sind zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Arbeit, Wohnung, Verkehr, Kultur und Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen besonders gravierend“ (Komitee 1994, 15). 2 Das Entstehen der Konvention Nach zahlreichen, vor allem von Nichtregierungsorganisationen und besonders von Behindertenorganisationen initiierten Anläufen machte 2001 Mexiko einen Vorstoß, eine eigene Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu verhandeln. Wiewohl es Bemühungen gab, die Initiative zu hintertreiben, war eine Staatengruppe rund um Mexiko – vor allem auch Neuseeland – sehr erfolgreich, das einmal begonnene Projekt zügig und unter großer Beteiligung der Zivilgesellschaft zu Ende zu bringen: Am 13.12. 2006 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (A/RES/61/106). Bevor es so weit war, gab es insgesamt neun Verhandlungsrunden, bei denen in verschiedenen Formationen von allen 192 UN-Mitgliedsstaaten oder Arbeitsgruppen am Text gefeilt wurde. Die Involvierung der Zivilgesellschaft ging so weit, dass manche Staatendelegationen VertreterInnen von Behindertenorganisationen aufnahmen; in manchen Fällen wurde die Delegation auch von Menschen mit Behinderungen geleitet. Die anfängliche Ignoranz mancher DiplomatInnen wurde vielfach mit lebensnahen Methoden durchbrochen: Der Tradition der Vereinten Nationen folgend wurden in einer abendlichen Verhandlungsrunde Dokumente mit dem Hinweis, dass am darauffolgenden Tag die Übersetzung in den sechs offiziellen UN-Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Chinesisch) zur Verfügung stehen würde, verteilt. Weil es keine barrierefreie Version auf einem Datenträger für die sehbehinderten TeilnehmerInnen der Runde gab, wurde bei nächster Gelegenheit ein Dokument in Braille – mit dem unerlässlichen Hinweis auf die Übersetzung bis zum nächsten Tag – verteilt. Die Aktion verfehlte ihre Wirkung nicht: Ab der nächsten Verhandlungsrunde gab es einen Brailledrucker und barrierefreie Datenträger. Um die Kraft dieser Konvention über den direkten Einflussbereich für Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen zu verstehen, muss man – zumindest – zum Ende des Kalten Krieges Anfang der 90er-Jahre zurückschalten. In der Zeit der Rivalität zwischen Ost und West wurden Menschenrechte vor allem als diplomatischer Spielball eingesetzt. Die eine Seite warf Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 Menschenrechte für alle 15 der jeweils anderen Seite die Missachtung bestimmter Rechte vor, die eigentliche Umsetzung wurde wenig diskutiert. Auch wurde infolge der politischen Dimension des Themas die Zivilgesellschaft weitestgehend ausgeschlossen. Das änderte sich nach dem Ende der politischen Eiszeit stetig. Ein erstes – wichtiges – Signal war eine Weltkonferenz zu Menschenrechten, die 1993 in Wien stattfand. Die sogenannte Wiener Erklärung untermauert die Notwendigkeit, Menschenrechte, die auf internationaler Ebene beschlossen werden, auf nationaler Ebene umzusetzen. Gleichzeitig wurde die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der Rechte unterstrichen. Diese – und andere – Aspekte der „Wiener Erklärung“ haben sich sowohl in den Verhandlungen der Konvention als auch im Text selbst bemerkbar gemacht. Neben der beispiellosen Beteiligung der Zivilgesellschaft war es vor allem die Involvierung von nationalen Menschenrechtsinstituten, die auffallend war. Eine der Konsequenzen ist, dass die Konvention die erste ihrer Art ist, die einen nationalen Überwachungsmechanismus vorsieht. 3 Die Konvention Menschen mit Behinderungen nicht länger als Objekte zu sehen, die des Mitleids und der Fürsorge bedürfen, sondern als Subjekte, die selbstbestimmt alle Menschenrechte barrierefrei und – wo notwendig mit Unterstützung – selbst verwirklichen können sollen, ist die Kernaussage der Konvention. Dieser längst überfällige Paradigmenwechsel, der den Fokus von den medizinischen Parametern – und einer vorgeblichen „Heilung“ von Beeinträchtigungen – auf die sozialen Aspekte von Behinderung verschiebt, macht unter anderem die Barrieren in den Verhaltensmustern der Mehrheitsbevölkerung deutlich. Wie Simon Walker, der Experte des Büros der Hochkommissärin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, bei einem nicht publizierten Vortrag im britischen Parlament pointiert formulierte: „It is not about fixing people but about fixing society“. Das multidimensionale Verständnis von Barrierefreiheit, das der Konvention zugrunde liegt, betont vor allem die Bedeutung von sozialen Barrieren, wie z.B. Stereotypen, Vorurteilen und anderen Formen von Stigma in der Exklusion von Menschen mit Behinderungen. Die Konvention hält daher fest, dass „… das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern …” (Präambel (e) CRPD). Das Dogma, wonach Menschen mit Behinderungen nicht behindert sind, sondern behindert werden, drückt sich gerade auch in der Betonung der Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 16 Marianne Schulze Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und der – vor allem sozialen – Umwelt aus. Im klaren Bruch mit bislang üblichen medizinischen Beschreibungen umschreibt die Konvention daher in einer nicht abschließenden Formulierung Personen mit Behinderung als „… Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Artikel 1 CRPD). Wichtig zu betonen ist, dass die Konvention keine Definition von Behinderung enthält, jedoch eine, auch die Versagung von angemessenen Vorkehrungen umfassende Definition von „Diskriminierung“ (Artikel 2 CRPD). Im neuen Paradigma, das in Teilen dem biosozialen Modell der Weltgesundheitsorganisation folgt, ist Inklusion der Schlüssel, um soziale Barrieren zu überwinden und wird Inklusion zum Prinzip, das die Adaptierung von Strukturen auf allen Ebenen erfordert (vgl. Hirschberg 2009). In der Vielzahl von Barrieren, die Menschen mit Behinderungen überwinden müssen, betont die Konvention auch die kommunikativen Barrieren. Die Definition von Kommunikation (Artikel 2 CRPD) umfasst Brailleschrift, Gebärdensprachen und anderen Formen assistierter Kommunikation, v.a. auch für non-verbale Menschen; barrierefreie Kommunikation zieht sich wie ein roter Faden durch den Vertrag. Ein weiterer Barriereaspekt ist schwere Sprache: Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist die erste, die verpflichtend in Leichter Sprache veröffentlicht werden muss (Artikel 49 CRPD). Barrierefreiheit im physischen Sinne ist selbstverständlich auch erfasst; eine umfassende Bestimmung zu Barrierefreiheit befasst sich vor allem mit diesen. Beachtlich ist, dass die deutsche Übersetzung des Artikel 9 den engeren Begriff „Zugänglichkeit“ verwendet. Neben der Betonung der sozialen Barrieren und der Auswirkung von „Wechselwirkungen“ ist Barrierefreiheit auch als ein Grundprinzip der Konvention verankert (Artikel 3 Abs. f CRPD). Barrierefreiheit ist hier im weitesten Sinne und damit nicht nur in der baulichen Dimension zu verstehen. Menschenrechtlich gibt es auch noch eine fünfte – in der Konvention nicht sofort ersichtliche – Dimension von Barrierefreiheit: Die Zugänglichkeit im ökonomischen Sinne, im Sinne einer „Leistbarkeit“, gerade auch für Dienstleistungen und andere Servicedienste (Komitee 1991; 1999). Die Konvention gliedert sich grob in folgende Abschnitte: 3.1 Präambel Diese liest sich wie ein Überblick zur Konvention: Sie stellt die Exklusion von Menschen mit Behinderungen dar, verweist auf die Auswirkungen von Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 Menschenrechte für alle 17 sozialen Barrieren (Präambel (e) CRPD) genauso wie die Bedeutung von Mehrfachdiskriminierung (Präambel (p) CRPD). 3.2 Generelle Bestimmungen Den Auftakt macht der – oben zitierte – Zweck der Konvention, dem eine Umschreibung von Behinderungen folgt. D.h. es gibt keine abschließende Definition von „Behinderungen“, sondern eine Skizze, welche Aspekte eine Behinderung darstellen können. Wie auch in der Präambel wird das Schwergewicht auf die sozialen Ursachen von Ausgrenzung und Exklusion gelegt: Es sind Stereotype, Vorurteile und das mangelnde Wissen der politischen Mitte, die die Barrieren verursachen und dazu führen, dass Menschen behindert werden. Der Begriff der Barrierefreiheit wird in der Konvention daher nicht nur im Sinne baulicher Hürden, sondern in seiner sozialen Dimension verstanden. Das sogenannte soziale Modell ist daher die Grundlage für barrierefreie Menschenrechte. Neben der bereits erwähnten „Kommunikation“ und „Diskriminierung“, werden folgende Begriffe definiert: „angemessene Vorkehrungen“, „Universelles Design“ und „Sprache“. Eine wichtige Bestimmung ist Artikel 3, der „allgemeine Grundsätze“ vorschreibt: Darunter fallen neben Gleichberechtigung auch Barrierefreiheit, Partizipation und Inklusion. Jedes dieser Prinzipien für sich zu diskutieren, könnte Bände füllen – dementsprechend wichtig ist ihre Beachtung und Umsetzung. Ein weiteres Prinzip, das wegweisend ist: Der Respekt für das Verschiedensein von Menschen. In den Allgemeinen Verpflichtungen verpflichten sich Vertragsstaaten zur Anpassung der Gesetzeslage und der Verwaltungspraxis an die Standards der Konvention. Weiters wird die Involvierung der Zivilgesellschaft, insbesondere von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, verpflichtend vorgesehen. In diesem Abschnitt findet sich darüber hinaus eine Bestimmung, die die Geltung der Konvention auch in den Bundesländern vorsieht. Der umfassende Verpflichtungskatalog der Konvention bedeutet zunächst, dass bestehende Gesetze, Verordnungen und Verwaltungspraktiken auf ihre Konformität mit der Konvention zu überprüfen sind. Änderungen gesetzlicher und sonstiger rechtlicher Rahmenbedingungen haben der Konvention zu entsprechen (Artikel 4 CRPD). Zentral ist neben der Einhaltung der Grundprinzipien die umfassende Antidiskriminierungsklausel, die die Versagung von angemessenen Vorkehrungen gemäß der Konvention zur Diskriminierung macht (Artikel 2 & 5 (3) CRPD). Bedeutsam für Partizipationsfragen ist die in dieser Bestimmung enthaltene Verpflichtung zur aktiven Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihren Vertretungsorganisationen in politischen Entscheidungsprozessen (Artikel 4 Abs. 3 CRPD). Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 18 Marianne Schulze Anti-Diskriminierung ist ein Grundpfeiler der Menschenrechte, dementsprechend ist ihr eine Bestimmung – Artikel 5 – gewidmet. Die Versagung von angemessenen Vorkehrungen ist eine Verletzung des Gebots der Gleichbehandlung – die Gewährleistung von angemessenen Vorkehrungen ist explizit vorgesehen. Frauen mit Behinderungen sind vielfach Diskriminierung auf Grund ihres Geschlechts und ihrer Behinderung ausgesetzt, in einem eigenen Artikel wird daher auf den Schutz von Frauen mit Behinderungen – auch vor Mehrfachdiskriminierungen – eingegangen. Die Gefährdung von Kindern mit Behinderungen von Geburt, vor allem – aber nicht ausschließlich – in Entwicklungsländern, bedingt eine eigene Bestimmung (Artikel 7 CRPD). Der Schutz der Unversehrtheit der Person nimmt gerade auch vor dem Hintergrund historischer – und wohl auch gegenwärtiger – Unrechtshandlungen gegenüber Menschen mit Behinderungen, gerade auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, eine zentrale Rolle ein. Die Konvention widmet sich in vier Artikeln explizit dem Schutz vor Gewalt und anderen Formen von Missbrauch (Artikel 14-17). Die barrierefreie und inklusive Gewährleistung von allen Menschenrechten, so auch des Rechts auf Gesundheit, Arbeit, Bildung, soziale Sicherheit sowie sämtlicher politischer und ziviler Menschenrechte, erfordert vor allem einen Bewusstseinswandel. Aus diesem Grund verpflichtet die Konvention zu umfassenden Maßnahmen der Bewusstseinsbildung, um das Recht von Menschen mit Behinderungen, alle Menschenrechte selbstbestimmt zu leben, zu vermitteln und zu fördern (Artikel 8 CRPD). Insbesondere in drei zentralen öffentlichen Bereichen ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten: inklusive Bildung, inklusive Arbeit und chancengleiche politische Partizipation. Darüber hinaus sind auch im Bereich des Privatlebens – Stichwort: Recht, eine Familie zu gründen – umfassende rechtliche ebenso wie gesellschaftspolitische Änderungen und ein Bewusstseinswandel erforderlich. 3.3 Barrierefreie & inklusive Menschenrechte Wiewohl sämtliche Artikel der Konvention eine direkte Verbindung untereinander und miteinander haben, sind es vor allem die ersten neun Artikel, denen in der Umsetzung der in Artikel 9-30 ausformulierten Menschenrechte unmittelbare Bedeutung zukommt. Die Konvention formuliert keine „neuen“ Menschenrechte – sie baut auf dem bereits etablierten Menschenrechtskanon auf. Bis auf Religionsfreiheit sind sämtliche Menschenrechte explizit erfasst. Die Herausarbeitung der Barrierefreiheit und Inklusivität von Menschenrechten bringt jedoch eine Weiterentwicklung mit sich, die an vielen Stellen der Konvention sichtbar ist. Die einzelnen Artikel können grob in folgende Gruppen unterteilt werden: Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 Menschenrechte für alle 19 3.4 Personenschutzrechte Diese Gruppe umfasst das Recht auf Leben, Freiheit von Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, Schutz der Unversehrtheit der Person (Artikel 10, 14-17 CRPD). Explizit gewährleistet ist der Schutz vor medizinischen und wissenschaftlichen Experimenten. Vorgesehen ist auch die Kontrolle von sämtlichen Einrichtungen, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind (Artikel 16 (3) CRPD). 3.5 Selbstbestimmungsrechte Ein zentrales Anliegen der Konvention ist die Anerkennung der Rechts- und Geschäftsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen: Behinderung bzw. Beeinträchtigung darf keine Grundlage sein, um Menschen das Recht zu nehmen, über sämtliche Belange des Lebens – so auch Vertragsabschlüsse oder Kontenführung – selbstständig zu verfügen. Der Entscheidungsprozess von Menschen mit Behinderung muss demnach gegebenenfalls unterstützt werden, darf jedoch nicht von einer dritten Person stellvertretend abgewickelt werden. Eine umfassende Bestimmung zu Selbstbestimmtem Leben (Artikel 19), mit dem klaren Ziel maximale Unabhängigkeit und soziale Inklusion zu erreichen, ist ebenfalls verankert. Daher sind diese Bestimmungen gleichzeitig eine Absage an Einrichtungen, die ausschließlich die Betreuung von Menschen mit Behinderungen bewerkstelligen. In dieser Bestimmung ebenfalls zentral verankert sind Unterstützungsmaßnahmen, vor allem Persönliche Assistenz (siehe dazu des Weiteren Artikel 9 CRPD). Betont wird in diesem Zusammenhang auch die Gewährleistung von Unterstützungsmaßnahmen – wo erforderlich – auf Basis der individuellen Wünsche von Menschen mit Behinderungen. Unterstützungsnetzwerke sind gerade auch im Kontext des Rechts auf die Ausübung von Rechts- und Geschäftsfähigkeit sicherzustellen; diese haben selbstredend menschenrechtlichen Prinzipien zu entsprechen (Artikel 12 CRPD). Ein wichtiger Aspekt in diesem Kontext wird im Recht auf Zugang zur Justiz verankert (Artikel 13 CRPD). Ein wesentlicher Teilaspekt des Prinzips und des Rechts auf Inklusion ist die politische Partizipation. Neben der Verpflichtung, Menschen mit Behinderungen – insbesondere Kinder mit Behinderungen – sowie deren Vertretungsorganisationen (pro)aktiv in politische Prozesse einzubeziehen (Artikel 4 Abs. 3 CRPD), wird auch das Recht auf grundsätzliche politische Partizipation verankert (Artikel 29 CRPD). Neben der Gründung von Vereinen und anderen Formen politischer Organisation, steht hier vor allem das Recht zu Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 20 Marianne Schulze wählen im Mittelpunkt und die Notwendigkeit, die Teilhabe am Wahlprozess inklusiv und barrierefrei zu gewährleisten. 3.6 Freiheitsrechte & Recht auf Familienleben Neben dem spezifischen Recht auf persönliche Mobilität fällt hierunter auch das grundsätzliche Freiheits- und Sicherheitsrecht sowie die Bewegungsfreiheit und das Recht auf Nationalität (Artikel 20 & 21 CRPD). Letzteres ist in Bezug auf Kinder doppelt formuliert: das Recht bei Geburt registriert zu werden (Artikel 7 CRPD). Das Recht auf Privat- und Familienleben umfasst vor allem das Recht von Eltern für ihr behindertes Kind zu sorgen bzw. das Recht von Eltern, die eine Behinderung haben, für ihre Kinder zu sorgen. Im Kontext des Rechts auf Privatleben bzw. Privatsphäre ist vor allem die Wichtigkeit des Datenschutzes, v.a. für medizinische Informationen, zu betonen (Artikel 22 & 23 CRPD). 3.7 Wirtschaftliche & soziale Rechte Hierunter fallen eine ganze Reihe von Menschenrechten: Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit und adäquater sozialer Schutz sind die vier Grundpfeiler, die gewährleisten sollen, dass Menschen mit Behinderungen in der gesellschaftspolitischen Mitte inkludiert ihr Potenzial ausschöpfen können. Die Konvention verankert das Konzept inklusiver Bildung als Menschenrecht: In keiner Bildungsstufe dürfen Menschen mit Behinderungen von Bildungseinrichtungen auf Grund einer Behinderung ausgeschlossen werden (Artikel 24 CRPD). In Ergänzung zu den bereits erwähnten Unterstützungsmaßnahmen, betont diese Bestimmung die Notwendigkeit angemessener Vorkehrungen (Artikel 24 Abs. 2 c CRPD) sowie die Sicherstellung von notwendigen Unterstützungsmaßnahmen für das Individuum (Artikel 24 Abs. 2 d CRPD). Die Bestimmung ist eingebettet in die menschenrechtliche Historie: Die Verankerung des Rechts auf Bildung im Pakt für wirtschaftliche, soziale & kulturelle Rechte (Artikel 13 CESCR) hat bereits die Forderung nach einem Bildungssystem auf Basis menschenrechtlicher Prinzipien – und damit anti-diskriminierend – nach sich gezogen (Komitee Nr. 13). Inklusive Bildung zieht folgerichtig inklusive Arbeit nach sich: Die Konvention verankert das Recht, chancengleich und mit Unterstützung einer adäquat bezahlten Arbeit nachzugehen. Die Segregierung – wie z.B. durch Werkstätten und ähnliche Einrichtungen – steht im Widerspruch zum Inklusionsprinzip. Auch im Bereich Gesundheitsversorgung legt die Konvention menschenrechtliche Prinzipien fest, um der strukturellen Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen – Stichwort: asexuelle Personen – entgegenzuwirken. Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 Menschenrechte für alle 21 3.8 Durchführungsbestimmungen Menschenrechtliches Neuland wird mit zwei Durchführungsbestimmungen betreten: Es sollen Daten und Statistiken erhoben werden, die Menschen mit Behinderungen und ihre Bedürfnisse konkret(er) erfassen (Artikel 31 CRPD). In einer eigenen Bestimmung zur Entwicklungszusammenarbeit wird bestimmt, dass Menschen mit Behinderungen in sämtliche Phasen derselben inkludiert werden (Artikel 32 CRPD). 4. Einhaltung Die Konvention setzt auf mehreren Ebenen Hebel ein, um die Durchsetzung von Rechten und Ahndung von Verletzungen zu ermöglichen: International wird – wie auch im Fall vorhergehender Menschenrechtskonventionen in den Bereichen Frauen, Kinder, Folter, politische & wirtschaftliche Rechte – ein ExpertInnen-Gremium eingerichtet, das regelmäßig Stellungnahmen der Vertragsstaaten kritisch evaluiert. Die erste Stellungnahme muss innerhalb zwei Jahren nach Inkrafttreten abgegeben werden. Die Zivilgesellschaft hat die Möglichkeit, ihre Sicht der Situation in einem eigenen Bericht darzulegen (Artikel 34 ff CRPD). Das ExpertInnen-Gremium kann auch die Beschwerden von Individuen, die behaupten, dass ihre Konventionsrechte verletzt wurden, behandeln. Voraussetzung ist, erstens, dass das Fakultativprotokoll – auch Zusatzprotokoll genannt – der Konvention ratifiziert wurde. In einem separaten internationalen Vertrag können Mitgliedsstaaten zustimmen, dass ein internationales Beschwerdeverfahren offen steht. Die zweite Voraussetzung ist, dass die nationalen Beschwerdemöglichkeiten – Gerichtsverfahren, Schlichtungsverfahren und dergleichen – erschöpfend in Anspruch genommen worden sind. Auf nationaler Ebene sieht die Konvention gleich vier Mechanismen zur Durchsetzung bzw. Überwachung der Konvention vor: Zum einen muss zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch sichergestellt werden, dass alle Einrichtungen und Programme, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, wirksam von unabhängigen Behörden überwacht werden (Artikel 16 Abs. 3 CRPD). Zweitens soll zumindest eine Stabstelle zur Durchführung des Übereinkommens eingerichtet werden; idealerweise sollte auf Bundesebene in jedem Ministerium eine solche Stelle eingerichtet werden. Um die Koordination zwischen den einzelnen Stellen und anderen Implementierungsbemühungen zu gewährleisten, soll darüber hinaus drittens ein Koordinierungsmechanismus eingerichtet werden (Artikel 33 Abs. 1 CRPD). Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 22 Marianne Schulze Als viertes Gremium sieht die Konvention eine Innovation vor: die Verpflichtung, die Einhaltung der vorgesehenen Rechte und Pflichten auch auf nationaler Ebene durch eine unabhängige Stelle überprüfen zu lassen. Konkret heißt es in der Konvention unter Artikel 33 Absatz 2: „Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen nach Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungssystems auf einzelstaatlicher Ebene für die Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durchführung dieses Übereinkommens eine Struktur, die, je nachdem, was angebracht ist, einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschließt. Bei der Bestimmung oder Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte.” Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen wird in diesem Kontext eigens betont: „… die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und nimmt in vollem Umfang daran teil …“ (Artikel 33 Abs. 3 CRPD). Grundlage für die Einrichtung einer solchen nationalen unabhängigen Stelle sind laut Konvention die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte (Artikel 33 Abs. 2 CRPD). Die Richtlinien für nationale Institutionen zur Förderung und zum Schutz von Menschenrechten wurden nach Ende des Kalten Krieges 1992 beschlossen, um Menschenrechte weg vom diplomatischem Geplänkel auf internationaler Ebene in der konkreten Umsetzung auf nationaler Ebene zu fördern (Pariser Prinzipien). Sie sehen vor, dass alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen Gremien bzw. Stellen schaffen, die politisch, finanziell und faktisch unabhängig sind. Der Begriff „Monitoring“, der im Englischen für „überwachen“ verwendet wird, ist durchaus weit zu verstehen. Demnach umfasst „Monitoring“ sowohl die Involvierung in Gesetzgebungsprozesse als auch die Erstellung von regelmäßigen Berichten zur Achtung der Menschenrechte in einem Land, die Möglichkeit, ex-officio – also von Amts wegen – aktiv zu werden, ist genauso vorgesehen, wie das Recht, die Beschwerden von Individuen und Gruppen zu bearbeiten (vgl. Aichele 2010). 5 Monitoringausschuss In Deutschland wurde bei der nationalen Menschenrechtsinstitution, dem Deutschen Institut für Menschenrechte, eine Monitoringstelle eingerichtet, Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 Menschenrechte für alle 23 der die Aufgaben im Sinne des Artikel 33 (2) CRPD – Überwachung der Einhaltung der Konvention – übertragen wurden.2 Österreich hat keine nationale Menschenrechtsinstitution, sondern eine Vielzahl an Einrichtungen, die teilweise die Erfordernisse der Pariser Prinzipien erfüllen. So zum Beispiel: Volksanwaltschaft, Menschenrechtsbeirat, Gleichbehandlungskommission, Gleichbehandlungsanwaltschaft, Datenschutzkommission, Rechtsschutzbeauftragte, Kinder- und Jugendanwaltschaften, Justizombudsstellen und Patientenanwaltschaften. In Ermangelung einer Institution, an die die Überwachungsaufgaben übertragen werden könnten, hat Österreich einen Monitoringausschuss3 eingerichtet. Dieser ist ein Beratungsgremium für den bereits bestehenden Bundesbehindertenbeirat im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Gemäß § 13 Bundesbehindertengesetz hat der Monitoringausschuss sämtliche Kontrollaufgaben nach Artikel 33 (2) zu erfüllen. Seine sieben Mitglieder und Ersatzmitglieder werden von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) vorgeschlagen, vier sind direkt von der ÖAR nominiert, einen Vertreter oder eine Vertreterin aus der Entwicklungszusammenarbeit, einen Vertreter oder eine Vertreterin aus der Wissenschaft und einen Vertreter oder eine Vertreterin einer Menschenrechtsorganisation komplettieren das Gremium. Alle Mitglieder sind per Gesetz in ihrer Funktion unabhängig und weisungsfrei. Es ist ein Ehrenamt, für das keine Aufwandsentschädigung vorgesehen ist. Der Ausschuss ist ausschließlich für Bundesangelegenheiten zuständig. Die Aufteilung anhand der föderalistischen Struktur macht die Einrichtung von korrespondierenden Gremien laut § 13 Abs. 8 Bundesbehindertengesetz in den Bundesländern erforderlich. Die Konstituierung des Ausschusses erfolgte am 60. Jahrestag des Beschlusses der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, am 10.12.2008. In seinen ersten Sitzungen hat sich der Monitoringausschuss vor allem mit der Erstellung seiner Geschäftsordnung beschäftigt. Neben der Erfüllung, der in § 13 Bundesbehindertengesetz – mit dem der Monitoringausschuss juristisch „geschaffen“ wurde – normierten Aufgaben, setzten sich die Mitglieder vor allem mit den internationalen Standards für unabhängige nationale Menschenrechtsinstitutionen auseinander. Die Geschäftsordnung sieht unter anderem vor, dass der Ausschuss Beschwerden zu Verletzungen der Konvention bearbeiten, Stellungnahmen zu Gesetzen – und Gesetzesentwürfen – abgeben sowie zur grundsätzlichen Einhaltung der Konvention durch den Bund Stellung nehmen kann. Eines von vielen Anliegen der Geschäftsordnung ist es, eine gewisse Vorbildfunktion in 2 Monitoringstelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Im Internet: http://www.institutfuer- menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html 3 Siehe auch: http//www.monitoringausschuss.at Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 24 Marianne Schulze Sachen „gelebte Barrierefreiheit“ zu übernehmen und so manches Thema – so auch Kosten für Persönliche Assistenz im Rahmen der Sitzungen – explizit zu erwähnen. Selbstredend ist der Ausschuss menschenrechtlichen Prinzipien verpflichtet, so auch der Partizipation und der damit verbundenen Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, wie auch der Transparenz und Nachvollziehbarkeit seiner Arbeit. Aus diesem Grund sieht die Geschäftsordnung die regelmäßige Abhaltung von öffentlichen Sitzungen vor. Wiewohl den Prinzipien für unabhängige Menschenrechtsinstitutionen verpflichtet, kann nicht behauptet werden, dass der Monitoringausschuss diesen vollends Genüge tut. Zum einen ist die Einrichtung in einem Ministerium mit dem Kriterium der umfassenden Unabhängigkeit in letzter Konsequenz nicht in Einklang zu bringen, zum anderen mangelt es dem Ausschuss an einem eigenen, selbst verwalteten Budget. Um dem Ziel der Konvention, die volle und effektive Teilhabe bzw. Partizipation von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu gewährleisten, gerecht zu werden, muss auch die Überwachung in der (gesellschafts-)politischen Mitte vorgesehen sein. Die Positionierung in einem Fachministerium widerspricht diesem Anspruch, die Etablierung einer nationalen Menschenrechtsinstitution muss daher auch unter diesem Gesichtspunkt ein Anliegen sein. Der Ausschuss wurde unmittelbar nach seiner Konstituierung bereits mit den ersten Einzelfällen befasst. Er versucht zum einen nach einer Lösung für die Einzelfälle zu suchen, zum anderen nach den Ursachen für die aufgeworfenen Probleme. Der Ausschuss hat bereits mehrfach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die involvierten Stellen zu einem Gespräch einzuladen, um Widersprüche zur Konvention zu analysieren und konstruktive Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Im Zentrum steht der in der Konvention verankerte Paradigmenwechsel: Die Verlagerung vom Fokus auf medizinische Faktoren einer Beeinträchtigung, hin zu den sozialen Faktoren, die eine Behinderung begleiten und dadurch teilweise bedingen. Der Anspruch der Konvention, dass jeder Mensch selbstbestimmt leben können muss, führt den Ausschuss ohne große Umschweife zu den zentralen Fragen: Persönliche Assistenz, Unterstützungsnetzwerke, Recht auf Arbeit, die gleichberechtigt entlohnt ist, und inklusive Bildung. Rechtsquellen CCPR – Covenant on Civil and Political Rights, Pakt für bürgerliche und politische Rechte, BGBl. 591/1978. CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Konvention zur Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau, BGBl. 443/1982. CERD – Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Übereinkommen über die Beseitigung aller Former rassistischer Diskriminierung, BGBl. 377/1972. Flieger / Schönwiese, Menschrenrechte - Integration - Inklusion ISBN 978-3-7815-1793-6 VERLAG JULIUS KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2011 |
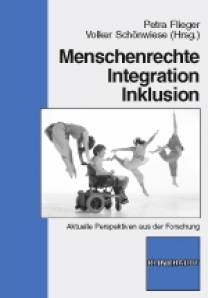
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen