|
|
|
Umschlagtext
Popkultur und Wissenschaft haben eines gemeinsam: Sie sind auf Dauer gestellte Zitationsmaschinen, die durch ständiges Referieren und Recyclen funktionieren. Dabei dient die Wiederverwertung und Entwicklung oftmals verschütteter Ideen anderer im Eigenen den Aktanten der Popkultur, um Aufmerksamkeit zu erregen; in der Wissenschaft hingegen wählt man sich als Aktant in die Netzwerke bisheriger Ansätze ein, um Erkenntnisse zu gewinnen.
Der Band beschäftigt sich in einem ersten Teil mit grundlegenden transdisziplinären Überlegungen zu den reflexiven Zusammenhängen von Kultur(en) und Theorie(n). Die Fallstudien des zweiten Teils gehen auf konkrete Phänomene von Kulturbeobachtung wie Medienereignisse, Werbung, Mode, Musik und Theater ein. Mit Beiträgen von Jochen Bonz, Mercedes Bunz, Andreas Hepp, Silke Hohmann, Theo Hug, Christoph Jacke, Sebastian Jünger, Katrin Keller, Eva Kimminich, Joachim Knape, Birgit Richard, Siegfried J. Schmidt, Richard Shusterman, Mark Terkessidis, Angela Tillmann, Jörg van der Horst, Ralf Vollbrecht, Martin Zierold und Guido Zurstiege. Rezension
"Sampling" - so nett man in der Popmusik eine der bevorzugten Kulturtechniken in der Postmoderne, man könnte genauso gut von Recycling sprechen oder von Wiederverwertung ... Die Postmoderne enthält als ein wesentliches Erkennungsmerkmal die Zitationskultur, das Kultur-Recycling. Dieses Recycling von Theorien und Kulturen fasst dieser interessante und aktuelle Sammelband unter der Metapher "Kulturschutt" zusammen. Die Grundthese lautet: Popkultur und Wissenschaft haben gemein, dass sie auf Dauer gestellte Zitationsmaschinen sind, die durch ständiges Referieren und Recyclen funktionieren. Es geht beiden um die Wiederverwertung und Entwicklung oftmals verschütteter Ideen. In der Popkultur allerdings werden die Kulturgüter demokratisiert und pluralisiert; sie stehen nicht mehr nur einer Elite als Zitationspotential zur Verfügung. Der Band dokumentiert eine Arbeitstagung "Kulturschutt, Pragmatismus und Recycling" an der Universität Münster im Dezenber 2003.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Christoph Jacke (Dr. phil., M.A.) wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator im Studiengang "Angewandte Kulturwissenschaften/ Kultur, Kommunikation und Management" der Universität Münster, Lehrbeauftragter im Studiengang "Populäre Musik und Medien" der Universität Paderborn, diverse weitere Lehraufträge, freier Autor für u.a. Frankfurter Rundschau, DEBUG, Testcard und Telepolis. Eva Kimminich (Prof. Dr. habil.) Romanistin, Kulturwissenschaftlerin und Beirätin für Jugend- und Subkulturen der Deutschen Gesellschaft für Semiotik; lehrt seit 1993 als Gastprofessorin an verschiedenen deutschen Universitäten. Siegfried J. Schmidt (Univ. Prof. em. Dr. Dr. h.c.) war bis 2006 Professor für Kommunikationstheorie und Medienkultur am Institut für Kommunikationswissenschaft und im Studiengang "Angewandte Kulturwissenschaften/Kultur, Kommunikation und Management" an der Universität Münster. Im Mittelpunkt dieses brandaktuellen Bandes steht das Thema Müll, allerdings im "kulturellen" Sinn mit brisanten Fragen wie "Was heißt recylen zum Beispiel in der heutigen Popkultur?" oder "Wie gehen wir heute mit "Abfällen" unseres kulturellen Erbes um?" Möglich wird eine derart ungewöhnliche Betrachtung durch das Wirklichkeitsmodell des Kulturwissenschaftlers Siegfried J. Schmidt. Er definiert Wirklichkeit als das "aus Handeln hervorgegangene und durch Handlungserfahrungen systematisierte und bestätigte, kollektive Wissen der Mitglieder einer Gesellschaft über "ihre" Welt". Kultur steht mit dieser Wirklichkeit in einer stetigen Wechselbeziehung: Sie nimmt darauf bezug und wirkt darauf ein. Wird nun kreativ mit der (vergangenen) Wirklichkeit umgegangen, entsteht eine Form des kulturellen "Recycling". Auf der Basis dieses Modelles loten die sieben Autoren und Autorinnen im theoretischen Teil verschiedene Bestandteile der Wirklichkeit aus: Eva Kimminich beispielsweise zeichnet die Geschichte der Jugend als eine Konstruktion im Spannungsfeld von Konzepten und Kulturprogrammen nach und zeigt wie symbolische Konfigurationen wie etwa die "Heilige Familie", oder der "Barbar" in Wirklichkeitsmodellen operieren. Anschaulich macht die Autorin das Umgehen mit Kulturschutt bei Jugendlichen an der Gothic-, Rasta- oder Rap-Bewegung. Richard Shustermann erörtert das Spannungsverhältnis zwischen Kunst (heilig/wahrhaft/zeit-und zwecklos) und Unterhaltung (funktional/lebenserhaltend). Dieses überträgt Christian Jacke auf die Frage, was heute vor allem in der etablierten Wissenschaft noch an Vorbehalten der Popmusik gegenüber vorhanden ist. Er weist auf die enormen kulturwissenschaftlichen Erkenntnisse hin, die durch transdisziplinäre Popmusikforschung als "Trendbarometer" in einer schnelllebigen Wirklichkeit gewonnen werden können. Im zweiten Teil finden sich Fallstudien zum sich verändernden Umgang der Jugendlichen mit Medien im Zeitalter der Globalisierung. Theo Hug, Angela Thilmann und Ralf Vollbrecht zeigen - auch an konreten Beispielen - wie sog. "virtuelle Gemeinschaften" eher spielerisch auf die Welt als "Clip" zugehen und dabei interessante neue "bricolierenden Wissenformen" oder Formen der Identitätsfindung durch eigene Homepages entwickeln. Die Gefahren der Absorption junger Individuen durch die Medien anhand der künstlich erzeugten "possible worlds" in aktuellen Videoclips zeigt Joachim Knape auf. Birgit Richard erörtert das "magische Kulturrecycling" der Gothic-Bewegung, während Silke Hohmann die Rolle der Mode als Spiegel der Wirklichkeit analysiert. Martin Zierhold stellt die Frage, ob es heute überhaupt noch ein Gefühl für die Vergangenheit gibt, oder unser inneres Gedächtnis bereits durch virtuelle Stellvertreter ausgelöscht wurde.Besonders überzeugt der anspruchsvolle Band durch seine Aktualität und die sorgfältig aufeinander abgestimmten Theorie- und Praxisteile. Die zukünftige kulturwissenschaftliche Forschung erhält wertvolle Impulse, auf Themen wie Globalisierung, Medienexpansion und daraus entstehende Kulturproduktion neu zu reagieren und bestehende transdisziplinäre Zugänge weiterzuentwickeln. Dr. Mathias Schillmöller, Freiburg i. Br. Inhaltsverzeichnis
Christoph Jacke/Eva Kimminich/Siegfried J. Schmidt:
Vorwort: Kulturschutt Über das Recycling von Theorien und Kulturen (9) Teil 1: Grundlagen Siegfried J. Schmidt: Eine Kultur der Kulturen (21) Eva Kimminich: Kultur(Schutt)Recycling: Von Kids und Barbaren, Jesuslatschen und Dreadlocks. Jugend im Spannungsfeld von Konzepten und Kulturprogrammen (34) Richard Shusterman: Unterhaltung: Eine Frage für die Ästhetik (70) Sebastian Jünger: Kulturtheorie und Müllmetapher. Essay zur Kritik der Simulation (97) Christoph Jacke: Popmusik als Seismograph. Über den Nutzen wissenschaftlicher Beobachtung von Pop (114) Andreas Hepp: Deterritoriale Vergemeinschaftungsnetzwerke: Jugendkulturforschung und Globalisierung der Medienkommunikation 124 Mark Terkessidis: Distanzierte Forscher und selbstreflexive Gegenstände. Zur Kritik der Cultural Studies in Deutschland (148) Teil 2: Case Studies Theo Hug: Globale Medienereignisse in der Wahrnehmung Jugendlicher heute (165) Angela Tillmann/Ralf Vollbrecht: Ich-Findung, Selbsterprobung und jugendkulturelle Praktiken in einer virtuellen Gemeinschaft (188) Joachim Knape: Virtualität und VIVA-Video World (207) Christoph Jacke/Guido Zurstiege: Schöner Schrott: Werbe-Rauschen im Kultur-Programm. Werbung und/als Popkultur (223) Birgit Richard: Schwarzes Glück und dunkle Welle. Gotische Kultursedimente im jugendkulturellen Stil und magisches Symbolrecycling im Netz (235) Silke Hohmann: Wenn die lauten Signale unhörbar werden, ist es Zeit für ein feines, leises Lied: Mode als Kommunikationsmittel in der Ära der Gleichzeitigkeit (257) Mercedes Bunz: Instabil. Musik und Digitalität als Momente der Verschiebung (271) Jörg van der Horst: Theaterdeponien. Eine Polemik! (282) Martin Zierold: Das Gedächtnis auf dem Müll – oder: Was muss hier eigentlich entsorgt werden? (307) Katrin Keller: Wiederverwertungen. Retro und die Reflexivität des Reloads (320) Jochen Bonz: Sampling: Eine postmoderne Kulturtechnik (333) AutorInnen (354) Leseprobe: VORWORT: KULTURSCHUTT. ÜBER DAS RECYCLING VON THEORIEN UND KULTUREN CHRISTOPH JACKE/EVA KIMMINICH/SIEGFRIED J. SCHMIDT „Es wäre an der Zeit für die Abenteuer neugieriger und strenger Archäologen, die den verloren gegangenen Codex zu entziffern wünschen. [...] Alles Neue nur neu aufbereitet, als sei das Siegel der Epoche die Recycling-Anlage.“ (Strauß 1999: 85-86) „Wir waren keine Stars, wir waren gute Freunde mit neuen Ideen füreinander. Wir äfften die hässliche Welt nach, wir waren Müllsammler und recycelten die Splitter ihrer geborstenen Oberfläche.“ (Schamoni 2004: 182) „Musik aus den Knochen anderer Leute.“ (Walter 2006: 16) Während der Schriftsteller Botho Strauß in Die Fehler des Kopisten nicht ganz zu Unrecht das Theater (t)adelt als „Esel unter den künstlerischen Transportunternehmen“ (Strauß 1999: 85) und zuvor Kino und Musikfernsehen des Hinabverzeitigens bezichtigt hat, beschreibt der Musiker und Neu-Literat Rocko Schamoni in Dorfpunks das Spektakuläre des Alltäglichen jugendlicher Landbewohner. Aus diesen fiktiven Landbewohnern sind in Form der Diskurs-Punk-Band Die Goldenen Zitronen später ganz „reale“ Musiker und Künstler zwischen Punk Rock und Theaterfestival geworden. Die Hamburger Band wiederum wird im dritten einleitenden Zitat vom Radio-DJ Klaus Walter vom Hessischen Rundfunk, dem deutschen John Peel, in dessen Feuilleton-Artikel zu deren neuen Album Lenin (2006, Buback/Indigo) für ihre Aufarbeitung von Popgeschichte(n) in ihren neuen Songs gelobt. Wir haben es also mit drei eigentlich unvergleichbaren Zitaten dreier kaum vergleichbarer Autoren in drei unterschiedlichen Medienangeboten zu tun. Was aber allen drei Text-„Splittern“ – um einen Begriff Schamonis zu verwenden – ähnelt, ist die Auseinandersetzung mit dem Alten und Neuen in Kultur. Die Knochen, aus denen in Walters Beschreibung die Musik der Goldenen Zitronen besteht, werden von Schamoni als notwendig erachtet für die eigene Identitätsausbildung im Land jenseits jeglicher Möglichkeit zur Rezeption von Kultur. Strauß würde diese Knochen womöglich, als Schatz besserer Zeiten begraben, im niedrigen Reich der trivialen Kultur und dort auch gleich den verschütt gegangenen (Hochkultur-)Codex von seinen gestrengen Archäologen suchen und lesen lassen, sofern sie letzteres denn überhaupt noch beherrschen. „Auseinandersetzungen“ mit Kultur und deren Artefakten werden im Gegenüberstellen der Zitate verdeutlicht, die „Bewertungen“ von so etwas wie Kultur divergieren. Und indem wir hier diese Zitate einander aufreihen und sie kommentieren, graben wir den nächsten Haufen Schutt aus dem Lande der Kultur (hier Pop, Diskurs-Punk und Literatur) aus und amalgamieren die Stoffe zu etwas Neuem aus Altem. Von daher lässt sich konstatieren, dass Popkultur und Wissenschaft eines gemein haben: Sie sind auf Dauer gestellte Zitationsmaschinen, die durch ständiges Referieren und Recyclen funktionieren. Dabei dient die Wiederverwertung und Entwicklung oftmals verschütteter Ideen anderer im Eigenen den Aktanten der Popkultur, um Aufmerksamkeit zu erregen und Themen zu aggregieren; in der Wissenschaft hingegen wählt man sich als Aktant in die Netzwerke bisheriger Ansätze ein, um Erkenntnisse zu gewinnen, auch im Rahmen des Vorworts dieses Bands etwa. Ausgangspunkt unserer Diskussion über Kulturschutt und Recycling war die Beobachtung jugendspezifischer Nutzung von Zeichen und Zeichencodes, v.a. der Vorstadt- und HipHop-Kultur, deren kulturelle Praktiken sich vor dem Hintergrund kultureller und personaler Identitätsbildungsprozesse als ein „set“ von „tools“ erwiesen, mit denen v.a. durch „(hi)- story(re)telling“ auf verschiedene (kulturtragende) Diskurse und Diskursfiktionen einer oder mehrerer Gesellschaften eingewirkt werden kann (E. Kimminich). Dieser Befund sollte vor dem Hintergrund des von S.J. Schmidt entworfenen Konzepts von Kultur als Programm gesellschaftlich relevanter Bezugnahmen auf das Wirklichkeitsmodell einer Gesellschaft reflektiert werden. Dieses Kulturkonzept ermöglicht es, die einzelnen Vorgänge der Sinnorientierung und des (re-)kreativen Handelns der Gesellschaftsmitglieder im Sinne von (Teil-/Sub-)Kulturprogrammanwendungen in ihren Bezügen zu betrachten. Wenn wir dieses Konzept mit Analysen einzelner bildspendender Symbolkonfigurationen veranschaulichen, dann wird sichtbar, wie mit ihnen einerseits bestimmte gesellschaftliche Wirklichkeiten „festgesetzt“ und „eingefroren“ sowie Emotionen im Sinne von Lebensenergien „gebunden“ werden können. Indem Symbolkonfigurationen das Wirklichkeitsmodell und die Struktur einer Gesellschaft, ihre Identitätsmodule und Handlungsorientierungen über Jahrhunderte hinweg entscheidend prägen, gewährleisten sie die Aufrechterhaltung ihrer (meist hierarchischen) Struktur. Voraussetzung dafür ist eine „korrekte“ und „sinngemäße“ Übernahme bzw. Anwendung, was durch Erziehung, Wissensvermittlung und eine gezielte Erinnerungspolitik gesichert werden kann. Andererseits kann beobachtet werden, welche Folgen Umschaltungen und Rekonfigurationen solch programmatischer Symbolkombinationen durch etwa Subkulturen auf das Gesamtsystem haben können (Chr. Jacke). Vollzieht sich ersteres durch ein anverwandelndes Wiederbenutzen („re-use“) der althergebrachten (vererbten) Symbolkonfigurationen, durch die die Mitglieder einer Gesellschaft sinnorientiert und funktionell geschaltet werden, so wird letzteres durch ihre Differenz setzenden Um- oder Neucodierungen bzw. Umstrukturierungen und Rekontextualisierungen möglich („recycling“), die offene Lernprozesse in Gang setzen. Zugang zu den zentralen Symbolkonfigurationen und ihren Schaltungen hatten über Jahrhunderte hinweg zunächst fast nur Eliten und Erwachsene, sie waren (und sind) um Erhalt ihres (ihre Vormachtstellung sichernden) Wirklichkeitsmodells bemüht, das durch einen Schutzwall an „Kulturschutt“ in Krisenzeiten und Zweifelsfällen immer wieder aktualisiert werden kann. Die durch Beobachtung diagnostizierten nicht (mehr) funktionierenden (Werte oder Normen) tragenden Elemente können durch Rückgriff auf die dort gelagerten anderen „eigenen“ oder durch Einpassung fremder Elemente kontextbezogen also systemkonform und -stützend ersetzt werden, so dass die bildgebende Schauseite des Kulturprogramms erhalten bleibt – Botho Strauß würde seine Archäologen genau hier „abenteuern“ lassen. Außerhalb dieses Schuttwalls lagern all jene Elemente oder auch Modelle, die im Rahmen des hegemonialen Kulturprogramms als abwegig und verbraucht, also als „Müll“ verworfen wurden, hier wildern sowohl Rocko Schamonis Protagonist als auch Die Goldenen Zitronen; nicht ohne aus dem Müll schuttverdächtige neue Angebote zu kreieren. Der Sänger der Goldenen Zitronen, Schorsch Kamerun, ist mittlerweile als Regisseur und Gast an der Berliner Volksbühne oder bei der RuhrTriennale gern gesehen. Bedingung für eine „freie“ Nutzung durch nicht elitäre populäre und jugendliche Gruppen waren Demokratisierungs- und Pluralisierungsprozesse, die der Beobachtung einen (selbst-)reflexiven Stellenwert verliehen und sie zum Motor eines sich beschleunigenden Umdeutungsmechanismus werden ließen. In Verbindung mit neu entstehenden und vor allem weiter verbreiteten, immer kostengünstigeren Medientechnologien eröffneten sich dadurch ungeahnte Möglichkeiten, die ihrerseits die Vermarktungsstrategien der (Pop-)Kulturindustrie erweiterten. Dadurch konnte einerseits sowohl „Kulturschutt“ als auch der im Rahmen subkultureller Bewegungen provokativ wieder geholte „Kulturmüll“ als entkontextualisiertes und entwertetes Rohmaterial für (re-)kreatives und interaktives Handeln genutzt werden, was ein Überdenken einer als stabil und linear definierten Identität auslöste, aber auch ein Überdenken des kreativen Handelns und der Konzepte Original und Kopie erfordert. Andererseits setzte die Vermarktung einen Ausverkauf der programmatischen Elemente von Kultur in Gang, der durch ihre Entkontextualisierung die an oder durch sie gebundenen Energien freisetzt. In unserer globalisierten Mediengesellschaft hat sich dieses „(Re-) Kombinationsspiel“ auf verschiedenste „Kulturschutt- bzw. Kulturmülldeponien“ ausgedehnt und um ein Vielfaches beschleunigt. Damit sind nicht nur die Bestandteile (Artefakte, Mentefakte und Kinefakte) verschiedenster Kultur(teil)programme zugänglich geworden, sondern auch ihre Schaltkreise. Es ist daher höchste Zeit unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf subjektive wie gruppenspezifische Prozesse inter- sowie intra-kultureller Symbolnutzung und Zeichensetzung zu lenken, denn sie sind nicht nur Seismographen, die Erschütterungen im (hegemonialen) Kulturprogramm bzw. dem von ihm gestützten Wirklichkeitsmodell einer Gesellschaft anzeigen. Sie weisen vielmehr Wege alternativer Wirklichkeitsgestaltungen, die auf (nicht institutionell gelenkten) Lernprozessen beruhen und im Rahmen hegemonial determinierter Symbolkonfigurationen bzw. ihrer (wissenschaftlichen) Modellierung definitorisch ausgeschlossen bzw. als unmöglich (häretisch, utopisch, revolutionär, unkonventionell, unrealistisch, irrational etc.) ausgeblendet wurden und werden. Das wird sichtbar, wenn sich die medienkulturwissenschaftliche Beschreibung und Analyse gesellschaftlicher und kultureller Phänomene nicht mehr auf Simulation stützen, sondern sich auf die Unwägbarkeiten der Metapher einlässt. Sie bricht die dichotome Struktur Differenz anzeigender Pole auf, die im Rahmen der meisten nach wie vor Werte setzenden Beschreibungsmodelle dominiert, in dem sie das Resultat ihrer Kombination und gegenseitigen Kompensation imaginiert. Auf diese Weise können unbe- (ob)achtete Möglichkeiten ins Blickfeld der Aufmerksamkeit rücken. Die Analyse und Beschreibung einzelner (jugend-)szenespezifischer Symbolnutzungen und Zeichensetzungen als dynamische Aktionsfelder fluktuierender Zeichenpraktiken, durch deren (inter-)aktive Bedeutungssetzungen pragmatische, sich am leiblichen Erleben bemessende „Um-“ setzungen emergieren, stehen daher ebenso im Mittelpunkt der hier versammelten Beiträge wie die dabei freigesetzten Wechselwirkungen mit den im Gesamtmediensystem kursierenden, durch verschiedene Kulturprogramme erzeugten, untereinander konkurrierenden Codes verschiedener Vorstellungswelten oder Wirklichkeitskonstruktionen bzw. der Modelle ihrer wissenschaftlichen Beschreibung. Der Band beschäftigt sich daher in einer ersten Sektion („Grundlagen“) mit grundlegenden transdisziplinären Überlegungen zu den reflexiven Zusammenhängen von Kultur(en) und Theorie(n) aus unterschiedlichen kulturtheoretischen Voraussetzungen heraus, die gemein haben, den Blick für Kultur als Theorie zu schärfen und zu ent-elitisieren (D. Kellner). Zunehmend wird in letzter Zeit in verschiedenen Wissenschaften und Poptheorien zwischen Medien und Kultur über das Attraktive im Verborgenen/Abgelegten geforscht. Die Rede ist vom „Schutt der Kulturindustrie“ (Prokop 2003: 269), vom „echten Scheiß“ (vgl. Engell 2000: 11), vom „Mülleimer der Geschichte“ (Marcus 1996: 25), von einer Theorie des Abfalls bzw. einer Mülltheorie (vgl. Thompson 1981, 2003). Oder es wird geschrieben, dass die Tatsache zu den auffälligsten Merkmalen unserer Kultur zähle, „dass es so viel Bullshit gibt“ (Frankfurt 2006: 9). Das Abseitige, das Entwertete, das Unechte scheint Konjunktur zu haben, wenn hier auch ganz unterschiedliche Begriffe für ähnliche Phänomene verwendet werden. Als Fundament kulturtheoretischer Analysen bietet sich daher ein weiter, entdramatisierter Kulturbegriff an, der möglichst entnormativiert und analytisch scharf an dieses problematische Forschungsfeld heran tritt. Dabei wird Kultur als Programm in Form einer Interpretationsfolie von Wirklichkeitsmodellen verstanden sowie als statisch (lernunwillig im Moment der Anwendung) und flexibel (lernfähig im Moment der reflexiven Beobachtung) gleichzeitig gefasst (S.J. Schmidt). Die Veränderungen des Kulturprogramms erfolgen durch Modifikationen speziell in den Anwendungen der Aktanten von Jugendund Popkulturen, in deren kulturellen Praktiken also, vor allem in Form von Umdeutungen vorgegebener Symboliken (E. Kimminich). Die Veränderungen der kulturprogrammlichen Rahmungen finden besonders intensiv und alltäglich in den Bereichen der populären Kunst statt (R. Shusterman), deren Verständnis „en passant“ die theoretische Dichotomie zwischen Kunst und Massenkultur aushebelt und den Weg für ganz neue Aus- und Entdifferenzierungen weist. Im Zeitalter der Digitalisierung erscheinen sowohl (Kultur-)Theorien als auch (Müll-)Metaphern als auch deren analoge Verschriftlichung in Buchform oftmals anachronistisch und inkompatibel mit neuen Medientechnologien. Wer kann schon einen hier angegeben Link direkt anklicken? Andere Formen von Medienangeboten und Kritik jenseits purem Pessimismus und Euphorismus müssen entwickelt werden, die quasi eingebaut haben, dass auch sie wieder aus Beschreibungskulturen heraus Kulturbeschreibungen leisten (S. Jünger). Zudem ermöglicht ein weiter, wenig normativer Kulturbegriff, Popkultur nicht nur potenziell als „Befreiungsdiskurs“ (Braun 2004: 278) zu verstehen, bei dem allerdings schnell jede noch so kleine kulturelle Praktik als Subversion gefeiert wird. Ebenso reicht Kultur als Programm über Kultur als einen unveränderbaren, aufoktroyierten Rahmen hinaus, der keine Freiheit ermöglicht und unumstößlich erscheint. Auf dieser Grundlage lässt sich eine Popkulturwissenschaft einfordern, die den stetigen notwendigen mediengesellschaftlichen Wandel und dessen indikatorische Vorauswirkung auf Popkulturen als Seismographen auffasst und gewisse Sensibilitäten der Aktanten schlichtweg zu Kompetenzen erklärt (Chr. Jacke). Wenn diese popkulturellen Bewegungen nicht mehr zwingend an kulturelle Nationen gebunden sind, sondern immer mehr zu transnationalen, transkulturellen Phänomenen werden, erscheinen auch für die Pop- und Jugendkulturforschung eben neue, flexible Kulturkonzepte vonnöten (A. Hepp). Begibt man sich in diesem Zusammenhang auf eine metatheoretische Ebene der (Kultur-)Beobachtung von (Kultur-)Beobachtungen, begreift man, dass die aus den angloamerikanischen Cultural Studies kommenden Ansätze zur Popkultur transkulturalitätstauglich sind. Im deutschsprachigen Raum werden sie allerdings meist in entpolitisierter Form angewendet, so dass ihr Potenzial vor allem seitens der Kommunikations- und Medienkulturwissenschaft noch nicht optimal genutzt wird (M. Terkessidis). Nach diesen grundlegenden Ausführungen zur Kulturbeobachtung und Beobachtungskultur wird in der zweiten Sektion in (teilweise) empirischen Fallstudien („Case Studies“) auf konkrete Phänomene eingegangen. Erstaunliche Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede lassen sich etwa in der Wahrnehmung globaler Medienereignisse in der Wahrnehmung Jugendlicher feststellen (Th. Hug). Nicht nur in der Rezeption, sondern insbesondere in der Nutzung und Weiterverarbeitung von Medienangeboten zeigen junge Menschen eine besondere Lernfähigkeit. Am Beispiel einer Internetplattform (Homepage) für junge Mädchen lässt sich das Potenzial zur Selbsterprobung und Findung exemplarisch belegen und für weitere medienpädagogische Vorhaben fruchtbar machen (A. Tillmann/ R. Vollbrecht). Ganz entgegen der eingangs erwähnten Skepsis von Botho Strauß, nutzen Jugendliche Medienangebote wie etwa Musik- (video-)clips durchaus aktiv als Oberfläche zur bildlichen Konstruktion von Stars oder als Inszenierungsangebote möglicher Alternativwelten (J. Knape). Und sogar eines der hinsichtlich seiner Kommerzialität (Erzeugung von Kaufbereitschaft) absolut motivverdächtigen Medienangebote, die Fernseh-Werbe-Spots, werden außerordentlich professionell von den jugendlichen Zuschauern eingeschätzt und behandelt – wobei von den jungen Rezipienten das Schema meist als negativ belastet, der Einzelfall aber als absolut positiv eingeschätzt wird: Werbung ist doof, aber der neue Nike-Spot ist geil (Chr. Jacke/G. Zurstiege). Neben dem kreativen Umgang mit neuen Medienangeboten spielen modischer Stil und die bricolierte Wiederverwertung von Symbolen aus anderen Kontexten und Zeiten in einer bis heute erstaunlich klar definierbaren, in sich abgeschlossenen Jugendsubkultur eine große Rolle: den Gothic Punks, Schwarzen oder Waves (B. Richard). Eine andere Art der modischen Wiederverwertung bzw. Umverwertung nicht nur durch Jugendliche stellt der Kleidungs-Trend der „Camouflage-“Mode dar. Diese ursprüngliche Militärkleidung diffundiert als alltägliche Freizeitund Party-Mode mittlerweile bis in die großen Bekleidungsketten und steht schon seit geraumer Zeit entkontextualisiert symbolisch weder für Soldatentum noch für rechtsradikale Anspielungen an Wehrsportgruppen, sondern für Hipness und Sportlichkeit (S. Hohmann). Neben der Mode bleibt die Popmusik das prototypische Feld für symbolische Auseinandersetzungen und Veränderungen von Kulturprogrammen. Wie schon in den eben genannten Beispielen tritt vor allem im Bereich digitalisierter, elektronischer Popmusik die Entwicklung zutage, dass die (neue) Bearbeitung von Material wesentlich wichtiger als die Herstellung von etwas originär Neuem ist (M. Bunz), auch hier ließe sich wieder wunderbar an Botho Strauß’ Vorwurf gegenüber der Recycling-Anlage als Ersatz für das Neue anschließen: Die Recycling-Anlage ist gewissermaßen stellvertretend für eine durchformatierte Mode von großen Billigmodeketten. Die Idee, alte Moden wieder aufzuarbeiten und teilweise umzudeuten wie bei Camouflage, stammt oft eben gerade nicht aus den Planungsstäben dieser Modeketten, den Recycling-Anlagen, sondern geht von kreativen Ideen einzelner Aktanten aus. Bei der Behandlung von Wiederverwertungen geraten vermeintlich hochkulturelle Angebote oft aus dem Blick. Auf dem Gebiet der bereits erwähnten Cultural Studies etwa fällt auf, dass diese sich fast nie mit vermeintlich hochkulturellen Phänomenen beschäftigen. Da aber auch das Theater eine (be-)ständige Reproduktionsmaschine bildet und eher traditionell normbestätigend Kulturprogramme qua seiner Aktanten anwendet und modifiziert, wird hier für eine Pop-Version des mediatisierten Theaters plädoyiert (J. van der Horst). Und wo das Theater in seiner herkömmlichen Form schon auf die Deponie gebracht werden soll, scheint im Anschluss auch gleich ein ganzer Diskursstrang der endgültigen Entsorgung übergeben werden zu sollen, der zunächst thematisch nicht uninteressant für popkulturelle Theorien erscheint: der Gedächtnisdiskurs. Während dessen kulturwissenschaftliche Variante in großen Teilen wenig ergiebig für ein brachliegendes Feld der Erinnerungsanlässe und ihrer Verarbeitungen in Form der Referenzmaschine Popkultur erscheint, existiert ein kommunikationswissenschaftlicher Pfad überraschenderweise noch nicht einmal. Deshalb gilt es, einen eigenen Ansatz zu entwickeln, der auch Phänomene von Pop und Gedächtnis koorientierend erklären hilft (M. Zierold). Die Geschichten der Popkultur leben nicht nur von Erinnerungsanlässen, sie kommerzialisieren und vertrenden jeglichen Anflug von Wi(e)derverwertungen in Form von Retroisierungen (K. Keller). Die plausibelste aller Kulturtechniken des Verund Umwandelns bildet schließlich immer noch das Sampling, auf dessen Terrain fast alle popkulturellen „Theorie-Brandherde“ (Kopie und Original, Herstellung und Darstellung, Kritik und Affirmation etc.) beobachtet werden können. Die verschiedenen Arten von Zitieren und Sampling können sogar eine eigene Samplingforschung provozieren (J. Bonz). Wir lassen unsere Autoren disziplinlos aus diversen Disziplinen (Medienkulturwissenschaft, Romanistik, Philosophie, Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Medienpädagogik, Rhetorik, Kunstpädagogik, Kunsttheorie, Design, Ethnologie) im vorgemischten (Sander/Werner 2005) Schutt und Müll der Kulturen – mal grundlagentheoretisch, mal exemplarisch – wühlen, um zu zeigen, dass Beobachtungen von Kultur aus Kultur heraus zunächst möglichst entdramatisiert und weit gestreut geschehen sollten. Vorgemischt bedeutet, dass jeglicher Schutt und selbst Müll voraussetzungsvoll ist und in seinem Gebrauch dessen Bedingungen mitdefiniert: Man kann eben nur samplen, was der Sampler samplet. Dass ein solcher Zugang keineswegs eine Kritikkompetenz behindert, dürften die vorliegenden, teilweise deutlichen Kritiken an Theorien und Phänomenen belegen. Und auch wenn ein Sample die Welt nicht verändern wird, so beginnt in der minimalen Verschiebung der Referenz der Wandel: „In diesem Sinn kann, trotz der zahllosen falschen und unbeantworteten Fragen und trotz aller offengelassenen Konsequenzen, nur gefordert werden: Noch mehr Sampling, noch mehr Recycling!“ (Braun 2004: 283) Wir danken Christiane Jasper für die Organisation der Arbeitstagung „Kulturschutt, Pragmatismus und Recycling“, die im Dezember 2003 an der Universität Münster vom Studiengang Angewandte Kulturwissenschaften/ Kultur, Kommunikation & Management veranstaltet wurde und deren Vorträge Grundlage einiger der Beiträge bilden. Ferner gilt unser Dank Bärbel Andreae, Kathrin Karkmann, Torben Pinnow, Anneke Plaß, Friederike Schüttert, Martina Schwarz und Tobias Trost für ihre Unterstützung in Sachen Layout und Endkorrektur. LITERATUR Braun, Richard (2004): Re-Cycling, Re-Formating, Re-Morphing, Re- Sampling... In: Bidner, Stefan; Feuerstein, Thomas (Hg.): Sample Minds. Materialien zur Samplingkultur. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 276-283. Engell, Lorenz (2000): Über den Abfall. In: Bergermann, Ulrike; Winkler, Hartmut (Hg.): TV-Trash. The TV-Show I Love to Hate. Marburg: Schüren, 11-22. Frankfurt, Harry G. (2006): Bullshit. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Marcus, Greil (1996): Der Mülleimer der Geschichte. Über die Gegenwart der Vergangenheit – Eine Zeitreise mit Bob Dylan, Wim Wenders, Susan Sontag, John Wayne, Adolf Hitler, Elvis Presley, Bill Clinton, Miou- Miou, Umberto Eco u.a. Frankfurt/Main: Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins. Prokop, Dieter (2003): Mit Adorno gegen Adorno. Negative Dialektik der Kulturindustrie. Hamburg: VSA. Sander, Klaus; Werner, Jan St. (2005): Vorgemischte Welt. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Schamoni, Rocko (2004): Dorfpunks. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Strauß, Botho (1999): Die Fehler des Kopisten. München: dtv. Thompson, Michael (1981): Die Theorie des Abfalls. Über die Schaffung und Vernichtung von Werten. Stuttgart: Klett-Cotta. Thompson, Michael (2003): Mülltheorie. Über die Schaffung und Vernichtung von Werten. Essen: Klartext. Walter, Klaus (2006): Return to Bismark. Warum die Goldenen Zitronen auf ihrer neuen Platte ‚Lenin‘ besingen. In: Frankfurter Rundschau. Nr. 132 vom 09.06.2006, 16. Weitere Titel aus der Reihe Cultural Studies |
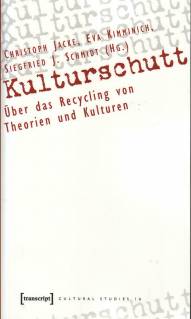
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen