|
|
|
Umschlagtext
Max Wehrlis 1980 erstmals erschienene Literaturgeschichte gilt heute allenthalben als "großer Wurf" und Standardwerk der Altgermanistik. Sie wird hier in einer bibliographisch aktualisierten Neuausgabe vorgelegt.
Rezension
Die ursprünglich als erster Band einer fünfbändigen deutschen Literaturgeschichte erschienene "Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter" von Max Wehrli ergänzt nun die "Kleine Geschichte der deutschen Literatur" von Kurt Rothmann, indem sie sich ganz der mittelhochdeutschen Literatur einschließlich der Umbruchzeit des 16. Jahrhunderts widmet. Dabei wird auch die lateinische Literatur des Mittelalters weitgehend berücksichtigt, da die deutsche Literatur an sie als der damaligen Weltsprache anknüpft.
Max Wehrlis altgermanistische Literaturgeschichte bietet einen sehr guten Überblick über die Vielfalt und Vielgestaltigkeit der deutschen Literatur des Mittelalters, indem er sie in größere Zeitabschnitte ('Epochen') wie Stauferzeit, Hoch- und Spätmittelalter einteilt und sich damit an der Geschichte des Mittelalters orientiert, aber sich trotzdem nicht sklavisch an diese Epochen hält; denn auch Übergangszeiten in der Literatur ("Wandlungen vom Hoch- zum Spätmittelalter") werden gesondert behandelt. Innerhalb dieser Kapitel wird die Literatur weitgehend nach Gattungen bzw. (wo eine solche Einteilung eigentlich nicht möglich ist) nach ihrer äußeren Form behandelt sowie nach einzelnen prägenden Autoren (bzw. Erzählern). Dies ist sicherlich eine sinnvollere und dem Gedächtnis förderlichere Einteilung als eine rein chronologische. Lediglich zu bedauern ist, dass nicht allen großen Kapiteln eine kurzer Umriss vorangeht wie den beiden "Wandlungen vom Hoch- zum Spätmittelalter" und "Sechzehntes Jahrhundert", denn das hätte dem Leser einen noch besseren Überblick verschafft. Ansonsten ist diese einbändige Literaturgeschichte Max Wehrlis uneingeschränkt zu empfehlen, bietet sie doch bestmögliche Information auf engstem Raum. Melanie Förg, Lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
VON DER VÖLKERWANDERUNG BIS ZUM ENDE DER OTTONEN
I. Altgermanische Formen im Deutschen 1. Zauberspruch und Segen 2. Das Heldenlied II. Althochdeutsche Übersetzungsliteratur 1. Deutsche Sprache in Kirche und Recht 2. Glossen und Interlinearübersetzung 3. Die großen Prosawerke III. Bibeldichtung, Heilsdichtung (1) 1. Schöpfung und Endzeit 2. der "Heliand" 3. Otfrieds "Evangelienbuch" 4. Kleinere Gedichte IV. Christliche Helden- und Heiligendichtung 1. Das "Ludwigslied" 2. "Georgslied" und "Galluslied" 3. "Waltharius" V. Notker der Deutsche SALISCHE UND FRÜHE STAUFISCHE ZEIT I. Die neue Frömmigkeit 1. Zwei Hohelied-Kommentare 2. Gebt und Predigt 3. Tierkunde, Weltkunde II. Bibeldichtung, Heilsdichtung (2) 1. Die Bibel 2. Der christliche Glaube 3. Bußdichtung 4. Mariendichtung III. Geschichtsdichtung und Legende 1. Die Geschichte als Erzählstoff 2. Das "Annolied" und die "Kaiserchronik". Legenden 3. "Alexanderlied" und "Roldandslied" IV. Neue weltliche Erzählformen im Lateinischen 1. Tierepik 2. der Erste Roman V. Vom Zeitlied zum historischen und legendarischen Roman 1. Heldenlied, Zeitlied, historisches Lied 2. "Herzog Ernst" und "König Rother" 3. Legendenromane 4. "Graf Rudolf" DIE RITTERLICH-HÖFISCHE DICHTUNG DER STAUFERZEIT I. Der antikisierende Roman 1. Mittelhochdeutsche Klassik 2. heinrich von Veldeke 3. Trojaroman. Metamorphosen II. Liebesroman und Liebesnovelle 1.Minne als Thema der erzählung 2. "Flore", "Tristrant", "Moritz von Craun" 3. Gottfried von Straßburg III. Der Artusroman und die ritterliche Legende 1. Die neue Gattung 2. Hartmann von Aue: "Büchlein", "Erec", "Iwein" 3. Hartmann von Aue: "Gregorius", "Armer Heinrich" 4. "Lanzelet", "Wigalois" IV. Der religiöse Roman: Wolfram von Eschenbach 1. Der Dichter 2. "Parzival" 3. "Titurel" 4. "WillehalmW V. Der Beginn einer weltlichen Lyrik 1. Vorritterliche Lyrik 2. Kürenberg. Vor- und Frühformen des Minnesangs 3. Lieder der Völker? Lateinische Lyrik? 4. Die öfische Minne: das romantische Vorbild VI. klassiker des Minnesangs 1. Der staufische Kreis 2. Veldeke und Fenis 3. hartmann von Aue, Albrecht von Johannsdorf, Reinmar 4. Heinrich von Morungen, Wolfram von Eschenbach VII. Walther von der Vogelweide 1. Die Person 2. Die Minnelieder 3. Spruchlieder 4. Reigiöse Lieder VIII. Das Heldenepos: "Nibelungenlied" und "Kudrun" 1. "Nibelungenlied" und "Klage" 2. "Kudrun" WANDLUNGEN VOM HOCH- ZUM SPÄTMITTELALTER I. Die Epoche II. Wandlungen des Minnesangs 1. Neidhart 2. Die spätstaufischen Dichter 3. Der "Frauendienst" Ulrichs von Lichtenstein 4. Schweizer Minnesänger: das Beispiel einer Landschaft 5. Fahrende und Meister (Spruchdichtung) III. Sittelehre: Didaktische Dichtung IV. Wandlungen der Großerzählung 1. Geschichts- und Geschichtenerzähler 2. Schicksale des höfischen Romans 3. Rudolf von Ems 4. Neuer Formwille der literarischen Hochgotik 5. Höfische Romane um 1300 V. Späte Heldendichtung 1. Die Texte 2. Entartung und Ursprünglichkeit VI. Märe und Bîspel 1. Märe 2. Ein Zyklus 3. Bîspel VII. Bibel- Legenden- und Geschichtsdichtung 1. Bibeldichtung und biblische Legende 2. Heiligenlegende 3. Reimchroniken, frühe Prosachroniken VIII. Vor- und Frühgeschichte des Dramas 1. Liturgie und lateinsiches Spiel 2. Anfänge des deutschen geistigen Spiels 3. Anfänge des weltlichen Spiels IX: Geistliche Prosa: Seelsorge, mystische Frömmigkeit, Spekulation 1. Predigt und Traktat im 13. Jahrhundert 2. Ältere Frauenmystik 3. Meister Eckhart 4. Tauler 5. Seuse 6. Schwesternleben SPÄTMITTELALTER I. Geistliche Literatur 1. Gottesfreunde 2. Niederländische und deutsche Nachfolge Christi 3. Geistliche lehr-und Erbauungsprosa 4. geistliche Übersetzungsprosa 5. Volkstümliche Devotionalpoesie II. Didaktik, Satire, Parodie 1. Reimrede 2. Minnereden 3. Große Minneallegorien 4. Ständedidaktik 5. Geistliche Allegorie 6. Die Fabel 7. Wittenwilers "Ring" III. Lyrik 1. spruchdichter und Meistersinger 2. Geistliche und weltlihe Liederdichter 3. gesellschaftslied und Volkslied 4. Historsche Volkslieder IV. Das Spiel 1. Abgrenzungen 2. Große Spieltraditionen 3. Vereinzelte geistliche Spiele 4. Das weltliche Spiel (Fastnachspiel) 5. Die Frage der "Moralität" V. Die Verserzählung 1. Mären 2. Zyklisches 3. Roman und Epik VI. Neue Prosa 1. Fachprosa: Natur und Recht 2. Geschichte und Selbsterfahrung 3. Kunstprosa aus Böhmen 4. Anfänge des Prosaromans 5. Frühhumanistische Übesetzungsprosa 6. Albrecht von Eyb 7. Ein Prediger SECHZEHNTES JAHRHUNDERT I. Die Epoche II. Renaissance und Humanismus 1. Maximilian I. 2. Die Narrensatire 3. moralisch-politische Ermahnung 4. Humanismus: eine Lebensform 5. Humanismus: ein Bildungsprogramm 6. Humanistische Dichtung 7. Humanistische Frömmigkeit 8. Ulrich von Hutten III. Reformation 1. Flugschriften der ersten Jahre 2. Dialog und Drama 3. Luther 4. Zwingli 5. Die Bibel der Geschichte und der Natur IV. Chronik und Selbstbiographie 1. Zur Hostoriographie seit Humanismus und Reformation 2. Aventin 3. Eidgenössische Chronistik 4. Familienchronik, Denkwürdigkeiten, Selbstbiographie V. Die Welt des Herrn Sachs 1. die Meistersinger 2. Hans Sachs VI. Volks- und Kunstlyrik 1. Das Volkslied 2. Zur neulateinischen Lyrik 3. Neue deutsche Lyrik VII. Drama 1. Gleichnisspiel und Moralität 2. Bibel-und Historiendrama 3. Komödie VIII. Prosaerzählung 1. Kurzformen 2. Romane IX. Manierismus 1. Manieristische Tendenzen 2. Johann Fischart Epilog ANHANG Bibliographische Hinweise Register Weitere Titel aus der Reihe Reclams Universalbibliothek |
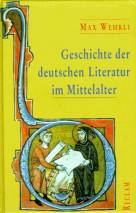
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen