|
|
|
Umschlagtext
Ordnungssysteme
Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit Herausgegeben von Dietrich Beyrau, Anselm Doering-Manteuffel und Lutz Raphael Band 28 Rezension
Der Verfasser dieser Studie, Dr. Morten Reitmayer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Trier, wendet sich dem Begriff der Elite zu, der nach 1945 eine tragende Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik spielte. Elite-Denken geht von folgenden Annahmen aus: 1. Jede Gesellschaft zerfällt in die Elite und die Nicht-Elite. 2. Die Elite bildet den (einzig) relevanten Teil einer Gesellschaft. 3. Eliten werden sozial wirksam durch die Herstellung eines Konsenses, nicht durch Unterwerfung. 4. Elite-Mitglieder werden in Systemen der Leistungsauslese unter Konkurrenzbedingungen ausgewählt. Der Elite-Begriff hat in der frühen BRD das politisch-ideelle Vakuum nach dem Ende des katastrophalen Nationalsozialismus ausgefüllt, der entgegen vielfältiger Behauptungen keineswegs am Elite-Begriff orientiert war (Unterwerfung statt Konsens / fehlende Leistungsauslese). Das Elite-Denken wurde gefördert durch folgende Sachverhalte: In den 1950er Jahren entstand eine exklusive, homogene und kohärente literarisch-politische Öffentlichkeit. Der Kalte Krieg wurde als Rivalität zwischen zwei entgegengesetzten Wertsystemen angesehen. Der Gemeinplatz vom "Mensch im Mittelpunkt" (in Abgrenzung vom NS-Regime) führte zu harmonischen Entwürfen, die konfliktorienteiret Debatten über Klassensysteme nicht zuließ. Christentum und Kirche waren zunächst wesentliche Bezugspunkte zur politisch-ideellen Neuorientierung der deutschen Demokratie; hier dominierte die Vorstellung einer christlich gebundenen Wert-Elite. Die Sozialwissenschaften waren noch stark geisteswissenschaftlich orientiert - auch das förderte den Elite-Gedanken. Und insgesamt dominierten in den 1950er Jahren konservative Sichtweisen. Der Gegensatz zwischen Elite und Masse wurde betont.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
"Elite" einmal nicht politisch-publizistisch, sondern (sozial)wissenschaftlich fundiert betrachtet Das Buch untersucht, weshalb der Elite-Begriff erst nach 1945 in Deutschland eine tragende Rolle zur Beschreibung der politisch-sozialen Ordnung spielte. "Elite" wird dabei als eine bestimmte Form des Meinungswissens über die Ordnung der Gesellschaft verstanden, das im Wesentlichen auf vier Annahmen basiert: 1. Jede Gesellschaft zerfällt in die Elite und die Nicht-Elite. 2. Die Elite bildet den (einzig) relevanten Teil einer Gesellschaft. 3. Eliten werden sozial wirksam durch die Herstellung eines Konsenses, nicht durch Unterwerfung. 4. Elite-Mitglieder werden in Systemen der Leistungsauslese unter Konkurrenzbedingungen ausgewählt. Damit wurde der westdeutschen Gesellschaft genau die stabile politisch-ideelle Ordnung gegeben, die den politischen Systemen seit 1871 fehlte. Morten Reitmayer ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Trier. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
Einleitung: Eine akteursorientierte Sozialgeschichte politisch-gesellschaftlicher Ideen 9 1. Die Schauplätze des Geschehens 47 1.1 Das Literarisch-Politische Feld und die Evangelischen Akademien 47 1.2 Die soziale Logik des Literarisch-Politischen Feldes 69 1.3 Orientierungsbedürfnisse der Nachkriegszeit 100 1.4 Intellektuelle Rahmenbedingungen 107 2. Orientierung durch Differenzbestimmung: Die Einteilung der sozialen Welt in Elite und Nicht-Elite (Masse) 133 2.1 Die Orientierungsleistung der Massen-Doxa in der Zeitkritik 134 2.2 Elemente der Wert- und Charakter-Elite 148 2.2.1 Konstitutive Eigenschaften einer Wert- und Charakter-Elite 150 2.2.2 Christliche Wertbindung 155 2.2.3 Askese 166 2.2.4 Unabhängigkeit und Verantwortung 170 2.2.5 Aporien der Wert- und Charakter-Elite 182 3. Legitimation: Die Elite als der relevante Teil der Gesellschaft 191 3.1 „Jede Demokratie braucht eine Elite!" 191 3.1.1 Karl Mannheim: Planungselite im Massenzeitalter 192 3.1.2 Gaetano Mosca und die Erfindung der politischen Elite 203 3.1.3 Liberale Elitetheorien im Diesseits von Angebot und Nachfrage 213 3.1.4 Grenzen der Rezeption „machiavellistischer" Eliten-Modelle in den 1950er Jahren 236 3.1.5 Der Archimedische Punkt: Elite, Herrschende Klasse und die politische Willensbildung in der Demokratie 246 3.1.6 Ausbreitung und Vulgarisierung: Die politische Elite aus Sicht der Politiker 268 3.2 Delegitimierung: Demokratie ohne Elite 277 3.2.1 Eine antibürgerliche Elite der Askese 278 3.2.2 Fehlende Elite, fehlende Legitimation 281 3.2.3 Historische Eliten 286 3.2.4 Elite und Prominenz 298 4. Handlungswissen und Rollenfindung: „Führung" als spezifisches Elite-Handeln 307 4.1 Führung als Handeln der Elite: „Führer" heißt nicht „Führung" 307 4.2 Der Elite-Begriff und die symbolischen Konflikte innerhalb der Unternehmerschaft 324 4.3 Führung im Betrieb 356 5. Die neue symbolische Ordnung: Elite-Bildung durch die soziale Magie individueller Auslese 377 5.1 Versuche der Elite-Bildung 378 5.1.1 Vorläufer in der ersten Jahrhunderthälfte 379 5.1.2 Die Rolle der Evangelischen Akademien 404 5.1.3 „Pädagogische" Elite-Bildung 410 5.1.4 Politische Elite-Bildung: Der Traum vom Oberhaus . 421 5.2 Von der Elite zu den Eliten. Die Pluralisierung des Begriffs . 433 5.2.1 Robert Michels und die Tradierung des Elite-Begriffs 435 5.2.2 Die Rezeption und Wirkung der Arbeiten Vilfredo Paretos 439 5.2.3 Der kalte Blick der konservativen Avantgarde 460 5.3 Verwissenschaftlichung des Elite-Begriffs und Vollendung der Elite-Doxa 491 5.3.1 Das theoretische Fundament des verwissenschaftlichen Elite-Begriffs 491 5.3.2 Macht und Herrschaft: importierte Kategorien 517 5.3.3 Die Vollendung der Elite-Doxa 533 Zusammenfassung und Ausblick 561 Abkürzungsverzeichnis 577 Quellenverzeichnis 579 Literaturverzeichnis 589 Personenregister 623 Weitere Titel aus der Reihe Ordnungssysteme. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit |
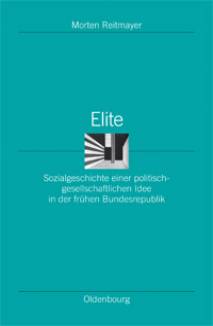
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen