|
|
|
Umschlagtext
Die Ausbildung und Tätigkeit von Berufsschullehrern sind zentrale Themen der Berufspädagogik. Umso erstaunlicher ist es, dass sich eine systematische empirische Berufsschullehrerforschung mit einer eigenen Forschungsprogrammatik in den letzten 40 Jahren nicht entwickelt hat. Die Arbeitsrealität von Berufsschullehrern wurde bisher kaum untersucht. Die vorliegende Studie schließt diese Lücke und beschäftigt sich mit der Alltagswirklichkeit von Berufsschullehrern. Sie untersucht Einstellungsmuster (Selbst-, Aufgaben- und Fachverständnis) von Lehrern im Berufsfeld Elektrotechnik und geht der Frage nach, wie sich diese auf das didaktische Handeln auswirken. Ein Ergebnis der Studie ist eine Lehrertypologie, die sich aus unterschiedlichen Fachverständnissen und Bildungskonzepten ergibt.
Dr. Waldemar Bauer studierte in Stuttgart Elektrotechnik und Berufspädagogik. Nach dem Absolvieren des Zweiten Staatsexamens wechselte er in die Wissenschaft zum Institut Technik und Bildung der Universität Bremen, Dort ist er zurzeit wissenschaftlicher Assistent und lehrt in der beruflichen Fachrichtung Elektrotechnik-Informatik und ihre Didaktik. Darüber hinaus arbeitet er in nationalen und internationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Rezension
Berufliche Schulen befinden sich z.Zt. in einem umfassenden Reformprozess; in diesem Rahmen wird auch die Berufsschullehrerbildung wieder verstärkt diskutiert. Ausbildung, Rekrutierung und Tätigkeit von Berufsschullehrern sind zentrale Themen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Um so erstaunlicher ist es, dass empirische Studien der Berufsschullehrerforschung kaum vorliegen. In der Berufspädagogik besteht großer Forschungsbedarf im Hinblick auf Untersuchungen zur Arbeitswelt von Berufsschullehrern. Zwei zentrale Kritikpunkte in der Berufsschullehrerausbildung begegnen immer wieder: a) Ein als mangelhaft empfundener Praxisbezug des Fachstudiums (Theorie-Praxis-Problem), b) eine fehlende Verknüpfung des erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Studiums mit den konkreten beruflichen und unterrichtlichen Handlungssituationen.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Themenbereich: Berufsbildung Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Alltagswirklichkeit von Berufsschullehrern. Sie untersucht Einstellungsmuster (Selbst-, Aufgaben- und Fachverständnis) von Lehrern im Berufsfeld Elektrotechnik und geht der Frage nach, wie sich diese auf das didaktische Handeln auswirken. Ein Ergebnis der Studie ist eine Lehrertypologie, die sich aus unterschiedlichen Fachverständnissen und Bildungskonzepten ergibt. Inhaltsverzeichnis
1. Einführung 11
2. Problemstellung und Aufbau der Arbeit 15 2.1. Problemhintergrund 15 2.2. Aufbau und Gliederung der Arbeit 21 3. Ausbildung und Arbeitswelt von Gewerbelehrern 28 3.1. Entwicklung der Ausbildung und Arbeit von Gewerbelehrern 28 3.1.1. Drei Schwellen zur Veränderung der Leitbilder von Gewerbelehrern 29 3.1.2. Ursprünge der Gewerbelehrerausbildung 30 3.1.3. Erste Akademisierungsbewegung der Lehrerverbände 34 3.1.4. Zweite Akademisierungsbewegung: Primat der Wissenschaftsorientierung und Entstehung des Lehrer academicus 36 3.1.5. Leitbild der Bildungsreform 1960-1970 39 3.1.6. Zusammenfassung: Epochale Herausbildung der Lehrerleitbilder 40 3.1.7. Entwicklung der Gewerbelehrerausbildung in der ehemaligen DDR 42 3.1.8. Implikationen für die empirische Berufsschullehrerforschung 44 3.2. Das heutige „Berufsbild" des Lehrers 45 3.2.1. Normative Aufgabenzuschreibung von Lehrern im Bildungssystem 45 3.2.2. Kompetenzanforderungen und Kompetenzkategorien 48 3.3. Konzeptualisierung der beruflichen Fächer und der Fachdidaktik 55 3.3.1. Grundmodelle der beruflichen Fächer 55 3.3.2. Entwicklung einer Schulfachdidaktik im Kontext der Entstehungsgeschichte der Elektroberufe 56 3.3.3. Herausbildung eines problematischen Aufgabenverständnis in der beruflichen Fachdidaktik 72 3.3.4. Konzeptualisierung der Gewerblich-Technischen Wissenschaften 76 3.3.5. Implikationen für die empirische Berufsschullehrerforschung 79 3.4. Der Berufsschullehrer im Kontext des gesellschaftlichen Wandels 83 3.4.1. Anforderungen an Lehrer aufgrund globaler Entwicklungstrends 83 3.4.2. Anforderungen an Lehrer aufgrund pädagogisch-didaktischer Entwicklungen 92 3.4.3. Anforderungen aus der Schulentwicklungsprogrammatik 104 3.4.4. Konsequenzen für das Lehrerhandeln und die Lehrerkompetenz 107 3.4.5. Implikationen aus der Aufgabenzuschreibung für die empirische Berufsschullehrerforschung 110 3.5. Zusammenfassung relevanter empirischer Befunde zur Ausbildung und Arbeit von Berufsschullehrern 113 3.5.1. Relevante empirische Befunde zur Berufsschullehrerausbildung 115 3.5.2. Relevante empirische Befunde zur Berufsschullehrerarbeit 124 3.5.3 Zusammenfassung und resultierende Forschungsdesiderate 137 4. Theoretische Zugänge zum Lehrerwissen und-handeln 141 4.1. Professionalisierungsdiskussion und das Leitbild der Professionalität 141 4.1.1 Professionalisierungstheorien und-modelle 141 4.1.2 Adaptionsversuche auf das berufspädagogisches Handeln 154 4.1.3 Kritische Zusammenfassung und Folgerungen für den empirischen Zugang zur Arbeitswelt der Berufsschullehrer 158 4.2. Expertiseforschung im Lehrerbereich 161 4.2.1 Lehrerkognitions-und Lehrerhandlungsforschung 162 4.2.2 US-amerikanische Lehrerkognitionsforschung zur Wissensbasis von Lehrern - Pedagogical Content Knowledge (PCK) 167 4.3. Implikationen für die empirische Berufsschullehrerforschung 172 5. Entfaltung des Forschungsfeldes „empirische Berufsschullehrerforschung" 174 5.1. Analyse herausgebildeter Professionalität von Berufspädagoge (Arbeitsweltuntersuchungen) 180 5.1.1 Anforderungen an Berufsfeldanalysen 180 5.1.2 Forschungsgegenstände 181 5.2. Analyse des Professionalisierungsprozesses von Berufspädagogen 185 5.3. Zum Erkenntnisinteresse der Untersuchung 186 6. Methodische Anlage der empirischen Untersuchung 190 6.1. Wahl und Begründung der Untersuchungsmethode 190 6.2. Methodische Konzeption der Fragebogenerhebung 192 6.2.1 Ableitung der Fragestellungen 192 6.2.2 Operationalisierung und Datenerhebung 194 6.2.3 Unabhängige und abhängige Konstrukte 196 6.2.4 Einzelne Schritte der Operationalisierung 197 6.2.5 Zeitlicher Ablauf der Untersuchung 199 6.2.6 Auswahlverfahren der Stichprobe 199 6.2.7 Die Stichprobe 205 6.3. Methodische Konzeption der vertiefenden Interviews 209 6.4. Methodische Konzeption zu den Dokumentenanalysen 212 7. Auswertung des Datenbestandes aus der Fragebogenerhebung 214 7.1. Sozialstatistische und berufsbiografische Daten 214 7.1.1 Altersstruktur und Geschlecht 214 7.1.2 Beschäftigungsdauer im Schuldienst 215 7.2. Beruflicher Werdegang der Elektrolehrer 216 7.2.1 Allgemeine Schulabschlüsse 216 7.2.2 Hochschulstudium 218 7.2.3 Berufsausbildung 225 7.2.4 Betriebliche Erfahrung 229 7,3. Bewertung des Lehrerberufs 232 7.3.1 Zufriedenheit 232 7.3.2 Berufswahlmotive 234 7.4. Bewertung von Lehrerkompetenzen 235 7.4.1 Retrospektive Bewertung zum Nutzen der Lehrerausbildung 235 7.4.2 Teilnahme und Bewertung von Lehrerfortbildungen 239 7.4.3. Bewertung einzelner Kompetenzbereiche 241 7.5. Selbstverständnis von Elektrolehrern 247 7.6. Aufgabenverständnis von Lehrer an beruflichen Schulen 250 7.6.1 Bewertung der allgemeinen Lehreraufgaben 250 7.6.2 Umsetzung des Bildungsauftrags der Berufsschule 252 7.6.3 Bewertung einzelner Bildungs-und Erziehungsziele 254 7.7. Lehr-und Lernmethoden 257 7.8 Bewertung der Veränderung der Lehrerrolle 259 7.9. Das Adressatenbild von Berufsschullehrern 263 7.10. Zur Bedeutung der beruflichen Curricula 264 7.11. Einstellungsmuster zur Lernortkooperation 267 7.11.1 Bewertung der Rahmenbedingungen 268 7.11.2 Anlass des lernortkooperativen Handelns 270 7.11.3 Korrelation Praxiserfahrung mit Einstellung zur Lernortkooperation . 273 7.11.4 Curriculare Konzepte zur Stützung der Lernortkooperation 274 7.11.5 Lernortkooperation am Beispiel der Aufgabe „Instandhaltung und Inbetriebnahme einer Produktionsanlage" 278 7.12. Fachverständnis von Elektrolehrern 282 7.12.1 Technikverständnis 282 7.12.2 Globale Bewertung der fachsystematischen Wissensstruktur 285 7.12.3 Bewertung der Fachsystematik am Beispiel elektrische Maschinen 289 7.13. Bedeutung der Facharbeit für den Berufsschulunterricht 295 7.13.1 Relevanz beruflicher Arbeitsaufgaben 295 7.13.2 Methoden zur Identifizierung beruflicher Arbeitsaufgaben 296 7.13.3 Herstellung des Arbeitsbezugs am Beispiel der Arbeitsaufgabe „Instandhaltung und Inbetriebnahme einer Produktionsanlage" 298 7.13.4 Transformation beruflicher Arbeitsaufgaben in Lernaufgaben 306 7.14. Veränderungsvorschläge zur Weiterentwicklung des dualen System 308 7.15. Zusammenfassung der zentralen Befunde 313 8. Auswertung der vertiefenden Interviews 324 8.1. Datenbestand 324 8.2. Auswertung der Interviews 325 8.2.1 Allgemeine didaktische Handlungsprinzipien 325 8.2.2 Konzepte der Praxisorientierung 330 8.2.3 Konzepte zur Umsetzung der Lernfelder 337 8.2.4 Lernformen und Unterrichtsmethoden 346 8.2.5 Strukturierung und Vermittlung von Wissen 349 8.2.6 Fachverständnis von Elektrolehrern 368 8.2.7 Wissensbasis des Unterrichts im Berufsfeld Elektrotechnik 373 9. Dokumentenanalysen von Unterrichtsentwürfen 378 9.1. Fachdidaktische Konzepte in der zweiten Phase der Lehrerausbildung 378 9.1.1 Bedingungsanalysen 381 9.1.2 Konzepte der didaktischen Analyse 383 9.1.3 Konzepte der methodisch-medialen Analyse 393 9.1.4 Tafelbilder 396 9.2. Bewertung der Unterrichtskonzepte in der zweiten Phase 405 9.3. Neue didaktische Konzepte im Kontext der Lernfelder 407 10. Zusammenfassung und Fazit 412 10.1. Zusammenfassung der wichtigsten Befunde 412 10.2. Fazit 419 11. Literaturverzeichnis 422 Weitere Titel aus der Reihe Berufsbildung, Arbeit und Innovation, Dissertationen/Habilitationen |
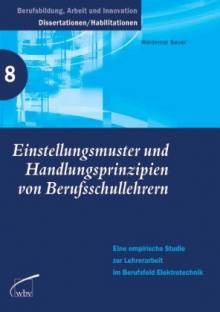
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen