|
|
|
Umschlagtext
Kunst ist tiefsinnig, einzigartig und intelligent, Unterhaltung ist trivial, frisst Lebenszeit und führt zur Verdummung – meist beschäftigen sich die Kulturwissenschaften immer noch aus dieser Perspektive mit der Unterhaltung und bestärken so ihre eigenen Vorurteile.
Hans-Otto Hügel hat in seinen Arbeiten stets einen anderen Blick auf Unterhaltung gewagt und hat selbst – als langjähriger Literatur- und Medienexperte bei Wim Thoelkes „Der große Preis“ – die Grenze zwischen Theorie und Praxis überschritten. In seinen Arbeiten unternimmt er mit der Formel von der ästhetischen Zweideutigkeit fortwährend den Versuch, der Unterhaltung im Besonderen und der Populären Kultur im Allgemeinen genau die Spannung zurückzugeben, die ihr sowohl von ihren Verächtern als auch von vielen Medienwissenschaftlern und Medienpädagogen abgesprochen wird. Dieser Band vereint in Anlehnung an Hügels Forschung so vielfältige Themen wie die Flut von Kochsendungen im deutschen Fernsehen, die Kommerzialisierung der Neuen Deutschen Welle, James Bonds Rolle als Indikator gesellschaftlicher Veränderungen, einen unvollendeten Roman von Friedrich Schiller oder Trickfilme aus Legosteinen. Rezension
Die traditionelle Dichotomie von Kunst und Unterhaltung vermag die globale Kultur der Gegenwart nicht mehr adäquat zu beschreiben. Kultur und Populäres können nicht mehr als sich ausschließendes Gegenüber gefasst werden, sondern stehen in wechselseitiger Durchdringung zueinander. In Deutschland wurde länger als im angelsächsischen Bereich die Tradition der Massenkultur- und Kulturindustriekritik gepflegt, den angelsächsischen Cultural Studies naiver Kulturoptimismus vorgeworfen. Demgegenüber wird heute stärker die "ästhetische Zweideutigkeit" (Hans-Otto Hügel) von Unterhaltung und Popkultur hervorgehoben. In diesem Band wird deshalb Unterhaltung in ihren vielfältigen Formen und Themen untersucht: Kochsendungen im deutschen Fernsehen, die Neue Deutsche Welle, James Bond- und Trickfilme ...
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einleitung 9
I. Lebensbilder christian kortmann 16 Im Auto mit Hügel II. Genrebilder ingrid tomkowiak 26 »You will not like me« – Zur Feststellung ästhetischer Mehrdeutigkeit bei Johnny Depp werner greve 42 Geheimagent als Seismograf. Bemerkungen zur Sozialpsychologie der James-Bond-Filme stephen lowry 59 Die Ambivalenz des Brutzelns: Kochsendungen als populäre Fernsehunterhaltung barbara hornberger 77 Spaß verstehen. Über die Rezeption von Affirmation am Beispiel der Neuen Deutschen Welle felix reisel / jörg-uwe nieland 97 Supernova – Konsequenzen des frühen Todes von Popmusikern für die Starfigur und den Prozess der Unterhaltung volker wortmann 118 Kontingenzbilder. Zur Tiefgründigkeit fotografischer Oberflächen mathias mertens 131 Einige Thesen zu Medienamateurpraxis am Beispiel Brickfilm III. Zur Theorie populärer Kultur und Unterhaltung stephan porombka 149 Eindeutig nicht zweideutig genug. Produktionsästhetische Anmerkungen zu Schillers gescheitertem Geisterseher-Projekt stefan krankenhagen 167 Gelingendes und beschädigtes Leben. Die Theorie der Unterhaltung im Licht der Ästhetik Adornos kaspar maase 185 Massenkünste und Massenängste. Aporien der modernen Unterhaltungskultur udo göttlich 202 Auf dem Weg zur Unterhaltungsöffentlichkeit? Aktuelle Herausforderungen des Öffentlichkeitswandels in der Medienkultur eggo müller 220 Unterhaltung im Zeitalter der Konvergenz Statt einer Bibliografie: 239 Hans-Otto Hügel als Experte in Wim Thoelkes Der große Preis Autorinnen und Autoren 243 Leseprobe: udo göttlich / stephan porombka Einleitung Die Motive und Gründe für die Analyse Populärer Kultur, so vielfältig und verschieden sie zunächst erscheinen, speisen sich aus der gemeinsamen Erfahrung, dass die globale Kultur der Nachkriegszeit unmöglich noch mit der traditionellen Dichotomie von Kunst und Unterhaltung verstanden und begrifflich auf den Punkt gebracht werden kann. Was sich bereits seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts andeutete und für längere Zeit im Gestus eines Verfallsdiskurses behandelt wurde, führt seit den 1950er-Jahren zusehends zu einer Analyse der Durchdringungen, Wechselwirkungen und Beziehungen von Kunst und Unterhaltung, von Kultur und Populärem sowie von Alltag und Medien, die die Reflexe traditioneller Gegenüberstellungen, Ausschließungen und Dichotomien erst allmählich aufgibt. Mit Blick auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen blieb die Analyse und Kritik der Durchdringungen und Wechselwirkungen nicht immer widerspruchsfrei oder vonseiten der offiziellen Künste oder Eliten unwidersprochen. Und auch die Auseinandersetzungen und Diskurse in den verschiedenen westlichen Ländern weisen zum Teil bedeutende Unterschiede auf, die Einblick in die Rolle von Traditionen, Institutionen bis hin zur Wissenschaft im Umgang mit der Populären Kultur erlauben. Gerade im Verhältnis der deutschsprachigen zur anglo-amerikanischen Auseinandersetzung sind diese Unterschiede bis heute wesentlich. Erklärt sich doch gerade vor ihrem Hintergrund die große Bedeutung der Cultural Studies in der Analyse der Populären Kultur seit den 1980er-Jahren. Während allerdings die Beschäftigung mit den Cultural Studies in Deutschland im Lichte einer Kritik und Auseinandersetzung mit den älteren, in der kultursoziologischen sowie geistes- und kulturwissenschaftlichen 10 udo göttlich / stephan porombka Tradition verankerten Massenkultur- und Kulturindustriekritiken geführt wurde, die aus Sicht der Cultural Studies überwiegend kulturpessimistisch argumentierten, wurde die Stoßrichtung der Cultural Studies hierzulande nicht nur als kulturoptimistisch verstanden, auch erschien sie vielen Kritikern obendrein für eine seriöse Wissenschaft als viel zu politisch. Dieser Kritik zum Trotz haben die Cultural Studies vor dem Hintergrund ihres interdisziplinären Zusammenhangs eine Kulturwissenschaft entworfen, deren Themen die Konstitution der Gesellschaft als Kultur sowie den komplexen Zusammenhang und die Interaktion von Kultur mit den vielgestaltigen, verschiedenartigen sozialen Praktiken beinhaltet. Trotz der Unterschiedlichkeit der Perspektiven kann nicht übersehen werden, dass die Rezeption der Cultural Studies zu einer breiten, nicht nur die kulturwissenschaftlichen Disziplinen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen betreffenden Auseinandersetzung mit der Populären Kultur geführt hat, die neben einer kritischen Betrachtung der eigenen Begriffe und Tradition zu einer Kritik der Massenkulturkritik sowie zu einer verstärkten Theoriebildung der Unterhaltung und der Populären Kultur beigetragen haben. Der vorliegende Band widmet sich einer bedeutenden Position in der Auseinandersetzung mit der Populären Kultur, die ohne den deutschen Hintergrund kaum zu denken ist, die aber darauf angelegt ist, diesen Hintergrund selbst immer mit zu reflektieren. Mit seinen Analysen der Populären Kultur, mit der Entwicklung maßgeblicher Begriffe und mit seiner Theorie der Unterhaltung hat Hans-Otto Hügel seit den 1980er- Jahren das Forschungsfeld auf entscheidende Weise geprägt. In seiner Arbeit unternimmt er mit der Formel von der ästhetischen Zweideutigkeit fortwährend den Versuch, der Unterhaltung im Besonderen und der Populären Kultur im Allgemeinen genau die Spannung zurückzugeben, die ihr sowohl von ihren Verächtern als auch von vielen Medienwissenschaftlern und Medienpädagogen abgesprochen wird. Das gelingt Hügel nicht zuletzt deshalb, weil er davon ausgeht, dass »die ästhetische Zweideutigkeit [der Unterhaltung] von Fall zu Fall verschieden realisiert« wird, jedoch »in irgendeiner Form [...] in jeder Unterhaltungssituation nachzuweisen« ist (vgl. hügel 1993: 128f.). Und das heißt: Man muss immer wieder die Probe aufs Exempel machen. Vergleicht man diese Forschungsaufgabe genauer mit den Cultural Studies und ihrem Zugang zur Populären Kultur, erkennt man gleich mehrere relevante Unterschiede. So bezieht er sich nicht – ganz anders als 11 Einleitung etwa Raymond Williams oder Richard Hoggart, für die Kultur als etwas Alltägliches, Gewöhnliches gilt und als ein die gesamte Lebensweise durchziehendes Bedeutungsmuster behandelt wird – auf die auf demokratische Tradition zurückgehenden Wurzeln, aus denen die Cultural Studies im Hinblick auf die Kritik der englischen Elitekultur ihre eigentliche Kraft gewonnen haben. Hügels Auseinandersetzung mit der Unterhaltung steht vermittelt in der von Tenbruck herausgearbeiteten Perspektive der Durchsetzung einer repräsentativen (bürgerlichen) Kultur, die sich zwar auch in England beobachten lässt, die aber in Deutschland wesentlich von einem anderen Kulturverständnis getragen wird. Im Unterschied zu den Cultural-Studies-Vertretern kritisiert Hügel diesen Kulturbegriff nicht. Er verfolgt seine Differenzierung von innen heraus, und zwar sowohl historisch als auch ästhetisch, indem er aufzeigt, wie bereits in der bürgerlichen repräsentativen Kultur die Entstehung von Unterhaltung angelegt war und mit der Industrialisierung und den mit ihr verbundenen kulturellen Transformationsprozessen in Deutschland zur Entstehung einer Unterhaltungskultur beigetragen hat, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg (und zuvor unterbrochen durch den Nationalsozialismus) in Kontakt mit der ›globalen‹ anglo-amerikanischen Populärkultur getreten ist. In der Erfassung und Analyse der daraus resultierenden Wechselwirkungen findet sich ein zentrales Motiv von Hügels Forschung, wenn er in seiner Dissertation (vgl. hügel 1978) den Spuren des deutschen Kriminalromans folgt, der bis dahin ausschließlich in Abhängigkeit von der anglo-amerikanischen Romanheftflut gesehen wurde und deshalb nicht als eigenständig erfasst und beschrieben worden war. Einen viel wichtigeren Unterschied zu den Cultural Studies markiert jedoch Hügels Beharren auf der ästhetischen Eigenart des populärkulturellen Artefakts. An den Cultural Studies kritisiert er gerade die Vernachlässigung dieses wichtigen Aspekts, der sich eben nicht nur vonseiten der Rezeption behandeln lasse. In der Auseinandersetzung mit der Populären Kultur ist es das Artefakt in seiner ästhetischen Erscheinungsweise und eben nicht die alltagskulturelle Verwendungsweise, die Hügels ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, und die ihn zu einer die Facetten der populären Artefakte in ihrer Vielfalt erfassenden und beschreibenden Forschung angeleitet hat. Das aber liegt nicht zuletzt wohl daran, dass Hans-Otto Hügel sein Forschungsfeld aus einem Kontext heraus entwickelt hat, der sich auf die energetische Verbindung zwischen kulturpädagogischen, kulturwissen12 udo göttlich / stephan porombka schaftlichen Fragestellungen und der ästhetischen Praxis konzentriert. Am Fachbereich ii der Universität Hildesheim arbeitet Hans-Otto Hügel als Deutschlands einziger Professor für Populäre Kultur seit 1983. Das Profil dieses Fachbereichs hat er dementsprechend auf entscheidende Weise mitbestimmt. Nicht zuletzt dadurch, dass er erfolgreich dieser in den 1980er- und 1990er-Jahren in Deutschland noch völlig neuen und bis in die Gegenwart immer noch misstrauisch und eifersüchtig beäugten Form der kulturwissenschaftlichen Forschung in der internationalen Scientific Community Aufmerksamkeit verschafft hat. Die Grundidee dieses Forschungsansatzes ist, die Auseinandersetzung mit kulturellen Artefakten weder als Akt der Unterwerfung unter auratische Werke noch als Preisgabe der Kunst an die Rezipienten zu verstehen. Ausgangspunkt ist stattdessen die Frage nach der kulturellen Produktion – und damit dann auch die Frage nach der Gemachtheit der Werke und den Bedingungen und Möglichkeiten ihres Machens. In Forschung und Lehre ist das entsprechend dem Konzept der Hildesheimer Kulturwissenschaften immer mit der Begleitung der aktuellen, gegenwärtigen ästhetischen Praxis verbunden, die nicht nur die Praxis der ›anderen‹, sondern immer auch die eigene ist. Über ›Produktionsästhetik‹ geht dieser Ansatz weit hinaus, weil er sich viel genauer, umfassender und vor allem produktiver auf die Spannungsfelder konzentriert, aus denen heraus kulturelle Artefakte entstehen und in denen sie fortlaufend weiter bearbeitet werden. Mit der ›ästhetischen Zweideutigkeit‹ hat Hans-Otto Hügel dabei den eigentlichen Energiekern der kulturellen Produktion herausgearbeitet – und das, indem er mit der Unterhaltung ausgerechnet das in den Mittelpunkt gerückt hat, was für die sogenannte ›ernsthafte‹ wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur immer nur abschätzig behandelt oder im Rahmen hysterisierter Debatten sogar als kulturgefährdend eingestuft worden ist. Mit Hügels Arbeiten sind die populärkulturellen Artefakte nicht nur für die Beobachter zu etwas Eigenständigem geworden. Auch hat er das Bild der Produzenten grundlegend verändert. Nicht zuletzt macht Hügel es möglich, den Produktionsprozess populärkultureller Artefakte genauer und komplexer zu analysieren und damit dann auch: im Rahmen ästhetischer Praxen offensiver und intensiver mit ihm zu experimentieren. Wenn sich die Autorinnen und Autoren im vorliegenden Band mit Hans-Otto Hügels Theorie der ›ästhetischen Zweideutigkeit‹ beschäfti13 Einleitung gen, dann tun sie das nicht, weil sie ihm in allen Hinsichten folgen. Sie geben vielmehr Auskunft darüber, wie Hügels Theorie selbst zu einem Energiekern für ihre eigenen Forschungen geworden ist, weil sie Fragestellungen entwirft und Antworten gibt, die eben immer wieder die Probe aufs Exempel brauchen, um überprüft und weiterentwickelt zu werden. Dieser Band ist damit ein Ergebnis der wissenschaftlichen Produktivität von Hans-Otto Hügel, die zur Entfaltung der Produktivität der Erforschung der Populären Kultur einen wohl kaum zu überschätzenden Teil beigetragen hat. Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile, denen ein erster Beitrag von christian kortmann vorangestellt ist, in dem er uns Hans-Otto Hügel in seiner Rolle als Hochschullehrer sowie als Kenner der Populären Kultur mit eigenen Unterhaltungsqualitäten vorstellt. ingrid tomkowiak widmet sich in ihrem Beitrag, mit dem der Hauptteil ›Genrebilder‹ eröffnet wird, dem schauspielerischen Werk von Johnny Depp und verdeutlicht, welche Einsichten sich über seine Leistung in den unterschiedlichsten Rollen und Filmen mit dem Konzept der ästhetischen Zweideutigkeit gewinnen lassen. Dazu werden Starfigur und Rolle sowie die Person des Schauspielers vor dem Hintergrund der verschiedenen Genres, in denen Depp Erfolge feierte, in eine spannungsvolle Beziehung gesetzt. Eine vollkommen andere populäre Figur, die von verschiedenen Schauspielern verkörpert wurde, tritt uns in dem Beitrag von werner greve mit James Bond entgegen. Die Ausgangsthese lautet, dass Unterhaltungsfilme äußerst sensibel auf Strömungen des Zeitgeistes reagieren, womit es um die Frage geht, wie die Bond-Filme ihre zeitdiagnostische Kraft als populäre Serie trotz unterschiedlicher Schauspieler gewinnen. In dem Beitrag von stephen lowry bilden Köche und Kochsendungen den Gegenstand zur Erprobung von Unterhaltungstheorie. Als billig und leicht zu produzierendes Programmangebot erfüllen sie ihre Rolle als Trendsetter für Lifestyle und Kochmoden sowie als Ratgeber zum Thema Kochfertigkeiten. Auf die Grundfrage von Affirmation und Kritik in der Unterhaltungskultur treffen wir in dem Beitrag von barbara hornberger zur Neuen Deutschen Welle. Mit ihren auf Spaß und gute Laune setzenden Songs hatte diese Musikrichtung die damalige Kritik herausgefordert, indem sie die Einteilung von Kritik und Affirmation durch Scheinaffirmation außer Kraft setzte. Der Beitrag von felix reisel und jörg-uwe nieland behandelt eine weitere Facette von Hügels Unterhaltungstheorie, indem 14 udo göttlich / stephan porombka sich die Autoren mit dem Begriff des ›Stars‹ und der ›Starfigur‹ auf dem Feld der Populären Musik auseinandersetzen. In ihrem Beitrag interessieren sie sich für den Wandel und die Konstanz von Star-Images im Verhältnis zum frühen Tod von Rockmusikern, wozu sie das Schicksal einer Reihe zentraler Figuren der Rockmusikgeschichte behandeln. volker wortmann führt uns in seinem Beitrag auf das Feld der Fotografie und er diskutiert den Aspekte der ästhetischen Zweideutigkeit an dem Verhältnis von fotografischem Abbild und Realität, wozu er u.a. das Konzept bzw. den Begriff des Optisch-Unbewussten in den Mittelpunkt stellt. Mit Thesen zur Medienamateurpraxis schließt mathias mertens diesen ersten Hauptteil des Buches. Am Beispiel von Brickfilmen diskutiert er das ambivalente Verhältnis von Kunstproduktion und Freizeittätigkeit, das im Zeitalter des Internets in eine neue Phase eintritt. Der zweite Hauptteil widmet sich der Theorie Populärer Kultur und Unterhaltung, wozu stephan porombka in der Diskussion der Entstehungsgeschichte von Schillers Geisterseher-Projekt einige der zentralen Thesen und Grundmotive von Hügels Theorie herausarbeitet. Das geschieht vor dem Hintergrund einer These Hügels, dass die Geschichte der Populären Kultur in Deutschland eine andere Wendung genommen hätte, wenn Schiller dieses Projekt beendet hätte. Am Thema des gelingenden und beschädigten Lebens spürt stefan krankenhagen einem weiteren Grundmotiv von Hügels Unterhaltungstheorie im Vergleich mit der ästhetischen Theorie Adornos nach. Hierbei zeigt er, wie dieser Gegensatz konstitutiv für die Unterscheidung von Kunst und Unterhaltung ist und dennoch unterlaufen wird, allerdings um den Preis von Unterhaltung. Weiteren Aporien der modernen Unterhaltungskultur wendet sich kaspar maase in seinem, dem Verhältnis von Massenkünsten und Massenängsten am Beispiel der Wirkungsgeschichte des Schlagers in den 1920er- und 1930er-Jahren gewidmeten Beitrag zu. Seine Auseinandersetzung mit dem Schlager verfolgt die These, dass Unterhaltungsangebot und Alltagserfahrung auseinandertreten können und dadurch eine diagnostische Kraft für die Aufklärung der Gefühlsstruktur einer Zeit entfalten. Die Entwicklung einer Unterhaltungsöffentlichkeit in der Gegenwart bildet das Thema des Beitrags von udo göttlich. In der Unterhaltungstheorie Hügels sieht er nicht nur einen Bezugspunkt zur Versachlichung einer Debatte, in der immer noch Information und Unterhaltung als einander ausschließende Konzepte behandelt werden. Gestützt auf Hügels 15 Einleitung Theorie lassen sich auch die historischen Phasen der Öffentlichkeitsentwicklung reinterpretieren und mit dem Konzept der ästhetischen Zweideutigkeit ein neuer Blick auf den aktuellen Öffentlichkeitswandel gewinnen. In dem Beitrag von eggo müller steht mit dem Thema der Unterhaltung im Zeitalter der Medienkonvergenz eine weitere aktuelle Herausforderung im Mittelpunkt der Betrachtung, an der sich möglicherweise auch die von Hügel gestellte Frage nach dem Ende der Unterhaltung entscheidet. Am Beispiel neuer Partizipationsmöglichkeiten des Publikums an Medien, die mit zu einer Entgrenzung von Unterhaltung beitragen, diskutiert er die möglichen Konsequenzen für die historische Tatsache der Unterhaltung. Der Band schließt mit einer Aufstellung von Quizthemen der Sendung Der große Preis, in der Hans-Otto Hügel als Experte tätig war. Literatur hoggart, richard: The Uses of Literacy. London [Penguin] 1957 hügel, hans-otto: Untersuchungsrichter, Diebsfänger, Detektive: Theorie und Geschichte der deutschen Detektiverzählung im 19. Jahrhundert. Stuttgart [Metzler] 1978 hügel, hans-otto: Ästhetische Zweideutigkeit der Unterhaltung. Eine Skizze ihrer Theorie. In: montage/av, 2, 1, 1993, S. 119-143 hügel, hans-otto (Hrsg.): Handbuch Populäre Kultur. Begriffe, Theorien und Diskussionen. Stuttgart [Metzler] 2003 hügel, hans-otto: Lob des Mainstreams. Zu Begriff und Geschichte von Unterhaltung und Populärer Kultur. Köln [Herbert von Halem] 2007 tenbruck, friedrich h.: Repräsentative Kultur. In: haferkamp, h. (Hrsg.): Sozialstruktur und Kultur. Frankfurt/M. 1990, S. 20-53 thompson, edward p.: The Long Revolution. Review of The Long Revolution. In: New Left Review, 1961, No. 9 u. 10. S. 24-33 u. S. 34-39 williams, raymond: Culture and Society. London [Chatto & Windus] 1958 williams, raymond: The Long Revolution. London [Chatto & Windus] 1961 |
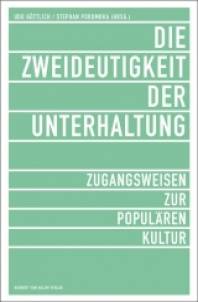
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen