|
|
|
Umschlagtext
Die vorliegende Arbeit folgt den markanten Leitlinien der ,Kunst', der ,Komik' und des Erzählens' im Werk Thomas Bernhards. Nach einer grundlegenden Definition dieser Schlüsselbegriffe in ihrem Bezug zum Werk des österreichischen Autors widmet sich der erste Hauptteil dieser Untersuchung der präzisen Analyse und Deutung von 15 Werken zweier Gattungen aus 23 Schoffensjahren Bernhards. Die einzelnen Interpretationskapitel gehen dabei - ein Wagnis und weitgehend auch ein Novum in der Bernhard-Forschung - konsequent und radikal textimmanent vor. Mit der ihr eigenen sorgfältigen und genauen philologischen Detailarbeit und einer ausgeprägten Sensibilität für sprachliche und dramaturgische Feinheiten untersucht die Arbeit nicht nur Bernhards Künstlerfiguren und ihr Verhältnis zur Kunst, sondern stets auch die Art ihrer Darstellung durch den Autor bzw. durch seine bislang in ihrer Relevanz verkannten Erzählerfiguren sowie, damit verbunden, die vielfältige Komik und die bislang oftmals unterschätzte hochkomplexe Selbstreflexivität der Texte. Die eingehenden Interpretationskapitel, die sich intensiv und kritisch mit bisherigen Forschungsansätzen auseinandersetzen, bilden das Fundament für das im zweiten Hauptteil angestrebte Ziel, sowohl feine Nuancen als auch deutliche inhaltliche wie formale Veränderungen im Werk Bernhards aufzuzeigen. Aufgrund der Ergebnisse aus dem ersten Teil erweisen sich einzelne Texte dabei als klare Wendepunkte in der kontinuierlichen Entwicklung des scheinbar so monolithischen Bernhardschen Gesamtwerks. Dessen präzise Periodisierung ermöglicht eine konkrete kontextuelle Verankerung weiterer Werke des Autors und kann somit als praktisches Instrument für ein differenziertes Verständnis derselben herangezogen werden.
Anne Thill studierte an der Universität Heidelberg Germanistik und Italienisch und wurde dort im Herbst 2010 mit der vorliegenden Arbeit promoviert. Rezension
Kein Autor hat nach dem Zweiten Weltkrieg die österreichische Öffentlichkeit so sehr polarisiert und Literatur so in den Focus der Öffentlichkeit gerückt wie Thomas Bernhard. Der in den Niederlanden als uneheliches Kind geborene österreichische Schriftsteller (1931 - 1989) zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er beschäftigte sich zunächst wesentlich mit Lyrik, wechselte dann aber zu Prosa und Drama. Sein Grundgefühl, ungeborgen und ungeliebt zu sein, manifestierte sich auch in ungezügelter Kritik monologischer Tiraden gegen jedermann, insbesondere gegen den "katholisch-nationalsozialistischen" Staat Österreich. - Die Kunst, die Komik und das Erzählen sind im Werk Thomas Bernhards sowohl aus inhaltlicher als auch aus erzähltechnischer Sicht von großer Bedeutsamkeit. Die vorliegende Arbeit untersucht jene scheinbar leicht verständlichen, in ihren tatsächlichen Bedeutungsdimensionen aber schwer zu erfassenden Begriffe sowohl einzeln als auch in ihrer komplexen Verflechtung untereinander: Im Mittelpunkt stehen dabei Bernhards Künstlerfiguren und ihr Verhältnis zur Kunst sowie die Art ihrer Darstellung durch den Autor bzw. seine bislang in ihrer Relevanz verkannten Erzählerfiguren. Damit verbunden ist eine sorgfältige Analyse der vielfältigen Komik und der bislang oftmals unterschätzten hochkomplexen Selbstreflexivität der Texte, die in engem Zusammenhang steht mit ihrer Erzählweise. Mit philologischer Detailarbeit und einer ausgeprägten Sensibilität für sprachliche und dramaturgische Feinheiten werden 15 Dramen und Prosawerke Bernhards ausführlich und konsequent textimmanent interpretiert. Damit leistet die Arbeit nicht nur Wesentliches auf dem Gebiet der Interpretation; sie lenkt darüber hinaus auch den Blick auf allmähliche inhaltliche wie formale Veränderungen im Bernhardschen Gesamtwerk und ermöglicht so eine präzise Periodisierung desselben. Die Autorin Anne Thill studierte an der Universität Heidelberg Germanistik und Italienisch und wurde dort im Herbst 2010 mit der vorliegenden Arbeit promoviert.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
Theoretische Vorbetrachtungen 11 I Kunst, Künstlerfiguren, Erzählerfiguren 11 1.1 Kunst und Künstler 11 1.2 Bernhards Erzähler 14 II Komik und Ernst, Ironie und Humor 17 II.1 Zur Erforschung des Komischen im Allgemeinen und m Bezug auf das Werk Bernhards 17 11.2 Das Komische und der Ernst 20 11.3 Ironie und Humor 28 II.3.a Die Ironie als „ein Ernst, der in Frage gestellt wird" 28 II.3.b Der Humor als ,nicht ernst genommener Ernst'35 Teil I: Textinterpretationen 43 1 Frost (1963) 44 I Erzähltechnik und Erzählerfigur 44 1.1 Der Famulus: Medium zwischen dem Maler Strauch und dem Leser sowie Protagonist 44 1.2 Entwicklung des Famulus' 47 1.2.a „ungeheuere Faszination" 48 I.2.b Devotion 49 1.2.c Selbstentfremdung 49 I.2.d Erschöpfung und drohender Selbstverlust 51 I.2.e Allmähliche Loslösung 54 1.2.f Selbstbefreiung 56 II Annäherung an den Maler Strauch 58 II. l „keine Künstlergedanken mehr": Gegenwart und Spuren der Vergangenheit 59 II.2 Strauchs Sprache 62 II.2.a „meine Poesie" 62 II.2.b Reden, um zu existieren 63 II.2.C Bilder-Sprache 65 II.2.d Strauch: Sprachschöpfer und Sprachfigur 67 II.2.e Gesuchte Irritation: Sprache als Distanzierungsmittel 69 II.3 Theatralik: Strauch als blasphemischer Rollenspieler 70 II.4 Widersprüche und Entsprechungen 73 II.4.a Pascal: Selbstirritation 73 II.4.b „Dauerzustand der Täuschung": Pathologischer Selbstverlust und selbst-bewusstes Kalkül 75 II.4.c Warten „auf das Ende" und vitaler Hochmut 77 II.4.d Landschaft als Zuflucht und Todeszone 78 II.4.e Strauch: Macht und Überlegenheit 81 II.4.f Strauch: Ohnmacht und Abhängigkeit 82 III „ungeheures Gelächter" in Strauchs „Komödientragödie" 83 2 Das Kalkwerk (1970) 88 I Vorbemerkung: Zur Erzählweise und Interpretierbarkeit des Texts 88 II Konrad 93 11.1 Ambivalente Persönlichkeitsstruktur 93 11.2 Das Kalkwerk: ambivalenter „Verfinsterungsort" 95 11.3 „Nur diese Studie!": Die Studie als Lebensaufgabe und -zweck 97 II.3.a Rücksichtslosigkeit der „urbantschitschen Methode" 99 II.3.b „die Studie einfach aufschreiben": Die Niederschrift als selbstkonstituierender Akt 101 II.3.C Die Studie als erlösendes „Kunstwerk" 103 11.4 Warten auf den „idealen Moment" als endloses Kreiseln um eine leere Mitte 104 11.5 „nur noch Experimentalsätze": Das Experiment als letzte Dasemsmöglichkeit gegen die „Irritation" 108 11.6 Störfaktoren gegen die Studie 110 II.6.a Störungen von außen: „Abertausende von Winzigkeiten" 110 II.6.b Störungen von innen: Konrads „Verzögerungstaktik" 111 11.7 „in jedem Falle falsch": geleugnete Selbsterkenntnis 113 11.8 „in eine Falle gegangen": gewaltsamer Trotz und grotesk triumphales Scheitern 114 III Parodistische und ironische Brechungen 116 111.1 Ridikülisierung romantischer Motive bei der Künstlerdarstellung 117 111.2 Selbstironische Distanzierung des Autors von der geschilderten Problematik 119 IV Komik 121 IV.1 Komische Bilder, Äußerungen und Handlungen 122 IV.2 Stilistische Auffälligkeiten 123 IV.3 Sprachkomik 125 IV.4 Komödienartige Szenen und Elemente 126 IV.5 Zum Verhältnis von Ernst und Komik 128 3 Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972) 131 I Kunst und Leben 131 1.1 Künstlertum als „Mechanismus" 131 1.2 Leben als theatralisches Rollenspiel 132 II Annäherung an die Königin 133 11.1 Die Perspektiven von Doktor und Vater: Ignoranz und Wahnsinn 134 11.2 Auftritt der Sängerin: Konstruktion und Demontage einer Königin 137 II.2.a Hingabe an die Künstlichkeit 137 II.2.b Zunehmende Erschöpfung 140 II.2.C Zelebrierte Dekadenz 141 III Komik? 143 III.1 Gelächter 144 III.1.a Sardonisches Lachen 144 Ill.l.b Auslachen als lustvolle Projektion 145 III.2 Spiegelreflexe 145 III.2.a (Kalkulierte) Komik auf der wirkungs- bzw. rezeptionsästhetischen Seite des Stücks 145 III.2.b Kritik an mechanisiertem Künstlertum und passivem Kunstkonsum im artifiziellen Sprachkunstwerk 147 4 Die Macht der Gewohnheit (1974) 150 I Die Kunst 150 1.1 „Das Cello / und die Peitsche": Caribaldis autoritäre Macht und monomanische Zielfixiertheit 150 1.2 „Du mußt die Viola spielen / wie du auf dem Seil tanzt": Kunst und Mechanik 154 1.3 „Morgen Augsburg": die Perpetuierung der Vorbereitung 157 II Komik 160 11.1 Unheimlichkeit und Lächerlichkeit 160 11.2 Caribaldis Sprache 163 11.3 Nonverbale Äußerungen 168 II.3.a Gestik 169 II.3.b Gelächter 171 III Das Verhältnis zwischen Form und Inhalt als Hinweis auf die Ironie Bernhards 173 5 Korrektur (1975) 177 I Roithamer 178 I.1 Persönlichkeit 178 I.1.a Hochbegabter Perfektionist, einsamer Exzentriker, selbst- bewusster Solipsist l78 I.l.b „Entwicklung auf den Kegel hin" als „Mechanismus" des Trotzes 182 1.2 Der Kegel 185 1.2.a Der Kegel als Symbol des Protests und der Selbstverwirklichung 185 I.2.b Kunst und Natur 189 I.2.C Höller: Inspiration und Zuflucht 190 I.2.d Der Kegel als Entsprechung der Schwester und als (fragwürdiges) Monument der Liebe 193 1.2.e Idealisierung und Instrumentahsierung der Schwester 194 1.2.f Der Tod der Schwester als Vollendung des Kegels: Roithamers Gedankenkorrektur 198 1.3 Roithamers Studie „ Über Altensam und alles, das mit Altensam zusammenhängt, unter besonderer Berücksichtigung des Kegels" 203 1.3.a Roithamers Studie als „Auflösung von Altensam" 203 I.3.b Die Studie als Versuch einer grundlegenden Selbsterforschung und als Mittel zur nachdrücklichen Selbstinszenierung 205 1.4 Konsequenz radikaler Infragestellung: Totale „Korrektur der Korrektur der Korrektur der Korrektur" 208 1.5 Roithamers Sprache: „Formulierungskunst" und Sprachzerfall 215 1.6 Komik I: Roithamer: Existentieller Verfall und punktuelle Lächerlichkeit 221 II Der Erzähler 225 II.1 Annäherung an Roithamers Nachlass in der Dachkammer: „todesmutiges Unternehmen" 225 II.2 Scheu vor der Konfrontation mit dem Nachlass 228 Il.Z.a Sprache des Erzählers 228 II.2.a.l Erster Teil des Romans: Unordnung und `Fehler´ 228 II.2.a.2 Zweiter Teil des Romans: Der Erzähler als Präparator der Roithamerschen Studie 237 II.2.a.3 Zwischen Distanzierung und Identifizierung: Ambivalente Erzählhaltung im Spannungsfeld von Textstruktur, Inhalt und (graphischer) Form 240 II.2.b Verhalten des Erzählers 244 II.2.b.l „in größter Unruhe": Verlegenheit und Unsicherheit 245 II.2.b.2 „diese Nacht überstehen": Zweifel und Steigerung der Nervosität 247 II.2.b.3 Komik II: Die „fürchterliche Unruhe" des Erzählers als groteskes (Dach-)Kammerspiel 249 III Zur Modernität des Romans: Das Dilemma der Kunst - und Bernhards Befreiung daraus 255 111.1 Roithamers Kunstauffassung: Totalitätsstreben und „Irrtum" 255 111.2 Bernhards Ironie 262 III.2.a Poetologische Selbstreflexion und souveräne Loslösung Bernhards von der dargestellten Problematik 262 III.2.b Metatextuelle Elemente als Ansatz zu einem kritischen Hinterfragen der Interpretenrolle 268 III.2.C Zunahme ironischer Elemente als Merkmal einer Korrektur in Bezug auf Bernhards Gesamtwerk 272 III.3 Schluss-Sätze: Schnittpunkt der Perspektiven und Kulminationspunkt des Romans 273 III.4 Offenheit des Romans als Merkmal seiner Modernität 277 6 Die Berühmten (1975) 282 I Kunst und Künstlertum 282 1.1 „Berühmt sein / das ist es". Die Kunst als Mittel zu Ruhm, Luxus und Macht 282 1.2 Demonstrative Selbstinszenierung - Unbewusste Selbstentblößung 283 1.3 Puppen und Porträts: künstlerische Vorbilder als entmenschlichte Statussymbole 288 1.4 Die Berühmten als allegorische Endzeit-Satire 289 II Bemerkungen zur Form des Stücks: Vom Grotesk-Traumartigen zum Lächerlich-Absurden 291 III Komik 293 III. l (Kalkulierte) Komik auf der rezeptions- und wirkungs-ästhetischen Seite des Stücks 293 111.2 Befremdliche Groteske vs. plakativer Klamauk 295 111.3 Ironie und Selbstironie 296 IV Verortung von Die Berühmten im Gesamtwerk Bernhards 298 7 Minetti(1975) 299 I Minetti: Schauspielkunst als Existenzkunst 299 1.1 „immer in die entgegengesetzte Richtung": Selbstdarstellung und Selbstinszenierung 299 1.2 Die Lear-Maske: totaler Rückzug in die Rolle 301 1.3 „Ein komischer Herr": Sprache und Erscheinungsbild Minettis 303 1.4 „undalles ist nichts als ein Irrtum": Erkenntnis und Konsequenz 304 1.5 Minettis Publikum: Fluch und Notwendigkeit 309 II. „eine Tragödie / oder eine Komödie" 313 11.1 Inhaltliche Komik: Minettis Erscheinung, Handeln und Reden 313 11.2 Ironische Form 315 III Minetti als Exempel für die interne Vernetzung von Bernhards Gesamtwerk 318 8 Über allen Gipfeln ist Ruh. Ein deutscher Dichtertag um 1980 (1981) 321 I „emporgehoben in die höchste Höhe": Moritz Meister und seine Frau 321 1.1 Selbstinszenierung und gegenseitige Inszenierung 321 1.2 Unbewusste Selbstentblößung: Entlarvung durch unbedachtes Sprechen bzw. Schweigen 324 II Kritik und Komik 328 II.1 Moritz Meister als lächerliche Karikatur 329 II.2 Ironische Spiegelung des Publikums 333 II.3 Selbstironie und Selbstparodie 335 III Position des Stücks in der Entwicklung von Bernhards Gesamtwerk 337 9 Beton (1982) 339 I Rudolf und das Ringen um die Mendelssohn-Studie 339 1.1 Die Schwester: „rettender Engel" und „Vernichterm" 340 1.2 „ich bilde mir das noch heute ein": Selbsterkenntnis vs. Sturheit 342 1.3 Palma: die hinausgezögerte „Rettung" 345 II Komik 346 11.1 Unbewusste Komik in Rudolfs Notizen 347 11.2 Komische Theatralik - theatralische Komik: Rudolfs „Komödie" 350 11.3 Rudolfs „Selbstgelächter" als unbewusste Reaktion und bewusste Bewältigungsmethode 354 11.4 „Wir können in jedem Augenblick umkippen": die befreiende Macht literarischen Humors bei Rudolf und Bernhard 356 III Rudolfs Weg zum Schreiben 359 111.1 Erinnerung an Anna Härdtl - und die Folgen 360 111.2 Angst vor dem Schreiben - Schreiben gegen die Angst 363 111.3 „wir selbst sind gar nicht so unglücklich, wie wir glauben, wir haben ja eine Geistesarbeit": Projektion der Studie als lebenserhaltende Maßnahme 365 111.4 „Anstatt über Mendelssohn, schreibe ich diese Notizen": Selbstbefreiung durch Schreiben 369 111.5 Weil die „Notizen"„mehr sind": Veröffentlichung als Ziel des Schriftstellers Rudolf 371 IV Position von Beton im Hinblick auf die Entwicklung von Bernhards Gesamtwerk 373 10 Der Schein trügt (1983) 376 I Zwei Brüder: Ähnlichkeiten und Kontraste 376 1.1 Robert: „Leidenschaft ist es nie gewesen" 377 1.2 Karl 379 1.2.a „berübmtsein / aufsehenmachen / der einzige sein": Kunst als Rettung und Protest 380 1.2.b „etwas ganz anderes": Artistik vs. Schauspielkunst 381 1.2.c Der „Lyoneffekt" als Basis für Karls Selbstbild 382 II Mathilde 384 11.1 Mathilde und Karl: eine „Schicksalsgemeinschaft" 384 11.2 Mathilde und Robert 386 11.3 Mathildes Testament: postume Rache 388 III Leere nach dem Tod Mathildes 389 III.1 Angesichts der Leere: Zwietracht und Zweisamkeit 390 III.2 Umgang mit der Leere 392 III.2.a Robert: wehmütiges Erinnern und Resignation 392 III.2.b Karl: „Existenzchoreographie" 394 III.3 Am Ende: perpetuierte Irritation 399 IV Komik 402 IV.1 Situative und sprachliche Komik 402 IV.2 Tragikomik 408 V Ironie und Selbstironie 411 VI Position von Der Schein trügt im Gesamtwerk Bernhards: Kohärenz und Innovation 413 VI.1 Tragikomisch-ironische Parabel über das Versagen der Kunst als Methode der Existenzbewältigung 414 VI.2 Unterwegs zum Humor 416 11 Der Untergeher (1983) 420 I Glenn Gould 421 1.1 „Musik / Besessenheit / Ruhmsucht / Glenn": Das Genie Glenn Gould 421 1.2 „Im Grunde wollen wir Klavier sein": die Unheimlichkeit des Genies 423 II Wertheimer 427 11.1 „tödlich getroffen von Glenns Goldbergtakten": das Scheitern am Genie 428 11.2 Die Schwester: „auslösendes Moment" 429 11.3 „in dieses sein Scheitern verhöhn": Wertheimer als williger Untergeher 431 III Der Erzähler 437 III.1 „wir sind die Gescheiterten" vs. „Ich habe umgedreht": die „kleine Kehrtwendung" des Erzählers 437 III.2 Schreiben und Vernichten der „Glennschrift": selbstbefreiende Demontage des Genies 440 III.3 Das Zurecht-Schreiben des „Verheimlichungsgenie[s]" 443 III.4 „ich wollte immer nur ich seihst sein": Kreative „Selbstzerstörung" als Versuch einer Selbstbestimmung ex negative: 448 III.5 „so schnell als möglich nach Traich": „Neugierde" vs. Furcht 451 IV Der offene Plattenspieler: Ende und Anfang der rettenden Schrift 456 V Der Autor und die Erzählerfigur in der Entwicklung des Gesamtwerks: Instrumentahsierung von Komik im Dienste von Ironie und Selbstironie 460 V.1 Ironie 461 V.2 Selbstironie als Befreiungsmöglichkeit Bernhards 468 12 Holzfällen. Eine Erregung (1984) 471 I Der schreibende Ich-Erzähler 472 1.1 „eine für mich ideale Entwicklung": Joana, das Ehepaar Auersberger und Jeannie Billroth als Mentoren für die künstlerische Selbstwerdung des Erzählers 472 1.2 „ich verachte sie und ich hasse sie": Misanthropie statt „lebenslängliche Dankbarkeit" 476 1.3 „in die Falle [] hineingegangen": zunehmende „Erregung" 478 1.4 Strategien gegen die „Erregung": Provokation aus sicherem Abstand 480 II Komik 483 11.1 Sprachliche Auffälligkeiten 483 11.2 Holzfällen als Komödie in Prosa 486 III Die Anwesenheit des Schauspielers als ,Stück im Stück': Wendepunkte in der Perspektive des Erzählers 492 IV Der Blick in den Spiegel: Selbsterkenntnis und Selbstkritik des Erzählers 496 V Die „Wahrheit" des „Schriftstellers" 501 V.1 „um uns aus ihnen zu erretten": Das Schreiben als Versuch, der „Erregung [] Herr [zu] werden"502 V.2 Schreiben als Holzfällen 504 V.3 Der Roman als rettende Schrift des Erzählers 508 V.4 Die „Erregung" als Anregung für die Schrift des Erzählers 512 VI Der doppelte Humor von Holzfällen 516 VI.1 „ich amüsierte mich über diesen Gedanken": Distanz zu sich selbst als Ausdruck vom Humor des Erzählers 517 VI.2 Rettung durch die „nicht ernst genommenen ernsten Gedanken": Selbstironie und Selbstparodie als Ausdruck vom Humor Bernhards 519 13 Der Theatermacher (1984) 524 I Der Theatermacher Bruscon und die Kunst 524 1.1 „Shakespeare / Voltaire / und ich": Persönlicher Geltungsdrang und künstlerisches Sendungsbewusstsein 524 1.2 „eine einzige Absurdität": Schauspielerexistenz und Existenzschauspiel 527 1.3 „Hohe Kunst / ist ein fürchterlicher Prozeß": Märtyrertum, Despotismus und subtiler Widerstand 530 II Komik 535 11.1 „Ein gewisses theatralisches Talent": Bruscon als komische Figur 536 11.2 Bruscon und Caribaldi 545 11.3 Die Fixierung auf das „Notlicbt": doppelbödige Komik 548 III „eine Komödie []/ in der alle Komödien enthalten sind / die jemals geschrieben worden sind": Der Theatermacher in der Entwicklung des Gesamtwerks: Selbstreflexivität und Humor 551 14 Alte Meister. Komödie (1985) 559 I Reger 559 1.1 Regers Werdegang zum „ausübende [n] und schöpferische [n] kritische [n] Künstler" 560 1.2 „ich und meine Frau": Regers eigenwillige Art der „Liebe" 562 1.3 Angesichts der „fürchterliche[n] Leere": „Deprimation" und Rettung 565 1.4 „von diesen sogenannten Alten Meistern alleingelassen": Regers Absage an die Kunst 570 1.5 „das Höchste und das Widerwärtigste gleichzeitig": Regers ambivalentes Verhältnis zur Kunst 572 1.6 Regers Entwicklung von der „künstlerischen Lebensenttäuschung[]" hin zur „ Überlebenskunst" 574 1.7 „Kein Werk in diesem Museum ist fehlerfrei": Beruhigung und „Überlebenskraft" durch radikale Demontage der Alten Meister 576 1.8 „beinahe alles zunichte gemacht": Die Ausnahme des Weißbärtigen Mannes 583 1.9 Fazit: „Kunstwahnsinn irreparabler": Regers (Über-) Leben mit der und durch die Kunst 591 II Komik 595 II.1 Die Komik karikierender Scheltreden 595 II.2 „die ungeheure Befreiung unseres ganzen Systems": Regers Entwicklung hin zum Humor 600 III Alte Meister als „ Werk" Atzbachers als Werk Bernhards 605 111.1 Die Prägung des „Schriftsteller[s]" Atzbacher durch den „Gedankenvater" Reger 606 111.2 Alte Meister als Komödie in Prosa 609 111.3 „Die Vorstellung war entsetzlich": Selbstreflexivität des Romans durch metatextuelle humorvolle Selbstironie 613 15 Einfach kompliziert (1986) 620 I Der alte Schauspieler 620 1.1 „Ein Komplott zuerst gegen die Eltern / dann gegen die Ändern": Erinnerte Vergangenheit und gegenwärtige Leere 621 1.2 „Redezwang unausgesetzter": Gegen die Leere anspielen 623 1.3 „Wir dürfen nicht an die theatralische Kunst denken, wenn wir spielen": das Spiel und die störende Interferenz des Bewusstseins 627 1.4 „Der gegangene Weg / das ist es": unruhige Stagnation 631 II Komik 638 II.1 Sprachliche und gestische Komik 639 II.2 Ironische, selbstironische und selbstparodistische Komik als Merkmal einer humorvollen Schreibhaltung Bernhards 640 III Einfach kompliziert als Spätwerk Bernhards 642 Teil II: „immer das gleiche / nie dasselbe / jedesmal völlig anders" Konstanz, Kontinuität, Differenz: Entwicklungslinien im Werk Thomas Bernhards 644 I Konstanz und Wiederholung 647 II Differenz und Entwicklung 651 II.1 Darstellungsweise 652 II.2 Haltung und Zielsetzung 667 II.3 Inhaltlich-Thematisches 678 III Entwicklungsabschnitte im Werk Bernhards 685 IV Fazit: das „einzige Werk" Bernhards und seine „ununterbrochen] unmerklich[" Entwicklung 699 Bibliographie 704 I Verzeichnis der zitierten Werke Thomas Bernhards und der benutzten Kürzel 704 I.1 Textkorpus der vorliegenden Arbeit 704 I.2 Weitere zitierte Werke Bernhards 705 II Sekundärliteratur 706 11.1 Sekundärliteratur zu Thomas Bernhard 706 11.2 Weitere Sekundärliteratur 726 III Wörterbücher und Nachschlagewerke 730 Weitere Titel aus der Reihe EPISTEMATA - Würzburger Wissenschaftliche Schriften |
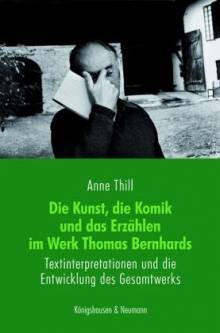
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen