|
|
|
Umschlagtext
Das frühchristliche Baptisterium des Lateran ist berühmt als Stiftung Kaiser Konstantins des Großen und erster Taufort der römischen Christenheit – die barocke Ausmalung aber hat bisher kaum wissenschaftliche Beachtung gefunden. 1624 hatte Papst Urban VIII. hochkarätige Künstler wie Gianlorenzo Bernini und Andrea Sacchi für das ehrgeizige Restaurierungsprojekt engagiert, das 25 Jahre in Anspruch nehmen sollte. Das komplexe visuelle Programm verhandelt eine der wichtigsten Legitimationstraditionen des Papsttums: die angeblich an diesem Ort durch Papst Silvester vollzogene Taufe Konstantins. In einer interdisziplinären Analyse geht die vorliegende Arbeit der Entwicklung dieses römischen Gründungsmythos ebenso auf den Grund wie seiner künstlerischen und liturgischen Wiederbelebung im 16. und 17. Jahrhundert. Als erste umfassende Monographie zur barocken Bau- und Ausstattungsgeschichte des Lateranbaptisteriums stellt sie zudem eine neue Deutung vor, nach der sich einst der frühchristliche Raum, die erzählenden Malereien und österliche Konvertitentaufen zu einem Gesamterlebnis konstantinischer Vergangenheit verbanden.
Rezension
Seit der Zeit Konstantins ist der (heute zum Vatikan gehörende) Lateran in Rom der offizielle Sitz der Päpste. Zum Lateran gehören die Päpstliche Lateranbasilika San Giovanni in Laterano als kirchenrechtlich bis heute bedeutendste Kirche der Römischen Weltkirche und also bedeutender als der Petersdom, das dazugehörige antike Baptisterium, die Reste des mittelalterlichen Papstpalastes mit der Scala Santa, der Papstkapelle Sancta Sanctorum und dem Leonischen Triclinium sowie dem Lateranpalast aus dem 16. Jahrhundert und dem größten Obelisken Roms. Die Lateranbasilika ist die Kathedrale des Bistums Rom und eine der sieben Pilgerkirchen. Ihr Baptisterium als heute achteckiger Zentralbau ist eines der ältesten erhaltenen Baptisterien aus dem 4. Jahrhundert und gilt als Prototyp aller Baptisterien. Es wurde um das Jahr 315 von Konstantin vermutlich ursprünglich rund errichtet und in den Jahren 432 bis 440 unter Sixtus III. zu einem Oktogon umgebaut. Oktagon (Achteck) ist in der Architektur ein Zentralbau mit einem Grundriss in Form eines regelmäßigen Achtecks. Das Achteck hat seit der Antike eine symbolische Bedeutung, die auf das Urbild des achtstrahligen Sterns zurückgeht und für Vollkommenheit steht. Der hier anzuzeigende voluminöse und großformatige Band beschäftigt sich mit der die barocken Ausmalung, mit der 1624 Papst Urban VIII. hochkarätige Künstler wie Gianlorenzo Bernini und Andrea Sacchi engagiert hat.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG 15
Das Lateranbaptisterium – Forschungslage und Problemstellung 16 Methodische Besonderheiten und Begriffe 19 Bemerkung zur Gliederung der Arbeit 21 TEIL A KONSTANTINSMYTHOS 2 ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DES RÖMISCHEN KONSTANTINSMYTHOS 25 2.1 DIE TAUFE KONSTANTINS IN DER SCHRIFTLICHEN ÜBERLIEFERUNG 25 Die problematische Taufe Konstantins in Nikomedien und ihre Verarbeitung bei Eusebius von Cäsarea 26 Die Actus Silvestri und ihre Rezeptionsgeschichte 29 Mittelalterliches Konstantinsbild und Konstantinische Schenkung 30 Konstantinsüberlieferung und Kreuzverehrung im Mittelalter 31 Kritik an der römischen Konstantinstaufe in Humanismus und Reformation 32 Die Taufe Konstantins im neuzeitlichen Italien 33 Konstantin und die nachtridentinische Frömmigkeit – existiert eine volkstümliche Rezeptionsweise? 35 2.2 DER LATERAN ALS KONSTANTINISCHE ERINNERUNGSTOPOGRAPHIE 38 Konstantinische Stiftung und Herausbildung einer konstantinischen Identität im Lateran 38 Konstantinsmemoria in den Artefakten des Lateran 40 Konstantinsmemoria und Zeremoniell im Lateran 45 Die Inszenierung des Lateran als konstantinische Erinnerungstopographie durch Pilgerführer und Beschreibungen 47 2.3 DIE WIEDERBELEBUNG DER KONSTANTINSMEMORIA IM 16. UND 17. JAHRHUNDERT 48 Baumaßnahmen im Lateran zur Reaktivierung der Konstantinsmemoria 49 Der Vatikan als Ausgangspunkt neuer Darstellungskonventionen zu Konstantin 61 Nachtridentinische Konstantinszyklen in Rom 65 Konstantinsikonographie im Barberini-Pontifikat71 TEIL B DAS LATERANBAPTISTERIUM UNTER URBAN VIII. 3 DIE RESTAURIERUNG DES BAPTISTERIUMS 87 3.1. BAU- UND BEDEUTUNGSGESCHICHTE DES LATERANBAPTISTERIUMS 87 Der konstantinische Bau 91 Der Sixtinische Bau 93 Erweiterung des Baptisteriumskomplexes von Hilarus bis Johannes IV. 94 Neuzeitliche Baugeschichte des Lateranbaptisteriums 96 Der Zustand des Lateranbaptisteriums vor der Barberini-Restaurierung 101 3.2. DIE RESTAURIERUNG: CHRONOLOGIE, PERSONAL UND AUFTRAGGEBERSCHAFT 105 3.2.1. Chronologie der Restaurierungen 105 Die Visitation im April 1624 105 Chronologie der Restaurierungen 106 3.2.2. Auftraggeberschaft und konzeptuelle Verantwortung: Urban VIII. oder Francesco Barberini 109 Personalien der Restaurierungskampagne 110 Rückschlüsse auf die Auftraggeberschaft 113 3.3. SCHWERPUNKTE DER RESTAURIERUNG 113 3.3.1. Aspekte der Restaurierung 114 Berninis Anteil an der Restaurierung - Kuppel und Kapitelle 114 Die Entscheidung gegen eine Orgel in S. Giovanni in Fonte 117 Das Taufwannenziborium 118 3.3.2 Die Restaurierung als Evokation eines Kaiserlichen Badezimmers? 121 Das Labrum als Taufwanne Konstantins 121 ‚Ornato et instaurato Constantini lavacro‘ – Die Barberini Restaurierung als Evokation eines kaiserlichen Badezimmers? 122 4 URBAN VIII. ALS AUFTRAGGEBER 135 4.1. KARDINALAT UND PONTIFIKAT 135 Ausbildung und Kardinalat Maffeo Barberinis 135 Das Pontifikat Urbans VIII 136 4.2. SCHWERPUNKTE UND STRATEGIEN DER KUNSTFÖRDERUNG URBANS VIII. 138 Voraussetzungen des Mäzenatentums Urbans VIII. 138 Florenzbezug 139 Betonung nachtridentinischer Ideale in der Ausstattungspraxis 139 Interesse am Frühchristentum und Sichtbarmachung heilsgeschichtlich bedeutsamer Orte 141 Performative Vergegenwärtigung der Gedächtnisorte 143 Das Konzept der „religiosa magnificentia“ 144 Barberini-Ikonographie als performative Inszenierung: die hic domus-Imprese und der Anbruch eines goldenen Zeitalters 146 Die „seconde renaissance romaine“ als programmatische Stiloption 147 Politische Ikonographie der 30er Jahre und Antikenrezeption 149 5 DIE AUSSTATTUNG 159 5.1. ANDREA SACCHI – LEITER DER AUSSTATTUNGSARBEITEN IM LATERANBAPTISTERIUM 159 Zur Bewertung von Sacchis OEuvre in der Kunstliteratur 165 Andrea Sacchi als Regisseur innovativer Raumkonzepte und ephemerer Inszenierungen 167 5.2. CHRONOLOGIE DER AUSSTATTUNG 168 Die Bewertung der Baptisteriumsausstattung in der Kunstliteratur 168 Chronologie der Ausstattung 169 Finanzielle Schwierigkeiten und Sacchis ‚comodità‘ 171 Sacchis Künstlermannschaft: Gimignani, Camassei, Magnone, Maratta 172 Die Frage nach dem Autor des Programms 178 5.3. DAS AUSSTATTUNGSPROGRAMM UND HISTORISCHE AUTHENTIZITÄT 178 Geistesgeschichtlicher Hintergrund: Nachtridentinische Zielsetzungen in Bildertheologie und Kunsttheorie 178 5.3.1. Die Freskenausstattung 183 Bemerkung zur Ausstattungsoption Fresko 183 Zustand der Fresken im Lateranbaptisterium, Restaurierungen 186 Beschreibung der Ausstattung und erste formale Analyse 189 5.3.2. Der Konstantinszyklus 203 Die Frage nach den Vorbildern 203 Giacinto Gimignani: Kreuzvison 208 Andrea Camassei: Maxentiusschlacht und Triumph Konstantins 213 Kreuzvision, Schlacht und Triumph als ‚Triumph-Triptychon’ 219 Antikes und christliches Rom als typologische Beziehung? 221 Andrea Sacchi/Carlo Maratta: Die Zerstörung der Götzen/Triumph des Kreuzes222 Andrea Sacchi/Carlo Magnone: Die Verbrennung der Libellen auf dem Konzil von Nizäa 227 Die Zerstörung der Götzen/Triumph des Kreuzes und die Verbrennung der Libellen als Szenen einer institutionalisierten Kirche 230 Politische Aktualität im Konstantinszyklus 231 5.3.3. Historische Authentizität im Konstantinszyklus 233 Die Textquellen des Konstantinszyklus – „buoni“ oder „apocrifi“? 233 Bemerkungen zur Antikenrezeption – was ist „historische Angemessenheit/Korrektheit“? 234 Konstantin für idiotae und Connaisseurs: Zielgruppen des Ausstattungsprogramms 235 Historische Authentizität als bildinternes und bildexternes Argument des Konstantinszyklus 236 5.3.4. Die Fresken der Oberen Wandzone 238 Die Medaillenserie 238 Konstantinische ‚liberalitas‘ und Barberini- ‚magnificenza‘ 241 Das Spiel der Putten 242 Fazit zur historischen Authentizität unter Miteinbezug der oberen Wandzone 244 5.4. DAS FRESKENPROGRAMM IM KONTEXT DER TAUFE 244 Kreuzverehrung und christliche Archäologie im späten 16. und 17. Jahrhundert 245 Zur Bedeutung des Kreuzes im Lateranbaptisterium 246 Konstantinszyklus und Taufe 248 Historische Dimension eines Übergangs von einer Roma antica zur Roma nuova 248 TEIL C TAUFLITURGIE 6 DIE TAUFE 263 6.1. KONVERTITENTAUFEN ALS PROPAGANDISTISCHE INITIATIVE DER NACHTRIDENTINISCHEN KIRCHE 264 Taufen im Rahmen der römischen Juden- und Muslimenmission 264 Konvertitentaufen unter Urban VIII 266 6.2. ASPEKTE DER TAUF- UND SAKRAMENTSTHEOLOGIE 268 Paulinische Tauftheologie: Taufe als Teilhabe am Kreuztod Christi 268 Tauftheologie und –liturgie von Luther bis zum Konzil von Trient 269 Nachtridentinische Sakramentstheologie: ‚opus operatum‘ und Zeitdimension des Sakraments 270 6.3. TAUFIKONOGRAPHIE IM LATERANBAPTISTERIUM: DAS BAPTISTERIUM ALS TOR ZUR HEILSGESCHICHTE 270 Der Johanneszyklus 270 Positionierung in der Heilszeit: Taufe als neue Schöpfung und Perspektive auf die Endzeit 284 Die fingierten Bronzen 286 Zusammenfassung zur Zeitdimension des Programms 287 6.4. REAKTIVIERUNG DER FRÜHCHRISTLICHEN LITURGIE UND KONVERTITENTAUFEN IM LATERANBAPTISTERIUM 287 Frühchristliche Taufliturgie im Lateranbaptisterium 287 Rezeption der frühchristlichen Liturgie und Konvertitentaufen seit Gregor XIII 288 Konvertitentaufen im Lateranbaptisterium im 17. Jahrhundert 289 Zusammenfassung Taufliturgie 292 6.5. SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE INTERPRETATION DES PROGRAMMS 293 Das Taufritual unter gedächtnis- und ritualtheoretischer Perspektive 293 7 SCHLUSS 301 Rekapitulation der Ergebnisse 301 Zusammenfassende Schlussfolgerungen 303 Ausblick 304 ANHANG 8 QUELLEN 308 8.1. LIBER PONTIFICALIS I, 172–175 308 8.2. TABULA MAGNA, 1518 309 8.3. ONOFRIO PANVINIO: DE SACROSANCTA BASILICA BAPTISTERIOQUE LATERANENSI (LIBER TERTIUS) 309 8.4. GIOVANNI BAGLIONE: LE NOVE CHIESE DI ROMA, ROM 1639 310 8.5. RASPONI: DE BASILICA ET PATRIARCHIO LATERANENSI LIBRI QUATTUOR [] ROM 1656 311 8.6. VISITATIONSBERICHT – ASV, MISCELL. ARM. VII. 111 ACTA SACRAE VISITATIONIS APOSTOLICAE S.D.C. URBANI VIII., VOL. I 313 8.7. RECHNUNGSBÜCHER – ACL, MS. FFXX MISURE, CONTI E PAGAMENTI PER LA FABRICA DEL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI IN FONTE FATTA D’ORDINE DELLA FEL.ME: D’URBANO PAPA VIII, 1639–1645 315 8.8. BRIEF – BAV, OTTOBON. LAT. 3267, P.2 320 8.9. ROMA DESCRITTA DA BENEDETTO MELLINI – ACL A29 321 8.10. GUIDE DI ROMA – AUSWAHL 324 8.10.1. Erwähnung des Baptisteriums als Teil des konstantinischen Palastes 324 8.10.2. Erwähnung der Taufwanne als Utensil der Konstantinstaufe 326 8.11. LA SETTIMANA SANTA A ROMA 328 9 LITERATURVERZEICHNIS 331 10 ABBILDUNGSNACHWEIS 358 11 REGISTER 359 Personenregister 359 Orts- und Sachregister 364 Weitere Titel aus der Reihe Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte |
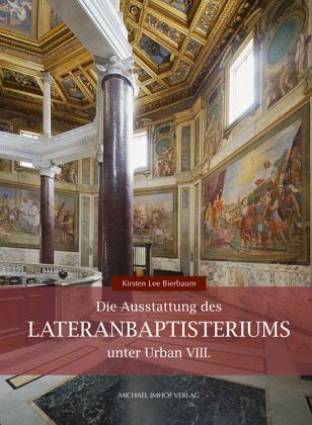
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen