|
|
|
Umschlagtext
Das Buch beschreibt den Weg der Evangelischen Kirche in Ostdeutschland vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Die weithin quellengestützte Darstellung behandelt in einer zeitlichen Abfolge wichtige Aspekte des Gesamtgeschehens: die geistliche und institutionelle Erneuerung der Kirche, den Abbruch volkskirchlicher Tradition unter dem Druck der ideologischen Diktatur, den theologischen und kirchenleitenden Um-gang mit sich wandelnden Situationen, das Ringen um die Einheit der Kirche im geteilten Deutschland, die wachsende Bedeutung der Ökumene und die zunehmend offene Aussprache in der Kirche, die der friedlichen Revolution zum Wort und auf den Weg verhalf.
Rudolf Mau, Jahrgang 1927, war Dozent des Kirchlichen Lehramtes für Kirchengeschichte am Sprachenkonvikt Berlin (1990/91 Kirchliche Hochschule Berlin-Brandenburg) und bis zu seiner Emeritierung 1992 Professor an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität. Ruldolf Mau hat vielfältige Arbeiten zur Theologie und Geschichte der Reformation, zum 19. Jahrhundert und zur Zeitgeschichte vorgelegt. Rezension
Es handelt sich bei diesem Buch aus der umfangreichen Reihe "Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen" um einen ebenso neu erschienenen wie auf eine jüngste kirchengeschichtliche Entwicklung eingehenden Band: die Darstellung der verfassten Ev. Kirche in der DDR; denn der freikirchliche Protestantismus kommt hier nicht wirklich in den Blick. Der ausgewiesene Verfasser schildert auch als Zeitzeuge den politischen Anpassungsdruck und die weltanschauliche Indoktrination in der DDR-Gesellschaft, die zu einem starken Abbruch der volkskirchlichen Situation führten. Zugleich aber bot die institutionell weitgehend autonom gebliebene Ev. Kirche in der DDR einen Schutzraum für offene Diskussion und entwickelte sich als Sprachrohr für Fragen nach Wahrheit und Menschenwürde in den 80er Jahren zunehmend zu einem Ausgangspunkt für den epochalen Wandel von 1989/90 und dem Mauerfall. Ein wichtiges Buch zum Verstehen jüngster kirchlicher Zeitgeschichte.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 11
Literaturverzeichnis 13 Kapitel 1: Sowjetische Besatzung und Neuordnung der Volkskirche. Ost-West-Konfrontation und wachsende Pressionen (1945-1952) 21 A Kontinuität und institutioneller Neubeginn 21 1. Erste Erfahrungen unter dem Besatzungsregime 21 2. Neue Landes- und Provinzialkirchenleitungen 21 3. Altpreußische Union und lutherisches Bekenntniskirchentum 25 4. Evangelische Kirche in Deutschland und „Kirchliche Ostkonferenz" 26 B Geistliche Orientierung und kirchliche Agenda 27 1. Das Mandat der Kirche: Geistliche Erneuerung 27 2. Kirchlicher Umgang mit der DC- und NS-Vergangenheit: „Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes" 28 3. Selbstverständnis und öffentliches Auftreten der Kirche 28 4. Kirche als Anwalt der Menschen in der Nachkriegsnot 29 5. Staat-Kirche-Verhältnis in den ersten Nachkriegsjahren 29 C Wachsende Spannung zwischen Staat und Kirche 1948-1951 31 1. Gesamtpolitischer Situationswandel 31 2. „Kirche" in der ideologischen Optik und politischen Praxis der SED 32 3. Konfrontationen im Vorfeld der ostdeutschen Staatsgründung 33 4. Staat-Kirche-Verhältnis in den ersten Jahren der DDR 36 5. Friedenswort der EKD 1950 und neue Konflikte 38 6. Berliner Kirchentag 1951: Entgegenkommen und harte Linie 39 D Konsolidierung des kirchlichen Lebens und Wirkens 40 1. Gesangbuch und Lebensordnung 40 2. Ausbildung für den kirchlichen Dienst 41 3. Kirchliches Mitarbeiterrecht 42 4. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse 43 Kapitel 2: Totalitäre Kulturrevolution. Angriff auf die volkskirchliche Tradition (1952-1961) 45 A „Aufbau des Sozialismus" und Kirchenkampf 1952/53 45 B Übergangsphase 1954/55 50 C Politischer und ideologischer Druck 1956-1958 55 1. Die Forderung politischer Loyalität 55 2. EKD-Synode 1956: „Raum für das Evangelium in Ost und West" 57 3. Staat-Kirche-Konfliktfelder 1956-1958 58 4. Staat-Kirche-Verhandlungen und die Erklärung von 1958 64 D Krisenjahre 1959-1961 67 1. Forcierung der sozialistischen Kulturrevolution 67 2. Geistliche Orientierung für das Leben in der DDR 69 3. Berlin-Ultimatum und kirchliche Reaktionen 73 4. Sozialisierungsterror auf dem Lande und wachsender Flüchtlingsstrom 74 5. Der „Staatsratsvorsitzende" Ulbricht. Milderung der Konfrontation 76 Kapitel 3: Die Mauer. Zeugnis und Dienst der schrumpfenden Kirche (1961-1969) 79 A Kirchliches Reagieren auf die Mauer-Situation 79 1. Kirchenleitung östlich der Mauer: Bischofsamt in Berlin-Brandenburg 79 2. Differenzierungskurs der SED: Der „Thüringer Weg" 81 3. Anleitung zu aktuellem Bekennen: „Zehn Artikel" und „Sieben Sätze" 82 B Wegsuche im DDR-Alltag 85 1. Minorisierung und konzeptionelle Überlegungen 85 2. Neue Gesetze. Gespräche zwischen Funktionären und Geistlichen 86 3. Theologie in staatlicher und kirchlicher Verantwortung. Reformationsjubiläum 1967 89 C Krise der EKD und Gründung des DDR-Kirchenbundes 92 1. Bekenntnis zur Einheit der EKD. Neue DDR-Verfassung. Erwartungen und Konfrontationen (1967/68) 92 2. Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR 97 Kapitel 4: Lernwege der Eigenständigkeit „im Sozialismus" (1969-1978) 102 A Kirchenverfassung und SED-Politik 102 1. Kirchenbund und EKD 102 2. Kirche der Union in „zwei Bereichen" 103 3. Regionalisierung des Bischofsamtes in Berlin-Brandenburg 104 4. Staatliche Anerkennung des Kirchenbundes und Ende der Ulbricht-Ära 105 B Zeugnis und Dienst der Kirche im SED-Staat 108 1. Synodale Verständigung zum Auftrag der Kirchen in der DDR 108 2. Erfahrungen des „Lernweges im Sozialismus" 112 3. Auf dem Weg zum „Zusammenwachsen" der ostdeutschen Landeskirchen 116 4. Kirchliche Wortmeldungen zu politisch-gesellschaftlichen Fragen 118 5. Kirchliches Bauen-Einlenken der SED? 121 C Situationswandel in Europa und das Signal von Zeitz 122 1. Das Helsinki-Abkommen 1975 und die Frage der Menschenrechte 122 2. Protest-Signal: Die Selbstverbrennung von Pfarrer Brüsewitz 124 3. SED-Interessenlagen - Verweigerung und Gespräch 128 D Staat-Kirche-Vereinbarungen von 1978 130 1. Zur Situation 1977/78 130 2. Das Spitzengespräch im März 1978 132 Kapitel 5: Friedenszeugnis und wachsende Öffentlichkeit (1978-1985) 137 A Bewegung auf der institutionellen Ebene 137 1. Auf dem Weg zur Vereinigten Kirche 137 2. Erwartungen und Erfahrungen nach dem „6. März" 139 3. Personenwechsel auf der Ebene kirchenpolitischer Verantwortung 140 B Frieden als Thema der Kirche 1978-1982 141 1. Militarisierung und kirchlicher Einspruch 141 2. Erwartung und Protest bei der Jugend 143 3. Kirchliche Verantwortung für Frieden und Verständigung 147 C Das Lutherjahr 1983: SED-Kulturpolitik und kirchliches Zeugnis 154 1. Konzeptionelle Vorbereitung auf Luthers 500. Geburtstag 154 2. Zum Verlauf des Lutherjahres 158 D Fragile Staat-Kirche-Beziehungen 1983-1985 159 1. Konfliktsituationen im Lutherjahr 159 2. Frieden, Umwelt, Ausreise als „Gruppen"-Themen 1984/85 160 3. Staat-Kirche-Verhältnis 1984/85 163 4. Kirchenbund und EKD 1979-1985 167 Kapitel 6: Gesellschaftliche Diakonie zur Friedlichen Revolution (1986-1990) 170 A Vergebliches Hoffen auf Fortschritt 1986/87 170 1. Kirchliches Drängen auf Wandel - Hinhalten bei der SED 170 2. Konfliktreicher Weg zum Berliner Kirchentag 1987 173 3. Bereitschaft zum Wandel? 175 4. Überwindung der „Abgrenzung"? Die Görlitzer Bundessynode 1987 176 B Wachsender Freimut und Konfrontationen 1987/88 178 1. Konflikt um den „Grenzfall" und die Zions-Umweltbibliothek 178 2. Protest bei der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 1988 und Reaktionen 180 3. Konfrontationen bei spannungsvollem Stillstand 181 C Die Kirche als Forum der Reformdebatte 1988/89 185 1. Ablösung Gysis und neuer Staatssekretär: Kurt Löffler 185 2. BEK-Synode Dessau 1988 und Erwägungen zur Führungsrolle der SED 186 3. Offene Worte, Konflikte und Repressalien 187 4. Staatliche Reaktionen auf kirchliches Reformverlangen 190 D Wachsender Protest. Der Zusammenbruch des SED-Staates 1989/90 192 1. Kommunalwahlen als Protestthema 192 2. Wachsender Ausreisedruck, Drohungen und brüchige Harmonie-Fassade 195 3. Machtverluste der SED: Scheiternde Unterdrückung von Protest und Dialog 198 4. Der Durchbruch zur Friedlichen Revolution 202 5. Phasen des Zusammenbruchs der SED-Herrschaft 205 6. Runder Tisch und Demokratisierung der DDR 208 Kapitel 7: Neuaufstellung im Zeichen der Einheit Deutschlands 211 A Deutschland als kirchliches Thema 211 1. Rückblick: Wandlungen der Deutschlandfrage 1945-1989 211 2. Der Parcours zur politischen Einheit 1989/90 213 B Rückkehr zur Einheit der Kirche 214 1. Berlin-Brandenburg: Ende der Regionalisierung 215 2. EKD: Reaktivierung der Mitgliedschaft 215 3. EKU: Aufhebung der Bereiche-Gliederung 217 4. VELKD: Neuformierung nach Auflösung der VELK/DDR 218 C Urteile über den Weg der Kirche und die neue Situation 219 1. Dominanz des Stasi-Themas. Neue „Vergangenheitsbewältigung" 219 2. Zur neuen Lage der ostdeutschen Kirchen 222 Zeittafel 223 Register 233 Weitere Titel aus der Reihe Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen |
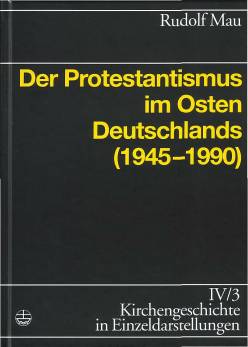
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen