|
|
|
Umschlagtext
Qualitätsentwicklung vollzieht sich in schulinternen Entwicklungsprozessen, die planvoll gesteuert werden müssen, um effektiv und nachhaltig zu sein. »Bessere Qualität in allen Schulen« stellt das standardisierte Steuerungsinstrument SEIS (Selbstevaluation in Schulen) vor, das Schulen dabei unterstützt, Entwicklungsarbeit zu evaluieren. Die hierbei gewonnenen Informationen decken die Befindlichkeiten und Wahrnehmungen aller an Schule Beteiligten auf: Sie zeigen, wo gemeinsame oder unterschiedliche Einschätzungen liegen, wo Stärken und Handlungsbedarfe gesehen werden - ein erster Schritt auf dem Weg zu einer besseren Schule.
Mit diesem Buch steht ein Praxisleitfaden als Hilfestellung zum erfolgreichen Durchlaufen der vier Phasen des SEIS-Projektzyklus zur Verfügung. Die schulische Selbstevaluation mit SEIS wird durch konkrete Bausteine zur Moderation von Verständigungs- und Entscheidungsprozessen sowie zur Durchführung von Datenerhebung, Dateninterpretation und Maßnahmenplanung unterstützt. Es werden Grundlagen, konkrete Arbeitsschritte, Handlungsempfehlungen, Techniken, anschauliche Praxisbeispiele und Arbeitsmaterialien (auf der beigefügten CD-ROM) dargestellt, die es Schulen ermöglichen, selbstständig mit SEIS zu arbeiten. Rezension
Mit PISA und anderen Schulleistungsstudien ist die deutsche Bildungslandschaft nachhaltig in Bewegung geraten; denn deutsche Schulen und das deutsche Bildungssystem schneiden international vergleichsweise schlecht ab. Die Bertelsmann Stiftung bemüht sich in einem wesentlichen Bereich ihrer vielfältigen Aktivitäten um den Bereich Bildung und Gesellschaft. »Bessere Qualität in allen Schulen« stellt das standardisierte Steuerungsinstrument SEIS (Selbstevaluation in Schulen) vor, das Schulen dabei unterstützt, Entwicklungsarbeit zu evaluieren. Was macht die Qualität einer Schule aus? Wie lassen sich die Lern- und Lebenschancen von Schülern heute und in Zukunft sichern? Wie kann man Schule grundsätzlich besser machen? Dabei werden alle an Schule Beteiligten in die Selbstevaluation einbezogen, die in vier Schritten vollzogen wird. Es werden Grundlagen, konkrete Arbeitsschritte, Handlungsempfehlungen, Techniken, anschauliche Praxisbeispiele und Arbeitsmaterialien (auf der beigefügten CD-ROM) dargestellt, die es Schulen ermöglichen, selbstständig mit SEIS zu arbeiten.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Was macht die Qualität einer Schule aus? Wie lassen sich die Lern- und Lebenschancen von Schülern heute und in Zukunft sichern? Wie kann man Schule grundsätzlich besser machen? Antworten auf diese Fragen bietet der aktuelle Praxisleitfaden zur Einführung des Instruments SEIS in Schulen. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Weiterentwicklung von SEIS: die Beteiligten 13 1.0 Das Projekt im Überblick: Grundlagen der datengestützten Schulentwicklung 20 Christian Ebel, Dorit Grieser, Julia Mahlmann 1.1 Datengestützte Schulentwicklung mit dem SEIS-Instrument 22 1.2 Der Nutzen des SEIS-Instruments für Schulen 30 1.3 Wie sag ich's meinem Kollegium? - Empfehlungen zur Einführung des SEIS-Instruments in der Schule 33 1.4 Übersicht über die Kernelemente zur Einführung des SEIS-Instruments in Schulen 44 1.5 Haltungen gegenüber Veränderungen 45 1.6 Modell zur Einführung des SEIS-Instruments an einer Beispielschule 47 1.7 Beispiel aus der Schulpraxis: die Rolf-Dircksen-Schule, Enger 48 Dagmar Kirchhoff, Enger 1.8 Fragen und Antworten zum SEIS-Instrument 57 2.0 Das gemeinsame Qualitätsverständnis als Ausgangspunkt für Schulentwicklung 60 Christian Ebel, Dorit Grieser, Julia Mahlmann 2.1 Schulqualität in sechs Qualitätsbereichen - das SEIS-Qualitätsverständnis 62 2.2 Eine gemeinsame Verständigungsgrundlage schaffen 79 2.3 Übersicht über Kernelemente der Verankerung 85 2.4 Die Arbeitsschritte zur Verankerung des Qualitätsverständnisses 86 2.5 Modell zur Verankerung des Qualitätsverständnisses an einer Beispielschule 87 2.6 Beispiel aus der Schulpraxis: die IGS Schaumburg 88 Bärbel Harmening, IGS Schaumburg 2.7 Die Erweiterbarkeit von SEIS - kleiner Leitfaden zur schulspezifischen Ergänzung des Qualitätsverständnisses 94 2.8 Fragen und Antworten zum Qualitätsverständnis 100 3.0 Die Datenerhebung - Messverfahren, Instrumente und Vorgehensweisen 104 Christian Ebel, Dorit Grieser, Julia Mahlmann, Stefanie Knill 3.1 Schulqualität messen - die Erhebungsinstrumente 107 3.2 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Datenerhebung schaffen 117 3.3 Arbeitsschritte zur Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Datenerhebung 122 3.4 Die Software für die Datenerhebung und Auswertung der Fragebögen 125 3.5 Modelle für die Durchführung der Datenerhebung an zwei Beispielschulen 145 3.6 Beispiel aus der Schulpraxis: die Integrierte Gesamtschule Schaumburg 147 Bärbel Harmening, IGS Schaumburg 3.7 Beispiel aus der Schulpraxis: die Laagbergschule 157 Karola Städing, Laagbergschule 3.8 Fragen und Antworten zur Datenerhebung 164 4.0 Die Interpretation des Schulberichts 168 Christian Ebel, Dorit Grieser, Pauline Laing, Angela Müncher, Eric Vaccaro 4.1 Der SEIS-Bericht als Grundlage datengestützter Schulentwicklung 171 4.2 Aufbau und Struktur des SEIS-Schulberichts 175 4.3 Strategien der Dateninterpretation 196 4.4 Chancen und Grenzen von Daten 205 4.5 Den Prozess der Dateninterpretation als gemeinsame Aufgabe gestalten 209 4.6 Arbeitsschritte zur Planung und Steuerung der Dateninterpretation 220 4.7 Hinweise für Führungskräfte im Umgang mit kritischen Daten 221 4.8 Modelle für die Dateninterpretation an drei Beispielschulen 228 4.9 Beispiel aus der Schulpraxis: die Gesamtschule Haspe, Hagen-Haspe 234 Michael Fink, Gesamtschule Haspe, Hagen-Haspe 4.10 Beispiel aus der Schulpraxis: die Salierschule Schifferstadt 245 Anette Hilspach-Kierig, Salierschule Schifferstadt 4.11 Beispiel aus der Schulpraxis: die Staudinger-Gesamtschule, Freiburg i. Br. 256 Gertrud Falk-Stern, Gudrun Nack, Andrea Smely, Staudinger-Gesamtschule, Freiburg i. Br. 4.12 Fragen und Antworten zur Interpretation des Schulberichts 269 5.0 Datengestützte Schulentwicklung und Maßnahmenplanung 274 Christian Ebel, Dorit Grieser, Pauline Laing 5.1 Datengestützte Schulentwicklung - wie aus Wissen Handeln wird 277 5.2 Schulentwicklung systemisch gestalten 280 5.3 Auf ein gutes Zusammenspiel und den Erfolg hinarbeiten 285 5.4 Arbeitsschritte zur Planung und Steuerung von Maßnahmen 297 5.5 Den Blick über den Tellerrand wagen - Erfahrungsaustausch mit gleich gesinnten Schulen 299 5.6 Wie Sie Kompetenz und Fortschritte Ihrer Schule bei der Planung einschätzen können 302 5.7 Erfolgsfaktoren und Leitgedanken für eine gute Schulentwicklungsplanung im Überblick 306 5.8 Modelle für die Planung und Durchführung von Maßnahmen an einer Beispielschule 311 5.9 Beispiel aus der Schulpraxis: die Gesamtschule Haspe, Hagen-Haspe 313 Michael Fink, Gesamtschule Haspe, Hagen-Haspe 5.10 Fragen und Antworten zur Maßnahmenplanung 327 Ausblick 332 Anhang 336 Strukturierter Arbeitsplan zur Selbstevaluation mit SEIS 336 Übersicht über alle an der Entstehung von SEIS beteiligten Personen und die Schulen aus dem Internationalen Netzwerk Innovativer Schulsysteme (INIS) 340 Überblick über die Arbeitsmaterialien auf CD-ROM 343 Glossar (Schlagworte) zum SEIS-Instrument 349 Weiterführende Literatur 364 Das SEIS-Projektteam der Berteismann Stiftung 368 Leseprobe: Cornelia Stern, Christian Ebel, Eric Vaccaro, Oliver Vorndran (Hrsg.): Bessere Qualität in allen Schulen Planung, Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung Zunächst müssen klare Vorgehensweisen für die Befragung aller Zielgruppen definiert und Verantwortlichkeiten festlegt werden: Wer kümmert sich an der Schule um die Umfrage? Gibt es bereits eine Steuergruppe, oder lässt sich kurzfristig eine solche einrichten? Wie kann ein positives Klima für die Datenerhebung geschaffen werden, sodass sich alle Beteiligten mit der Aktion identifizieren und ausreichend motiviert sind? Des Weiteren sollte ein Zeitplan über alle Aktivitäten und Aufgaben erstellt werden. Für den gesamten Ablauf der Datenerhebung inklusive Organisation, Durchführung und Nachbereitung sollte ein Zeitrahmen von drei bis vier Wochen eingeplant werden. Im Anschluss an die Planung müssen alle Beteiligten an der Schule über die anstehende Datenerhebung informiert und in die Vorbereitung einbezogen werden. Das Kollegium kann per Brief, Bekanntmachung, Infotafel oder während einer Dienstbesprechung über die anstehende Befragung unterrichtet werden. Die Schüler der betreffenden Jahrgangsstufen können von den verantwortlichen Lehrern informiert werden oder erhalten einen Schülerbrief. Desgleichen können die Eltern der zu befragenden Schüler über einen Elternbrief informiert oder auf Schulelternratssitzungen, bei Elternabenden und Elternsprechtagen benachrichtigt werden. Hier sind viele weitere Möglichkeiten denkbar – alle an der Schule üblichen Informationskanäle sollten in Betracht gezogen werden. Durchgeführt werden die Befragungen der Schüler zumeist von den Klassenlehrern sowie den Vertretern der Steuergruppen. Bei Rückfragen insbesondere jüngerer Schüler sorgt ein Glossar dafür, dass Erklärungen innerhalb des Projektes einheitlich gegeben werden und ein gleiches Verständnis der Fragebögen gewährleistet wird (siehe beiliegende CD). Die Schüler können klassenweise im Unterricht befragt werden. |
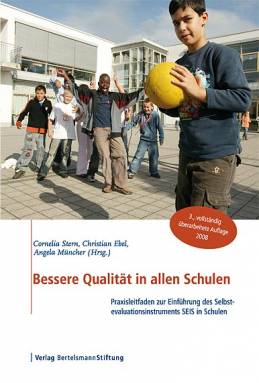
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen