|
|
|
Umschlagtext
Dieses Unterrichtsmodell bezieht sich auf folgende Textausgaben: edition suhrkamp 978-3-518-10001-1 oder Suhrkamp BasisBibliothek 978-3-518-18801-9
Rezension
Bert Brecht (1898 Augsburg - 1956 Berlin) steht nach wie vor auf den Spielplänen deutscher Theater, steht fest verankert in den Lehrplänen des Deutsch-Unterrichts und zählt zu den Klassikern der modernen deutschen Literatur. Brecht als Begründer des Epischen Theaters, eines analytischen Theaters, das den Zuschauer zum distanzierten Nachdenken und Hinterfragen anregt, zählt unbestritten zu den schaffensreichsten deutschen Dramatikern und Lyrikern des 20. Jhdts. und gehört in der Schule zur regelmäßigen Lektüre. - Dieser Band aus der Reihe "EinFach Deutsch Unterrichtsmodell" ermöglicht eine umfangreiche, differenzierte, anregende inhaltliche Beschäftigung mit Brechts Drama "Leben des Galileis", indem sieben Bausteine (vgl. Inhaltsverzeichnis) ausgearbeitet sind. Neben ausführlichen inhaltlichen Erläuterungen bietet das Unterrichtsmodell eine Vielfalt an Materialien und Erarbeitungsvorschlägen, die eine unmittelbare Umsetzung im Unterricht ermöglichen. Einmal mehr bietet der Band aus der Reihe "EinFach Deutsch Unterrichtsmodell" eine umfangreiche, differenzierte, anregende, variabel strukturierbare inhaltliche Beschäftigung mit dem Stoff im Deutschunterricht mit dem Stoff. - Der Physiker Galileo Galilei beweist mit Hilfe des Fernrohrs das Kopernikanische Weltbild und widerlegt somit die Vorstellung des alten ptolemäischen Weltbilds, was zu einem scharfen Konflikt mit der katholischen Kirche führt. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Bedeutung von Wissenschaft und Technik ist die Rettung von Wahrheit und Vernunft gegen Lüge und Propaganda zentrales Thema des Buches.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schulform Integrierte Gesamtschule, Gemeinschaftsschule, Stadtteilschule, Gymnasium, Sekundarstufe II, Fachoberschule/Berufsoberschule, Berufliches Gymnasium Schulfach Deutsch Klassenstufe 10. Schuljahr bis 13. Schuljahr Das praxiserprobte Programm der Reihe EinFach Deutsch enthält ein vielseitiges Serviceangebot für einen lebendigen Deutsch- und Literaturunterricht. Die effektive Vermittlung der Lektüre steht im Zentrum der Unterrichtsmodelle. Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer erhalten hier viele Anregungen für eine effiziente und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung. Gerade in Verbindung mit den Textausgaben, auf deren Basis sie arbeiten, stellen die Unterrichtsmodelle die ideale Lösung für einen modernen, aber dennoch substanziellen Deutschunterricht dar. Die Pluspunkte der EinFach Deutsch-Unterrichtsmodelle auf einen Blick: das Bausteinprinzip: Die einzelnen Bausteine, thematische Schwerpunkte mit entsprechenden Untergliederungen, lassen sich austauschen und/oder variieren. So sind individuell zusammengestellte Unterrichtsreihen mit verschiedenartigen Themenakzenten problemlos möglich. In sehr übersichtlich gestalteter Form erhält der Benutzer/die Benutzerin zunächst eine Übersicht über die im Modell ausführlich behandelten Bausteine. Es folgen: Hinweise zu Handlungsträgern Eine Zusammenfassung des Inhalts und der Handlungsstruktur Vorüberlegungen zum Einsatz des Buches im Unterricht Hinweise zur Konzeption des Modells Eine ausführliche Darstellung der thematischen Bausteine Zusatzmaterialien die Praxisorientierung: Kopierfähige Arbeitsblätter, Vorschläge für Klassen- und Kursarbeiten, Tafelbilder, Arbeitsaufträge, Projektvorschläge etc. erleichtern die Unterrichtsvorbereitung. die Methodenvielfalt: Handlungsorientierte Methoden sind in gleicher Weise berücksichtigt wie eher traditionelle Verfahren der Texterschließung und -bearbeitung. So oder so wird den Bedürfnissen der Schulpraxis Rechnung getragen. die Benutzerfreundlichkeit: Die Einbindung der Textausgaben in die Unterrichtsmodelle liefert verlässliche Textstellenangaben. Randmarker gewährleisten eine schnelle Orientierung und einen gezielten, bequemen Informationszugriff. Bei vielen Bausteinen lässt das Layout Platz für persönliche Notizen, so dass wesentliche Unterrichtsdaten nicht verloren gehen und auch weiterhin nutzbar sind. die Materialauswahl: Aufschlussreiche Zusatzmaterialien wie themenbezogene Zeitungsartikel, Lexikon- oder Redeauszüge, aber auch Bilder und Illustrationen dienen zur Anreicherung und Untermauerung des Lehrstoffes. Die Unterrichtsmodelle beziehen sich und verweisen auf die Textausgaben der Reihe EinFach Deutsch oder auf gängige Taschenbuchausgaben anderer Verlage. Inhaltsverzeichnis
1. Die Personen 10
2. Inhalt 11 3. Vorüberlegungen zum Einsatz des Dramas im Unterricht 13 4. Konzeption des Unterrichtsmodells 14 5. Die thematischen Bausteine des Unterrichtsmodells 16 Baustein 1: Die Frage des Einstiegs 16 1.1 Primärrezeption und Grobplanung 16 1.2 Struktur- und Handlungsverlauf 18 1.3 Italien im 17. Jahrhundert 20 Arbeitsblatt 1: Satzanfänge 22 Arbeitsblatt 2: Schreibgespräch (1) 23 Arbeitsblatt 3: Schreibgespräch (2) 24 Arbeitsblatt 4: Schreibgespräch (3) 25 Arbeitsblatt 5: Rollenbiografien – Die Figuren stellen sich einem imaginären Publikum vor 26 Arbeitsblatt 6: Übersicht über den Handlungsverlauf 27 Baustein 2: Konfliktträchtige Zeiten – konfliktträchtiges Wissen 28 2.1 Zeitenwende – Das 1. Bild als Exposition 28 2.2 Personenkonstellation als soziales Kräfteverhältnis 32 2.3 Methodenstreit 34 Baustein 3: Wissenschaft und Kirche 36 3.1 Heliozentrisches und geozentrisches Weltbild 36 3.2 Kirchliches Machtkalkül 39 3.3 Papst und Wissenschaftler 42 3.4 Die Darstellung der Kirche als weltliche Obrigkeit 43 3.5 Wissenschaftsfeindliche Kirche – „Ein tragisches Missverständnis“? 45 3.6 Das Verhältnis von Kirche und Wissenschaft heute 46 Arbeitsblatt 7: Darstellung der Kirche 49 Arbeitsblatt 8: Wissenschaftsfeindliche Kirche – „Ein tragisches Missverständnis“? 50 Arbeitsblatt 9: Das Verhältnis Kirche – Wissenschaft heute – Papst Franziskus 54 Arbeitsblatt 10: Das Verhältnis Kirche – Wissenschaft heute – Bischof Huber 55 Arbeitsblatt 11: Das Verhältnis Kirche – Wissenschaft heute 56 Baustein 4: Wissenschaft und soziale Verantwortung 57 4.1 Kleiner Mönch – Wissenschaftsabstinenz aus Verantwortung? 57 4.2 Die Aufnahme der Lehre Galileis im Volk 61 4.3 Der Widerruf und seine Konsequenzen 64 4.4 Wissenschaftliche Neuerungen und soziale Verantwortung: 1610 und 2016 66 Arbeitsblatt 12: Position Galileis 70 Arbeitsblatt 13: Position des kleinen Mönchs 71 Arbeitsblatt 14: Vergleich kleiner Mönch – Galilei 72 Arbeitsblatt 15: Dialoganalyse Bild 14 (+ Lösung) 73 Arbeitsblatt 16: Galilei: Am Anfang und am Ende?! 76 Arbeitsblatt 17: Gravitationswellen: „Als ob die Menschheit ein neues Sinnesorgan entwickelt hätte.“ 78 Baustein 5: Rationalität 80 5.1 Rationalität ohne Skrupel 80 5.2 Rationalität und Sinnlichkeit 83 5.3 Rationalität und Naivität 83 Arbeitsblatt 18: „Vergnügungen“ 89 Baustein 6: Episches Theater 90 6.1 Die Straßenszene als Grundmodell 90 6.2 Brechts Konzeption 91 6.3 Gegenüberstellung: Episches und aristotelisches Theater 93 6.4 Dialektischer Szenenaufbau 94 6.5 Epische Gestaltung im Bild 13 94 Arbeitsblatt 19: Brecht: Die Straßenszene als Grundmodell für episches Theater 95 Arbeitsblatt 20: Brecht: Kleines Organon für das Theater 96 Arbeitsblatt 21: Episches Theater – Aristotelisches Theater 98 Arbeitsblatt 22: Dialektischer Szenenaufbau (+ Lösung) 100 Baustein 7: Wissenschaftsdramen im Vergleich 101 7.1 Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker 101 7.2 Heinar Kipphardt: In der Sache J. Robert Oppenheimer 103 Arbeitsblatt 23: Die Pysiker – Textauszug aus dem 2. Akt 106 Arbeitsblatt 24: Vergleich der Werke Brechts und Dürrenmatts 108 Arbeitsblatt 25: in der Sache J. Robert Oppenheimer Auszug 1: Szene 7 109 Arbeitsblatt 26: in der Sache J. Robert Oppenheimer Auszug 2: Szene 9 112 Arbeitsblatt 27: Vergleich der Werke Brechts und Kipphardts 113 Zusatzmaterialien 114 Z 1: Bertolt Brecht – Eine Kurzbiografie 114 Z 2: Galileo Galilei (1564 – 1642) – Eine Kurzbiografie 115 Z 3: Das geozentrische Weltbild 116 Z 4: Beurteilung Galileis 117 Z 5: Vergleich der Schlussmonologe 118 Z 6: Abschwörungsurkunde des Galilei 119 Z 7: Das Theater: eine moralische Anstalt? 120 Z 8: Georg Patzer: Das epische Theater 2001 121 Z 9: Begegnung Mensch – Mächtige 122 Z 10: Die Physiker – Inhaltsangabe 123 Z 11: In der Sache J. Robert Oppenheimer – Inhaltsangabe 124 Z 12: Analyse eines dramatischen Textauszuges 125 Z 13: Formulierungshilfen zur Dialoganalyse 126 Z 14: Übung: Den Ausdruck variieren/Sprechakte genau benennen 127 Z 15: Übung: Den Ausdruck variieren/Sprechakte genau benennen – Lösung 128 Z 16: Übung: Beziehungsanalyse Galilei – Virginia 129 Z 17: Exemplarische Dialoganalyse des 3. Bildes in Konzeptform 130 Z 18: Brief von Andrea an Galilei (Nora L., 17 Jahre) 132 Z 19: Klausurvorschlag 1 133 Z 20: Klausurvorschlag 2 140 |
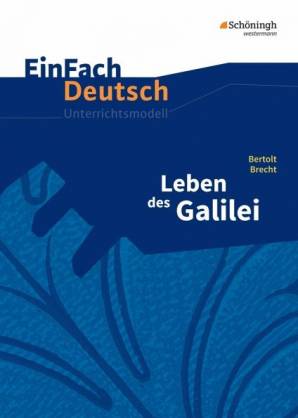
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen