|
|
|
Rezension
Die Biographien körperbehinderter Menschen sind bisher in der Wissenschaft kaum erforscht. Ein Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke leistet die Untersuchung von Meinolf Schultebraucks. Er verfolgt mit seinem Buch >Behindert Leben< die Intention, >eine systematische Darstellung der Kategorie Behinderung auf der sozial-kulturellen Ebene zu liefern und die Selbstkonzepte von drei behinderten Interviewpartnern zu erfassen.< (S. 290) Außerdem möchte er durch seine >biographieanalytische Studie< Informationen gewinnen über >Ressourcen behinderter Menschen> zur Realisierung ihrer Selbstkonzepte< (Ebd.). Bei der als Band 16 in der Reihe >Schriften aus dem Comenius-Institut< erschienenen Abhandlung handelt es um eine gekürzte Fassung der von Schultebraucks an der Universität Dortmund im Oktober 2003 eingereichten Dissertation.
Die Komplexität des Themas erfordert ein qualitatives Forschungsdesign. Der Verfasser hat seine qualitativen Erhebungen in zwei Zeiträumen, nämlich in den Jahren 1980-1983 und 2002-2003 durchgeführt. Diesen unterschiedlichen Erhebungszeiträumen ist wohl eine gewisse methodische Diversität der Arbeit geschuldet. Bei der Erhebung 1982 orientierte er sich an einem Interviewleitfaden, zwanzig Jahre später an Fritz Schützes Ansatz des narrativen Interviews (S. 40f). Schultebraucks Buch weist eine Zweiteilung in einen theoretischen und einen empirischen Teil auf. Im Theorie-Teil seiner Abhandlung stellt der Verfasser die ihn leitenden theoretische Konzepte vor: von der politischen Theologie des Subjekts (Johann Baptist Metz) über die Normalismusforschung (Jürgen Link) bis hin zur Individualtheorie (Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim). Kritisch anzumerken ist, dass diese Ausführungen Schultebraucks einer additiven Zusammenstellung theoretischer Versatzstücke gleichen. Die Stärken der Untersuchung des Verfassers liegen in den empirischen Einzelfallanalysen, in denen verschiedene Aspekte des Lebens Körperbehinderter beleuchtet werden, z. B. Sozialisation, Umgang mit der Behinderung und ihre >Werte- und Sinnsysteme<. Der Leser gewinnt anhand der Analysen aufschlussreiche Informationen über den biographischen Werdegang körperbinderter Menschen und ihre Balancierungsversuche zur Konstruktion eines Selbstkonzepts. Man wird so sensibilisiert für die Probleme, aber auch für die Ressourcen Körperbehinderter. In seinem abschließenden Kapitel leitet der Verfaser aus seinen Forschungsergebnissen bestimmte Forderungen ab wie z. B. die >Öffnung von Beratungsstellen für biographische Verfahren< (S. 291). Schultebraucks Resultate unterstreichen m. E. die Notwendigkeit einer pädagogischen Konzeption, die den Anderen nicht ausblendet, sondern angemessen würdigt. Dr. Marcel Remme, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Ausgehend von zwei Interviewserien aus den Jahren 1982 und 2002 werden in der biographieanalytischen Studie Lebenssituationen, Selbstkonzepte und Bewältigungsstrategien von drei körperbehinderten Erwachsenen beschrieben. Gemeinsames Merkmal ist die auffällig positive Grundhaltung der Autobiographen zum eigenen Leben, die im krassen Widerspruch zur gesellschaftlich vorgenommenen Einschätzung der Lebensqualität von behinderten Menschen als gering oder Mitleid erregend steht. Als weiteres durchgängiges Kennzeichen der untersuchten Biographien stellte sich das Bemühen um die Herstellung von Normalität heraus. "... die Überlegungen des Verfassers (zielen) auf gesteigerte gesellschaftliche Partizipation von Behinderten, die schließlich zu einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung ihrer Situation und der Art ihres Lebens beitragen soll" (Johann Baptist Metz). Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1 Einleitung 11 2 Subjektsein zwischen Normalität und Behinderung 12 2.1 Theologische Subjekttheorie 13 2.2 Behinderung und Normalität 24 2.3 Theoretische Grundlage der Soziologischen Lebensgeschichtsforschung 34 2.4 Ziel der Arbeit 36 3 Zur Methodik 37 3.1 Methodologische Voraussetzungen und Implikationen 37 3.2 Erhebung 1982 39 3.3 Erhebung 2002 41 3.4 Datenauswertung und Datenanalyse 46 3.5 Kontrastiver Vergleich der Ergebnisse der Einzelfallstudien und Zeichnen eines Gesamtbildes 50 4 Empirischer Teil – Einzelfallanalyse Frau A 53 4.1 Biographische Daten 53 4.2 Rekonstruktion der biographischen Texte 54 4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse und Gesamtinterpretation 98 5 Empirischer Teil – Einzelfallanalyse Frau B 108 5.1 Biographische Daten 108 5.2. Rekonstruktion der biographischen Texte 1982 und 2002 109 5.3. Zusammenfassung der Ergebnisse und Gesamtinterpretation 160 6 Empirischer Teil – Einzelfallanalyse Herr C 174 6.1 Vorbemerkungen 174 6.2 Rekonstruktion der biographischen Texte 1982 und 2002 174 6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse und Gesamtinterpretation 233 7 Empirischer Teil – Kontrastiver Vergleich 245 7.1 Strukturelle Vergleichskategorien 245 7.2 Struktureller Vergleich 249 8 Weiterführende Einsichten aus der Studie für die herangezogenen Theoriekonzepte 262 8.1 Erträge des biographieanalytischen Forschungsprojekts ‚Leben an den Grenzen von Normalität und Behinderung‘ 262 8.2 Fachspezifische Erträge 285 9 Schluss 290 10 Literatur 293 Weitere Titel aus der Reihe Schriften aus dem Comenius-Institut |
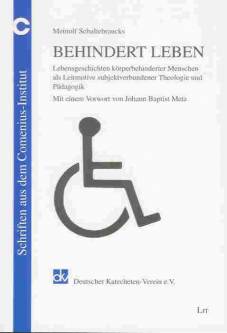
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen