|
|
|
Umschlagtext
Psychische Störungen eindeutig und übersichtlich zu beschreiben, sie in einen Orientierungsrahmen einordnen zu können und Ansätze für ihr Verstehen zu gewinnen, ist ein wichtiges Anliegen für alle, die mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Patienten in Berührung kommen.
Dieses Buch vermittelt eine elementare, praxisbezogene Psychopathologie. Es führt eine Ordnung des Beschreibbaren ein, lehrt die erforderliche Sorgfalt des Beschreibens und der Begriffsverwendung und erlaubt Einblicke in Hintergründe und Entstehung seelischer Störungen. Es zeichnet sich besonders aus durch: Konzentration auf das Wesentliche, überzeugende, einprägsame Systematik, präzise, anschauliche Sprache bei weitestmöglichem Verzicht auf Fachterminologie, intensiven Praxisbezug, vermittelt durch 100 Fallbeispiele. Rezension
Dieses Buch bietet, - wie der Umschlagtext andeutet -, in der Tat eine elementare Einführung in die Psychopathologie. Dabei konzentriert es sich auf das Wesentliche. In für Mediziner eher unüblich klarer und anschaulicher Sprache wird das Thema auch für Laien verständlich dargestellt, u.a. durch vielfältige Fallbeispiele. Zwar sind die Kapitel angesichts der Stofffülle knapp, aber dafür hoch komprimiert, ohne unverständlich zu werden. Die 5. Aufl. seit 1976 zeigt einerseits den Erfolg der Darstellung, andererseits ist die Literatur gelegentlich ergänzungsbedürftig, - aber das ist nicht entscheidend. Und ebenso wenig entscheidend ist, dass der Verfasser eher von der biologischen Psychologie und von der Psychiatrie her kommt als aus der Psychoanalyse. – Das Buch bietet in knapper und präziser Form eine „Einführung“ in alle Themengebiete der allgemeinen Psychopathologie in auch für Nicht-Mediziner verständlicher Weise und ist deshalb gerade auch für Schulpsychologen und Schulpädagogen hilfreich.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Psychische Störungen eindeutig und übersichtlich zu beschreiben, sie in einen Orientierungsrahmen einzuordnen und Ansätze für ihr Verstehen zu gewinnen, ist ein wichtiges Anliegen für alle, die mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Patienten in Berührung kommen. Psychopathologie - elementar und praxisbezogen Einblicke in Hintergründe und Entstehung seelischer Störungen Überzeugende, einprägsame Systematik Genaue Begriffsdefinitionen Der eingeführte Standard zum Thema Konzentriert auf das Wesentliche Zum Lernen und Nachschlagen Präzise, anschauliche und verständliche Sprache bei weitestmöglichem Verzicht auf Fachterminologie Intensiver Praxisbezug - vermittelt durch 100 Fallbeispiele Inhaltsverzeichnis
1. Zur allgemeinen Psychopathologie 1
Aufgabe, Ziel und Haltung des Psychopathologen 1 Aufgabe der allgemeinen Psychopathologie 1 Psychopathologische Einsicht führt näher zum Menschen . . 2 Psychopathologie als Erlebnislehre 3 Deskriptive Psychopathologie als Grundlage der „Psychodynamik" 3 Interaktioneller, sozialer und kultureller Aspekt 3 Persönlichkeiten in der Psychiatrie 5 Zur Problematik von normal, gesund, abnorm, krank 6 Normal 7 Gesund/krank 12 Krise 13 Somatisches Modell (sog. „medizinisches" Modell) .... 16 Soziologischer Aspekt 17 Psychologisches Modell 17 Psychische Störung als Normdevianz 19 Psychische Störung als soziale Etikettierung 19 Psychedelisches Modell 20 Kosmologischer, magischer, animalischer, astrologischer, moralischer Krankheitsbegriff 20 Ethologischer Krankheitsbegriff 21 Forensischer Krankheitsbegriff 21 Weitere Krankheitsbegriffe 21 Privilegien und Sanktionen 22 Symptom und Syndrom 23 Psychopathologische Symptome - nicht schlechthin krankhaft 23 Von Symptomen zum Syndrom 24 Zugang zu Symptomen/Syndromen 25 Theorien zur Entstehung von Symptomen/Syndromen ... 28 Einteilungsmöglichkeiten von Symptomen 31 Einteilung hinsichtlich ihres diagnostischen Gewichts, ihrer pathognomonischen Bedeutung 31 Primäre und sekundäre Symptome 31 Diagnose 31 Begriff und Sinn 31 Diagnostischer Prozess - ein Erkenntnisprozess 32 Klinische Untersuchung 33 Anamnese 37 Differenzialdiagnostischer Prozess 37 Diagnose - Zuordnung in der Nosologie 38 Diagnose - therapeutische Handlungsanweisung 40 Wissenschaftstheoretische Bemerkung 40 2. Bewusstsein 47 Tages-Wach-Bewusstsein, Über-, Unter-Bewusstsein und der Ort der Psychopathologie 51 Typologie besonderer Wach-Bewusstseins-Zustände 56 Auslöser besonderer Wach-Bewusstseins-Zustände .... 58 Bewusstsein - Begriffsumgrenzung 59 Funktionsbereiche 60 Wachsein (Vigilanz) 61 Bewusstseinsklarheit (-helligkeit, Luzidität) 62 Pathologie des Bewusstseins - Bewusstseinsstörungen - Störungen der Vigilanz und der Bewusstseinsklarheit .... 63 Vorwiegend quantitative Herabsetzung des Bewusstseins - Bewusstseinsstörungen und Bewusstlosigkeit 64 Benommenheit 64 Somnolenz 64 Sopor 65 Präkoma (Subkoma) und Koma (I-IV) 65 Parasomnische Bewusstseinslage 66 Qualitative Bewusstseinsstörungen 67 Delirium tremens 67 Dämmerzustand 68 Oneiroid 69 Verwirrtheit (Amentia), Konfusion 70 Bewusstseinssteigerung, -erweiterung 70 3. Ich-Bewusstsein 72 Definition 72 Dimensionen 73 Ich-Vitalität 74 Ich-Aktivität 75 Ich-Konsistenz und -Kohärenz 75 Ich-Demarkation 76 Ich-ldentität 76 Selbstbild (Selbstkonzept, Persönlichkeitsbild) 77 Ich-Stärke 77 Konstituenten/Determinanten/Entwicklung 81 Ich-Erleben und Leibgefühl 81 Entwicklung 81 Ich-/Selbsterleben und Kultur 82 Prüfung 83 Pathologie 84 Depersonalisation 84 Störungen der Ich-Vitalität 88 Störungen der Ich-Aktivität 89 Störungen der Ich-Konsistenz und -Kohärenz 91 Störungen der Ich-Demarkation 92 Störungen der Ich-ldentität 94 Störungen des Selbstbilds (Selbstkonzepts) 97 Wesensänderung, Persönlichkeitswandel 97 Egodystonie 98 Selbstwertgefühl 98 Störungen der Ich-Stärke 99 Falsches und wahres Selbst 99 Narzissmus 101 Psychoanalytische Ich-Pathologie der Psychosen 107 Hinweise auf Forschungsansätze 116 4. Erfahrungsbewusstsein und Realitätsbewusstsein .... 117 Definition 117 Funktion 117 Grundlagen 119 Prüfung 119 Pathologie 119 In besonderen Lebensumständen 119 Bewusstseinsveränderungen 120 Demenz 120 Störungen des Ich-Bewusstseins 120 Störung der Ich-Vitalität 122 Störung der Ich-Aktivität 122 Störung der Ich-Konsistenz 122 Störung der Ich-Demarkation 122 Störung der Ich-ldentität 123 Hinweis zur Therapie 123 5. Orientierung 124 Definition 124 Funktion 124 Orientierung in der Zeit 124 Orientierung im Ort 124 Orientierung über die eigene Person (autopsychische Orientierung) 125 Situative Orientierung 125 Voraussetzungen 125 Prüfung 125 Pathologie 126 Unsicherheit und Schwanken der Orientierung 126 Ausfall der Orientierung: Desorientierung 126 Zeitliche Desorientierung 127 Örtliche Desorientierung 127 Personelle Desorientierung 127 Situative Desorientierung 128 Falsche Orientierung 128 Wahnhafte Fehlorientierung und „doppelte Buchführung" 128 Vorkommen der Orientierungsstörungen 128 6. Zeiterleben 130 Begriffe 130 Zeiterleben im engeren Sinn 130 Zeitwissen, Zeiteinschätzung 130 Funktion 130 Grundlagen 130 Prüfung 131 Pathologie 131 Beschleunigung (Zeitraffererlebnis) 132 Verlangsamung (Zeitdehnungserlebnis) bis zum Zeitstillstand 132 Zeitlicher Realitätsverlust 132 Störung der Zeitkategorien 133 7. Gedächtnis und Erinnerung 135 Definition 135 Funktion 135 Grundlagen 136 Prüfung 137 Pathologie der mnestischen Funktionen 137 Allgemeine (diffuse) Erinnerungsstörungen (Hypomnesien, Amnesien, Dysmnesien) 138 Umschriebene Amnesien und Hypomnesien 139 Hypermnesie 140 Scheinerinnerungen (Paramnesien) 140 Fälschung in Derealisation und Wahn 140 Pseudologie 140 Konfabulationen 141 Vermeintliche Vertrautheit oder Fremdheit 141 8. Aufmerksamkeit und Konzentration 142 Definition 142 Funktion 142 Voraussetzungen 143 Prüfung 143 Pathologie der Aufmerksamkeit 143 Unaufmerksamkeit und Konzentrationsstörung 143 Einengung der Aufmerksamkeit 144 Schwankungen der Aufmerksamkeit und der Konzentration 144 Vorkommen von Aufmerksamkeits und Konzentrationsstörungen 144 Aufmerksamkeit und Sinnestäuschungen 145 9. Denken, Sprache, Sprechen 146 Definition 146 Funktion 146 Grundlagen und Determinanten 147 Psychologische und physiologische Grundlagen 147 Soziokulturelle Determinanten 147 Prüfung 147 Pathologie 148 Formale Denkstörungen 149 Verlangsamtes Denken 149 Gehemmtes Denken 150 Gedankenarmut, -leere 150 Umständliches Denken 150 Eingeengtes Denken 151 Perseveration des Denkens 151 Beschleunigtes und ideenflüchtiges Denken 151 Gedankensperrungen 152 Gedankenabreißen 152 Inkohärentes (zerfahrenes) Denken 152 Unklares Denken 153 Paralogisches Denken 154 Denkstörungen im Zusammenhang mit Ich-Erlebnisstörungen 154 Gedankenausbreitung 155 Gedankenentzug (Gedankenenteignung) 155 Gedankeneingebung, -lenkung 155 Aphasien 155 Expressive (sog. motorische) Aphasie (Broca-Aphasie) . . 155 Sensorische Aphasie (Wernicke-Aphasie) 156 Sprechstörungen 156 Aphonie und Dysphonie 156 Dysarthrie 157 Stottern und Stammeln 157 Logoklonie 157 Störungen des Redens 157 Veränderung der Lautstärke 157 Veränderung der Modulation 157 Verlangsamtes Reden (Bradyphasie) 157 Stockendes, abgerissenes Reden 158 Beschleunigtes Reden (Tachyphasie) und Rededrang (Logorrhö) 158 Verbigeration, Palilalie, verbale Stereotypie 158 Echolalie 159 Mutismus (Verstummen) 159 Unverständlichkeit der Sprache 159 Privatsymbolik 160 Parasyntax, Paragrammatismus, Inkohärenz 160 Vorbeireden (Paraphasie) 161 Neologismen 161 Kryptolalie und Kryptographie 161 10. Intelligenz 163 Definition 163 Funktion 163 Grundlagen 164 Körperliche: Bau und Funktion des Gehirns 164 Psychologische und soziale Einwirkungen auf die Entwicklung des Gehirns und seiner Funktion 164 Prüfung 164 Pathologie (Intelligenzstörungen) 165 Intelligenzdefekte 165 Oligophrenie 165 Demenz 167 Psychosoziale intellektuelle Mangelausbildung 168 Intelligenzstörungen bei gestörter Realitätsbeziehung .... 169 Intelligenzstörungen bei Sinnesdefekten 169 Intelligenzstörungen bei herabgesetzter Vigilanz 170 Intellingenzstörung aus affektiven Gründen 170 11. Affektivität 171 Definitionen 171 Affektivität 171 Affekt, Emotion, Gefühl, Stimmung 171 Neurophysiologische Grundlagen 172 Zentrales Nervensystem 172 Autonomes Nervensystem (Vegetativum) 173 Endokrines System 173 Einteilung der Gefühle 173 Zustandsgefühle (Befindlichkeiten, Gestimmtheiten) .... 173 Zumutesein angesichts des anderen 174 Prüfung 174 Pathologie der Affektivität 174 Einzelbegriffe zur Psychopathologie der Affektivität 175 Ambivalenz 175 Parathymie (affektive Inadäquatheit) 176 Affektarmut 177 Gefühl der Gefühllosigkeit 177 Affektstarre,-steife 178 Affekttenazität (Affekthaften) 178 Affektlabilität 179 Affektinkontinenz 179 Einzelne Affektsyndrome 180 Depressives Syndrom 180 Manisches Syndrom 182 Schizophrenes Affektsyndrom 184 Angstsyndrom 185 Dysphorie, dysphorisches Syndrom 186 Hypochondrisches Syndrom 187 Überpersönliche Affektreaktionen (Primitivreaktionen) . . . 189 Dauerhafte posttraumatische Verstimmungen 189 12. Wahrnehmung 190 Definition 190 Funktion 190 Grundlagen, Komponenten und Determinanten 190 Sinnesorgane und Gehirn 190 Allgemeinpsychologische Vorgänge 191 Gegenstandscharakter 191 Realitätsurteil 191 Gestaltpsychologische Vorgänge 191 Bedeutungsgehalt 191 Persönliche, soziale, situative Einflüsse auf die Wahrnehmung 192 Zustand des Wahrnehmenden 192 Lebenserfahrung 192 Soziale Faktoren 192 Verhältnis der Wahrnehmung zur Realität 192 Beziehung von Wahrnehmung und Stimmung 193 Bedeutung und Stimmung 193 Stimmung bestimmt Wahrnehmung 193 Prüfung 194 Pathologie 194 Ausfall einer Wahrnehmungsfunktion 195 Organische Gründe 195 Wahrnehmungsausfall aus psychischen Gründen 197 Abnormitäten der Wahrnehmung 197 Intensitative Abnormitäten der Wahrnehmung 197 Veränderte Größen- und Gestaltwahrnehmung 197 Qualitative Abnormitäten der Wahrnehmung 199 Halluzinationen 200 Definition 200 Einteilung der Halluzinationen 202 Den Halluzinationen nahe stehende Erfahrungsmodi . . . 209 Halluzinationen und Wahn 212 13. Auffassung 214 Definition 214 Funktion 214 Voraussetzungen und Determinanten 214 Prüfung 214 Pathologie 215 Vorkommen der Auffassungsstörungen 215 14. Wahn 216 Definition 216 Wahnstimmung, Wahneinfall, Wahndenken, Wahnwahrnehmung, Wahnarbeit, Wahnsystem 218 Charakter des Wahns 219 Wahnwirklichkeit und Realität 219 Wahnwirklichkeit - einzige Wirklichkeit 219 Wahnwirklichkeit - beherrschende, aber nicht einzige Wirklichkeit 220 Wahnwirklichkeit und Realität bestehen nebeneinander . 220 Ineinanderfliefs'en von Wahnwirklichkeit und Realität . . 220 Wahnbedeutung 221 Veränderung des Selbstseins 221 Veränderung der Umwelt 225 Wahnhafte Fehlidentifikation 227 Veränderung von Ich und Welt 229 Erfahrungsunabhängige Bedeutungsgewissheit 229 Abstand von der und Widerstand gegen die Allgemeinerfahrung und die Gruppenüberzeugung . . . 230 Unfähigkeit zum Gesichtspunktwechsel 230 Isolation und Alienation 231 Entstehungsbedingungen des Wahns 232 Wahn als Gewisswerden von affektiv Gegebenem 234 Depression 235 Manie 235 Lebensgeschichtlich situativ „bestimmter" Wahn 236 Wahn als Thematisierung von Unsicherheit und Isolation 239 Wahn bei unerträglicher Selbstkränkung 239 Wahn als Ersatzwirklichkeit für armselige Realität .... 240 Wahn als Reaktion auf bestimmte sensorische Situationen und Halluzinogene 242 Wahn bei verändertem Selbsterleben 243 Etymologie von Wahnsinn und Wahn 246 Wahnsinn (-witz, vgl. Demenz) 246 Wahn 247 Paranoid 247 Delusion 247 Delirium 247 Gewinn im Wahn - finale Betrachtungsweise 247 Vorkommen des Wahns 250 Experimentelle Situationen 250 Wahnbildung als erlebnisreaktive Entwicklung 250 Wahn bei Affektpsychosen 251 Depression 251 Manie 252 Wahn bei Schizophrenen 252 Wahn bei körperlich begründeten Psychosen 253 Wahn bei akuten körperlich begründeten Psychosen . . . 253 Wahn bei chronischen körperlich begründeten Psychosen 253 Verlauf des Wahns 254 Wahn bei Affektpsychosen 254 Wahn bei körperlich begründeten Psychosen 254 Wahn in besonderen Situationen 255 Wahn bei Schizophrenen 255 Lebensgeschichtlich-erlebnisreaktive Wahnentwicklungen 255 Wirkung des Wahns auf die Umwelt 256 Distanzierung 256 Akzeptierung 257 Prolongierung 257 Partizipation 257 Wahn in transkultureller Sicht 257 Kultureller Einfluss auf die Tendenz zur Wahnbildung .... 258 Kultureller Einfluss auf den Wahninhalt 258 Kultur und Wahnformung 259 Kultur und Verlauf des Wahns 259 Hypothesen zum Wahn 259 Psychoanalyse 259 Analytische Psychologie 260 Individualpsychologie 261 Paläopsychologie 261 Gestaltpsychologie 262 Kybernetik 262 Neurophysiologie 263 Mehrdimentionale Betrachtung 263 Existenzanalyse, Daseinsanalytik und Daseinsanalyse .... 264 So genannte anthropologische Psychiatrie 265 15. Antrieb (Grundaktivität) 266 Definition 266 Funktionen 266 Anatomische und physiologische Grundlagen 267 Prüfung 267 Formale deskriptive Psychopathologie des Antriebs 267 Antriebsminderung 267 .Antriebssteigerung 268 Vorkommen der Antriebsanomalien 268 Persönlichkeitskennzeichnende Eigenheiten des Antriebsniveaus 268 Erworbene Antriebsstörungen 268 16. Motorik 272 Definition 272 Funktion 272 Grundlagen 273 Prüfung 274 Pathologie der Motorik 274 Motorische Schablonen 275 Tic 275 Tourette-Syndrome (maladie des tics) 276 Hypokinese, Akinese, Stupor 276 Stupor bei Schizophrenie (katatoner Stupor) 277 Stupor bei schwerster gehemmter Depression: depressiver Stupor 277 Stupor als unmittelbare Reaktion: psychogener Stupor . . 278 Stuporartige Zustände beim akuten exogenen Reaktionstyp 278 Hyperkinese, katatone Erregung, Raptus 278 Grimassen, Fratzenschneiden, Paramimie 279 Haltungsverharren (Katalepsie), Haltungsstereotypie .... 279 Negativismus 279 Motorische Stereotypien 280 Echopraxie (Haltungs- und Bewegungsimitation) 281 Bizarres und inadäquates Verhalten 282 17. Aggression 283 Definition 283 Funktion 283 Zentralnervöse Repräsentation der Aggression 285 Prüfung 285 Pathologie der Fremdaggression 286 Erhöhung der Aggressivität 287 Aggression und psychische Störung 287 Verminderung bzw. Hemmung der Aggressivität 289 Ursachen, Motive, Anlässe für Aggression 289 Allgemeine Motive für Aggressionen, d.h. unabhängig von der diagnostischen Gruppe 290 Aggression bei Schizophrenen 290 Aggression beim psychoorganischen Syndrom 291 Aggression bei Depressiven 291 Aggression bei Manischen 291 Wut bei Borderline-Persönlichkeiten 292 Andere Aggressionsquellen 292 Selbstaggression (Autoaggression) 292 Suizid und Parasuizid 293 Differenzierung der Suizidalität zur Einschätzung des Suizidrisikos 294 Selbstschädigung (Automutilation) 295 18. Zwänge und Phobien 298 Zwänge 298 Definition 298 Einteilung der Zwänge 299 Zwangsdenken: zwanghaft persistierende Denkinhalte . . 299 Zwangsimpulse 299 Zwangshandlungen 299 Vorkommen von Zwängen 300 Einzelne Zwangssymptome 300 Zwangskrankheit 300 Phobien 302 Definition 302 Arten der Phobien 302 19. Impulshandlungen 304 Definition 304 Pathologie 304 Poriomanie (Dromomanie, Fugue) 304 „Sammeltrieb" (engl. collectionism) 305 Pyromanie 305 Kleptomanie (Stehlsucht) 305 Dipsomanie 305 20. Bedürfnis-Trieb-Wille 308 Definitionen 308 Übersicht und Einteilung 309 Übersicht über die Bedürfnisse und bedürfnisbefriedigenden Handlungen 309 Primäre Bedürfnisse: angeboren, nicht erlernt 309 Sekundäre Bedürfnisse 309 Minisch-praktische Einteilung der Triebe 309 Selbsterhaltungsfunktion 310 Aiterhaltungsfunktion 310 Grundlagen und Determinanten 310 Anatomische Repräsentanzorte 310 Hormonelle und Stoffwechselsituation 310 Sensorische Afferenz 310 Lernprozesse 311 Prüfung 311 Pathologie 311 Hunger 312 Übermaß: Fresssucht (Polyphagie, Bulimie) 312 Verminderung oder Ausfall des Hungers 312 Qualitative Anomalien des Appetits 312 Durst 313 Schlaf- und Aktivitätsbedürfnis 313 Gefahrschutz 314 Motivation und Wille 314 21. Sexualität 316 Definition 316 Grundlagen 316 Entwicklung 317 Die Frage nach der Norm 317 Pathologie 319 Bemerkungen zu Autosexualität und Homosexualität . . 320 Autosexualität 320 Homosexualität 320 Abnormes Sexualobjekt 323 Infantosexualität 323 Gerontophilie 323 Bestiosexualität 324 Nekrophilie 324 Fetischismus 325 Abnorme Sexualpraktiken 325 Anmerkungen zu Oralismus 325 Nekrophagie, Koprophilie, Koprophagie, Urolagnie .... 326 Analismus 326 Urethralismus 326 Sadismus 327 Masochismus 327 Voyeurismus 328 Exhibitionismus 328 Frotteurismus 328 Transvestitismus 329 Ablehnung des eigenen biologischen Geschlechts 329 Abnormitäten der Triebstärke 330 Hypersexualität 330 Hyposexualität 331 Potenzstörungen 332 Ursachen 332 Anhang 333 Inzest 333 Literatur 334 Sachverzeichnis 355 |
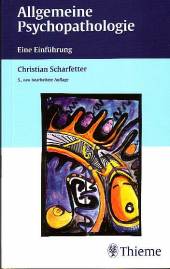
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen