|
|
|
Umschlagtext
Mit »Ästhetik in Krisenzeiten« legt Gregory Fuller eine der im deutschen Sprachraum grundlegendsten Bestandsaufnahmen der Gegenwartsästhetik vor. Die beiden Leitfragen lauten: Was kann die Ästhetik heute, in Zeiten der umfassenden ökologischen Krise, leisten? Welchen zukünftigen Weg könnte eine zeitgemäße Ästhetik beschreiten?
Fuller nimmt von veralteten ästhetischen Begriffen wie Schein, Mimesis, dem Werkbegriff und von Wahrheitstheorien aller Art sowie von der durch Hume und Kant begründeten Urteilsästhetik Abschied. Stattdessen rückt er die subjektive ästhetische Erfahrung, d.h. die Rezeption, in den Mittelpunkt seiner Theorie. Um zu einer Neuausrichtung der Ästhetik zu gelangen, bezieht Fuller auch außerästhetische Theorien wie etwa die Choice Theory, die Material Culture Studies und Emotionstheorien in seine Überlegungen mit ein. Rezension
Brauchen wir angesichts der ökologischen Krise eine neue zeitgemäße Ästhetik? Liefern indonesische und japanische Ästhetiken Bausteine für eine solche Ästhetik? Welche Funktionen besitzt die Ästhetik? Kann Ästhetik gegenwärtig noch als Urteilsästhetik im Sinne Immanuel Kants verstanden werden oder ist angesichts einer „Gesellschaft der Singularitäten“(Reckwitz) die Rezeptionsästhetik zeitgemäßer? Was versteht man unter ästhetischer Erfahrung? Wodurch zeichnet sich ein ästhetisches Urteil aus? In welchem Verhältnis stehen Moral und Ästhetik zueinander? Lässt sich über Gegenstände der Alltagsästhetik philosophieren? Ist die digitale Ästhetik unkritisch? Welche Rolle spielen Emotionen in der Ästhetik? Benötigen wir eine nicht-eurozentrische Ästhetik?
Reflektierte Antworten liefert Gregory Fuller (*1948) in seinem Buch „Ästhetik in Krisenzeiten“, erschienen in der „Blauen Reihe“ des Meiner Verlags. Der Essayist und ehemalige Anglistik-Redakteur beim Klett Verlag versteht Ästhetik im umfassenden Sinne Alexander Baumgartens als Theorie sinnlicher Erkenntnis. Fuller beginnt sein Buch mit einer soziologischen Krisendiagnose der Digitalen Moderne, wie er den Zeitabschnitt seit den 1990er Jahren bezeichnet. Eine besondere Rolle spiele zurzeit die Makrokrise und die ökologische Krise. Hinzu kommen nach ihm Mikrokrisen, bei denen er sich auf die des gesellschaftlichen Zusammenhalts konzentriert. Fuller plädiert in seiner Schrift für eine transnationale „Globalästhetik“, welche ihren Ausgang von subjektiven ästhetischen Erfahrungen nehmen soll. Bei seinen Reflexionen berücksichtigt er auch Theorien der Cultural Studies und Emotionstheorien. Seiner resignativen Haltung gegenüber der ökologischen Krise, welche er 1993 schon in seinem Essay „Das Ende. Von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht der ökologischen Katastrophe”(2. Aufl. 2017) zum Ausdruck gebracht hat, bleibt Fuller in seinem neuen Buch treu. Kunst spende dem Menschen Trost in der ökologischen Endzeit. Fullers Ansatz in seinem neuen Buch unterliegt der Gefahr, gesellschaftliche Probleme, denen politisch begegnet werden kann und sollte, zu subjektivieren. Der Band „Ästhetik in Krisenzeiten”, mit acht Abbildungen versehen, zeichnet sich durch diskutable Gedanken und gute Lesbarkeit aus. Lehrkräfte der Fächer Philosophie, Ethik und Deutsch erhalten durch sein Buch Anregungen, um sich in ihrem Fachunterricht mit ästhetischen Fragen problemorientiert auseinanderzusetzen. Fazit: Gregory Fuller ist mit seinem engagiert verfassten Buch „Ästhetik in Krisenzeiten“ ein eindrückliches Plädoyer für die Notwendigkeit und Produktivität einer Beschäftigung mit Ästhetik in Zeiten der multiplen Krise gelungen. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Mit »Ästhetik in Krisenzeiten« legt Gregory Fuller eine der im deutschen Sprachraum grundlegendsten Bestandsaufnahmen der Gegenwartsästhetik vor. Die beiden Leitfragen lauten: Was kann die Ästhetik heute, in Zeiten der umfassenden ökologischen Krise, leisten? Welchen zukünftigen Weg könnte eine zeitgemäße Ästhetik beschreiten? Der Autor nimmt Abschied von veralteten ästhetischen Begriffen wie Schein, Mimesis, dem Werkbegriff und von Wahrheitstheorien aller Art sowie von der durch Hume und Kant begründeten Urteilsästhetik. In gut kantischer Manier unterzieht Fuller alles einer Prüfung, auch etwa die empirische Ästhetik und den Schönheitsbegriff. Ins Zentrum seiner Theorie rückt er stattdessen die subjektive ästhetische Erfahrung, d.h. die Rezeptionsästhetik. In drei materialreichen Kapiteln fragt er anschließend nach den heutigen Bedingungen von ästhetischer Alltags-, Natur- und Kunsterfahrung. Um zu einer Neuausrichtung der gegenwärtigen und zukünftigen Ästhetik zu gelangen, bezieht Fuller auch außerästhetische Theorien wie etwa die Choice Theory, die Material Culture Studies und Emotionstheorien in seine Überlegungen mit ein. Es gilt, der Subjektivität ästhetischer Erfahrungen jeden Freiraum zuzugestehen und den Blick zu schärfen für das heute drängendste ästhetische Problem: die Gewinnung eines neuen Naturverhältnisses im Angesicht der ökologischen Weltvernichtung. Darüber hinaus ist es Fuller ein Anliegen, das ästhetische Spektrum geografisch-kulturell für die im Entstehen begriffene, in seinem Buch mehrfach diskutierte und angewandte Globalästhetik zu öffnen. Inhaltsverzeichnis
Einleitung 7
Vorrede: Von den Krisen 11 Keine ästhetische Krise 25 Empirische Ästhetik 57 Götterdämmerung des ästhetischen Urteils 89 Die Rückkehr der Schönheit 117 Ästhetische Erfahrung I: Alltagsästhetik 153 Ästhetische Erfahrung II: Die Natur als Gewesene 187 Ästhetische Erfahrung III: Emotionen in der Literaturrezeption 227 Anmerkungen 277 Personenregister 317 |
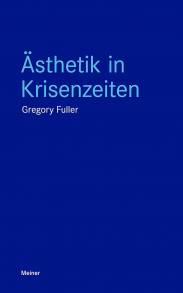
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen