|
|
|
Umschlagtext
Diagnostik "von den Stärken ausgehend" versucht, das Kind aus der Sicht seiner jeweiligen Stärken besser zu verstehen. Im Vordergrund dieses Vorgehens steht die Vorstellung, daß man davon abgehen sollte, sich mit den Schwierigkeiten und Problemen zu beschäftigen, sondern mehr mit den bereits vorliegenden und zu entwickelnden Kompetenzen - also eine Sichtweise auf das Kind in seinen prinzipiellen Schwerpunkten und Möglichkeiten und weniger als Träger von Eigenschaften, die seine Entwicklung bestimmen.
Diese individualisierende Sichtweise wird von den neuen sonderpädagogischen Regelungen nahegelegt, die sich seit Beginn des Schuljahres 1996/97 auch für Nordrhein-Westfalen ergeben haben. Hier wird nun der Versuch unternommen, für diese Zielrichtung neue Inhalte vorzustellen: also in der Praxis und in der Theorie neue Wege zu beschreiten. Die Zielrichtung der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist eine andere, als die bisherige Zielsetzung des Auslesebedarfs. Zu dieser Sichtweise gehören: eine Darstellung des Wandels von der Selektionsdiagnostik (Sonderschulaufnahme-Verfahren) zum neuen Verfahren der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs; des inhaltlichen Wandels vom Denken in Klassifikationen und Typologien zur Betrachtung der individuellen Stärken und Schwächen des Kindes; des Wandels von der Diagnostik im Sinne der Sonderschule hin zu einer lernbegleitenden Diagnostik für die allgemeine Schule; des Wandels von der testorientierten Diagnostik zu den "testfreien" Methoden. Um den Lesern die neuen Aufgaben zu erleichtern, finden sich viele Beispiele und Hinweise. Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bringt uns dazu, andere Wege im Sinne einer größeren Individualisierung zu beschreiten und uns von den Typologisierungen zu verabschieden; im Handbuchteil zur Arbeit mit IEP's (Individuellen Entwicklungs-Profilen), wird die Zusammenstellung von Daten zur Förderung eines Kindes in seinem Lebenslauf geschildert, mit vielen Hinweisen und praktischen Beispielen zur neuen Strategie. Es werden die ersten Schritte zur Feststellung des individuellen Förderbedarfs beschrieben, die zur Erstellung eines IEP führen. Anhand von Beispielen wird in die Arbeit mit den IEP's eingeführt. Ergänzend wird eine Leitangabe für das sonderpädagogische Beratungsgutachten gemacht. In einem weiteren Teil werden dann die Schritte zur diagnostischen Urteilsbildung über die didaktische Abfolge für die Klassen 1-6 geschildert. Hier werden anhand von Beispielen die Grundlagen beschrieben, wie mit neuen Methoden gearbeitet werden kann, um die Bindung an psychometrische Tests zu überwinden. Ergänzend werden verschiedene Wege geschildert, zu Berichten über Kinder zu kommen. Kopiervorlagen für diverse Arbeitsunterlagen runden dieses praxisbezogene Handbuch ab. Rezension
Klassische Intelligenztests werden seit langem in der Sonderpädagogik als sehr problematisch betrachtet, da sie eindimensional und oft defizitorientiert sind und vor allem den Blick auf die Gesamtheit eines Menschen inmitten seines häuslichen, sozialen und personalen Kontext vermissen lassen. Im Zuge des Paradigmenwechsels, in dem man sich bemüht, Menschen mit Behinderung nicht durch das zu beschreiben, was sie NICHT können, sondern versucht, ihre individuellen Kompetenzen in den Vordergrund zu stellen, ist es nur allzu logisch, dass sich diese neue Sichtweise auch in einer veränderten diagnostischen Praxis äußern muss. Statt Festschreibungen ist nun eine prozessbegleitende Diagnostik gefordert, die zum Ziel hat, diese Kompetenzen zu entdecken, aufzugreifen und auf dieser Grundlage Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung zu entwerfen.
Eggert's Buch liefert für dieses Vorhaben eine wichtige theoretische Fundierung und gibt praxisnahe Beispiele und Anregungen für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer solchen Lernförderdiagnostik. Konkrete, praxisnahe Beispiele und vor allem die vielen Vorlagen, die sich für die eigene Dokumentation sehr gut übernehmen lassen, geben dabei einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten, die sich aus einer so veränderten Vorgehensweise für die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten ergeben. B. Lensch, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Autoren-Informationen Prof. Dr. Dietrich Eggert ist seit 1971 Professor für Psychologie bei sonderpädagogischem Förderbedarf am Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Universität Hannover. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen u. a. Förderdiagnostik und die stetige Weiterentwicklung von theoretischen Konzepten und praktischen Möglichkeiten im Bereich der Psychomotorik. Im Curriculum Psychomotorik werden an der Universität Hannover Studenten aller Lehrämter und Diplompädagogen für eine (schul-)praktische psychomotorische Tätigkeit ausgebildet. Beschreibung Die meisten Anwendungsgebiete diagnostischen Handelns finden sich in der Sonderpädagogik. Hier findet im Moment ein schneller Wandel von den „Auslese-Diagnostikern“ zu den „Feststellern“ der sonderpädagogischen Förderung statt. Die „Testanwender“ werden von den Gegnern einer testgebundenen Auslese abgelöst. Für diesen Wandel versucht dieses Buch Hilfestellungen zu geben. Aus einer neuen, positiven Sichtweise des Verfahrens zur Feststellung des Sonderpädgogischen Förderbedarfs werden viele neue Hinweise gegeben, sich dieser Aufgabe mit neuem Elan zu widmen und für die betroffenen Kinder nach neuen Wegen in der allgemeinen Schule zu suchen. Um dem Leser die neuen Aufgaben zu erleichtern, finden sich viele Beispiele und Hinweise: ein Textteil mit einem Textversuch des Autors zu dem weitgreifenden Wandel der diagnostischen Grundvorstellungen von der Auslese zur Förderungsorientierung. Hier wird der Wechsel von einer Auslese- zu einer Förderungsdiagnostik beschrieben. Ein Versuch wird unternommen, von den ersten Quellen der Auslesediagnostik auszugehen und den großen Wandel darzulegen, der uns jetzt dazu bringt, neue Wege in der Diagnostik zu beschreiten. Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bringt uns dazu, andere Weg im Sinne einer größeren Individualisierung zu beschreiten und uns von den Typologisierungen zu verabschieden; im Handbuchteil zur Arbeit mit IEP’s (Individuellen Entwicklungs-Profilen), wird die Zusammenstellung von Daten zur Förderung eines Kindes in seinem Lebenslauf geschildert, mit vielen Hinweisen und praktischen Beispielen zur neuen Strategie. Es werden die ersten Schritte zur Feststellung des individuellen Förderbedarfs beschrieben, die zur Erstellung eines IEP führen. Anhand von Beispielen wird in die Arbeit mit den IEP’s eingeführt. Ergänzend wird eine Leitangabe für das sonderpädagogische Beratungsgutachten gemacht. Rezensionen/ Kommentare „Neuere pädagogische Überlegungen fordern, lernbehinderte Kinder nicht in Sonderschulen zu unterrichten, sondern sie in einem integrativen Unterricht der Regelschule in besonderer Weise zu fördern. Für diesen Wandel von der Selektion zur Lernförderung gibt Eggert Hilfen: er vermittelt dieses neue pädagogische Denken, beschreibt die Konsequenzen, die sich hieraus für die diagnostische Praxis in der Schule ergeben, und zeigt dann, z.T. mit als Kopiervorlagen ausgearbeiteten Arbeitsmaterialien, wie mit neuen diagnostischen Methoden gearbeitet werden kann.“ ekz-Informationsdienst „Ein Buch zwischen den Welten der alten, hierarchisch verwalteten, Kinder verwaltenden Schule und einer zukünftigen, an den Lehr- und Lernbedürfnissen der Kinder orientierten Begleitung!“ Fachverband integrative Lerntherapie Inhaltsverzeichnis
Vorwort (11)
1. Von der Kritik an der Diagnostik zu einer neuen Utopie der Integration (17) 2. Vom Wandel der Schule für Lernbehinderte (25) 2.1 Welche Probleme sind geblieben bzw. jetzt neu? (29) 2.2 Probleme bei der Realisierung des Integrationsanspruches (31) 2.3 Ein beispielhaft konstruiertes Modell für Integration in der Praxis (32) 2.4 Was sind die im Beispiel verborgenen Essentials für eine erfolgreiche Integration und wo läge die unterste Grenze des Machbaren? (33) 2.5 Motto: Neue Konzepte werden von Menschen gemacht (35) 3. Die Aufgabe der Diagnostik in einem sich wandelnden Bild (37) 3.1 Zu den Begriffen (38) 4. Traditionelle Sichtweise: Klassifikation und Typologisierung (41) 4.1 Frühe Versuche, den “Blödsinn” zu klassifizieren (41) 4.2 Versuche wissenschaftlich begründeter Klassifikationen (43) 4.2.1 Die Messung der Intelligenz nach BINET (44) 4.2.2 Intelligenztests nach WECHSLER (46) 4.2.3 Niveauspezifische Methoden: die Testbatterie für geistig behinderte Kinder (49) 4.2.4 Unbrauchbarkeit von Klassifikationen nach Intelligenztests (50) 4.3 Abkehr von der Klassifikation (53) 4.4 Bewegung gegen die Etikettierung (54) 4.5 Probleme der Praxis angesichts des Verzichts auf Klassifikationen (55) 5. Der Paradigmenwechsel im Bild von Menschen mit Behinderungen (57) 5.1 Von der Konstanz- zur Veränderungsannahme (57) 5.2 Von der Segregation zur Integration (59) 5.3 Von der Typologie und Klassifikation zur Individualisierung (60) 5.4 Wege zur individuellen Beschreibung und Beurteilung (61) 6. Die Bedeutung des Paradigmenwandels (67) 7. Das Unbehagen an der Diagnostik (71) 8. Argumente für und wider die “klassische” Testdiagnostik (81) 8.1 Zur systemimmanenten Argumentation: kritische Neu - Bewertung der Gütekriterien aus pädagogisch/therapeutischer Sicht (81) 8.1.1 Zur Annahme eines “wahren” Wertes als Grundlage der klassischen Testtheorie (81) 8.1.2 Analyse der für Tests geltenden Gütekriterien (82) 8.2 Übergreifende Kritik an Methoden der klassischen Testkonstruktion (91) 8.3 Klassische Denkfehler sonderpädagogischer Diagnostik (92) 8.4 Ein nicht unwichtiges Zusatzproblem: die handwerkliche Qualifikation von Testanwendern (94) 9. Abschied von linearen Einfachmodellen “der” Lernbehinderung (99) 10. Über den Wandel in den Vorstellungen von der Brauchbarkeit der Diagnostik im Zusammenhang mit dem Wandel der Modelle (107) 11. Der Paradigmenwechsel in seiner Bedeutung für neue Strukturen (111) 12. Lernförderungsdiagnostik im Team als neue Perspektive (115) 12.1 Prinzipien und Ziele der Förderdiagnostik (115) 12. Neue Aufgaben für Sonderpädagogen: Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (119) 12.3 Ziele einer Lernförderungsdiagnostik im Team (125) 13. Methoden einer qualitativen Lernförderungsdiagnostik (129) 13.1 Förderdiagnostische Variation von Aufgaben herkömmlicher Tests unter Verzicht auf eine quantitative Analyse (129) 13.2 Diagnostische Inventare in der Psychomotorik (133) 13.2.1 Das Diagnostische Inventar Motorischer Basiskompetenzen (DMB) (135) 13.2.3 Das diagnostische Inventar auditiver Alltagssituationen (DIAS)(137) 13.2.4 Das Diagnostische Inventar taktil- kinästhetischer Aufgaben (DITKA)(138) 13.2.5 Beispiele für die Arbeit mit Inventaren (140) 13.3 Informelle Aufgabensammlungen: diagnostische Papiere (145) 13.4 Einzelfallbeschreibung (150) 14. Diagnostische Menüs (157) 14.1 Menü für ein Screening mit Schulanfängern (157) 14.2 Menü für eine Untersuchung von Kindern der zweiten Klasse (159) 14.3 Ein weiteres Menü für 3 - 4 jährige Kinder (161) 15. Individuelle Entwicklungspläne als integrierende Zusammenfassung der diagnostischen Informationen und als Lernprozeßbegleitung (163) 15.1 Grundlagen Individueller Entwicklungspläne (I-E-P) (163) 15.2 Ein Berichtsformular für einen Individuellen Entwicklungsplan (I-E-P) (165) 15.3 Die “Säulen” eines Individuellen Entwicklungsplans (I-E-P) (171) 15.4 Erfahrungen im Umgang mit Individuellen Entwicklungsplänen (I-E-P) (172) 16. Das sonderpädagogische Beratungsgutachten im Zusammenhang mit der Förderung - schriftliche Zusammenfassung der ermittelten Daten (173) 16.1 Das Beratungsgutachten im Kontext der Lernförderungsdiagnostik (173) 16.2 Zwei verschiedene Vorgehensweisen bei der Begutachtung: Expertengutachten gegen individuelle Entwicklungspläne (173) 16.3 Kompetenzen für ein sonderpädagogisches Beratungsgutachten (176) 16.4 Aufgaben für ein Beratungsgutachten (176) 16.4.1 Arbeitsteilung zwischen Grundschulbericht, Beratungsgutachten und Aussagen der Förderkommission (177) 16.4.2 Was an Informationen in einem Beratungsgutachten enthalten sein sollte und was es ermöglichen sollte (178) 16.4.3 Zielsetzungen für ein Beratungsgutachten (178) 17. Wie man einen Bericht oder ein Gutachten schreibt (183) 17.1 Wie sollte ein gutes Gutachten aufgebaut sein und was sollte es enthalten (183) 17.1.1 Grundsätzliches zum Aufbau eines Gutachtens (183) 17.1.2 Negative Beispiele (185) 17.1.3 “Goldsätze” und “Giftsätze” (190) 17.1.3.1 “Goldsätze” (190) 17.1.2 “Giftsätze” (193) 17.2 Von den Stärken ausgehen... (196) 17.3 Weitere Beispiele (201) 18. Kriterien für die Einschätzung der Qualität einer individuellen Diagnostik (211) 18.1 Zur Frage der Reichweite der Interpretationsfähigkeit der Daten (211) 18.2 Denkbare Einwände gegen eine qualitative Lernförderungsdiagnostik: zur Frage der Qualität der gewonnen Daten (216) 18.3 Die Frage der ökologischen und kommunikativen Validität (218) 18.4 Weitere mögliche Einwände (219) 18.4.1 Hoher Zeitaufwand für qualitative Diagnostik? (219) 18.4.2 IEP´s ungeeignet für schulische Entscheidungen? (219) 19. Die Rolle des Psychologen in der interdisziplinären Kooperation im Interesse des behinderten Menschen (221) 20. Exkurs: Wege zu einer systemischen Diagnostik (223) 20.1 Diagnostik und Therapie im medizinischen Modell (225) 20.1.1 Der immobilisierte Körper als Grundlage der Messung (226) 20.1.2 Modelle von Therapie und Heilung (229) 20.1.3 Probleme bei der Übertragung dieses Modells in die Sozialwissenschaften (231) 20.2 Ein anderes Verständnis von Diagnostik (232) 20.2.1 Eine Fülle von Einflüssen strömen auf den Menschen ein (232) 20.2.2 Die Bedeutung der Aufgabe und der Situation (235) 20.2.3 Diagnostik ist Beziehung (238) 20.3 Bausteine zu einer systemischen Diagnostik (240) 20.3.1 Was wollen wir unter “systemischem Ansatz” verstehen? (240) 20.3.2 Systemische Diagnostik (241) 20.3.3 Ein Beispiel für eine systemische Diagnose bei motorischen Problemen (249) 20.3.4 Ausblick (257) Literaturangaben (259) Individueller Entwicklungsplan (I-E-P) (267) Eine Einführung in die Arbeit mit dem I-E-P (267) Vorstellungen und Ziele für die Bereiche (269) Formulare des I-E-P (Kopiervorlage) (289) Anhang zum I-E-P (309) Erläuterungen zum I-E-P (325) Beispiele ausgefüllter I-E-P's (344) Ali (345) Sven (363) Sören (383) Susi (403) Paul (425) Leitfaden für ein sonderpädagogisches Beratungsgutachten (443) Allgemeine Hinweise (445) Formular (449) Erläuterungen (465) |
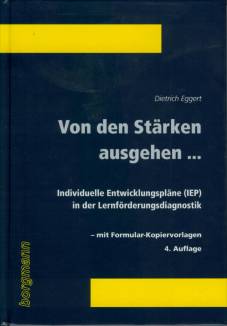
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen