|
|
|
Umschlagtext
Kompendienartig gerafft und klar geschrieben, wird ein breiter, stark praxisbezogener Überblick über Methoden des Unterrichts geboten. Für die vierte Auflage wurde der Band aktualisiert und erweitert.
Im Kapitel 1 wird durch Basisinformationen zu traditionellen Unterrichtsmethoden eine Grundstruktur für das Thema erarbeitet. Kapitel 2 stellt die Konzepte adaptiven und offen-kommunikativen Unterrichts vor, die zunehmend die Lernrealität bestimmen. In den folgenden Kapiteln werden dann ausführlich sowohl konventionelle Infrastrukturen des Unterrichts (Lernanregungen, Lehrtechniken) als auch verschiedene alternative Unterrichtsmethoden dargestellt. Rezension
Diese Darstellung bietet einen Überblick über die Vielfalt von Unterrichtsmethoden. Zwar ist Methodik keineswegs alles, was guten Unterricht ausmacht, und Didaktik ist sicherlich mehr als nur Methodik, - aber Unterrichtsmethoden sind zweifelsfrei von elementarer Bedeutung für die Lehrerausbildung und die Unterrichtspraxis. Vermutlich ist für guten Unterricht die Kenntnis und Anwendung vielfältiger Unterrichtsmethoden sinnvoll; darauf verweist auch der Titel des Buchs: Variable Lernwege! Im Kapitel 1 wird durch Basisinformationen zu traditionellen Unterrichtsmethoden eine Grundstruktur für das Thema erarbeitet. Kapitel 2 stellt die Konzepte adaptiven und offen-kommunikativen Unterrichts vor, in den folgenden Kapiteln werden dann ausführlich sowohl konventionelle Infrastrukturen des Unterrichts (Lernanregungen, Lehrtechniken) als auch verschiedene alternative Unterrichtsmethoden dargestellt.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Aus dem Inhalt: 1. Methoden des Unterrichts - ein Überblick 2. Neuere komplementäre Konzepte erfolgreichen Unterrichts 3. Der Gesamtrahmen des Unterrichts: Zwischen Vermittlung und neueren Lernarrangements 4. Konventionelle Infrastrukturen des Unterrichts 5. Das Rollenspiel - Spiel oder Lernmethode? 6. Alternative Unterrichtsmethoden 7. Zur Konstruktion von Lernorten und Lernwelten Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Zwischen Rezept und Theorie zum Konzept 11
1. Methoden des Unterrichts – ein Überblick 13 Der Problembereich – Historische Befunde – Gegenwärtiger Diskussionsstand – Prämissen 1.1 Modellierungen von Methodenkonzeptionen und Beschreibung von Methoden 17 1.1.1 Das klassische Lehrkonzept 18 1.1.2 Unterricht als Arrangement 19 1.1.3 Methodenrepertoires als Organisationsangaben 21 1.1.4 Adressatenorientierte Unterrichtsmethoden 23 1.2 Perspektiven und Forschungsanregungen 26 Lehrer- und Lernerorientierung – Neuer Bezug von Unterrichtsmethoden und Lerninhalten 1.3 Die Auseinandersetzung mit der Sache in ihrer Bedeutung für schülergemäßes Fordern und Fördern 29 Das Problem: Beziehungsprobleme stehen im Vordergrund – Der Kernpunkt: Die Auseinandersetzung mit der Sache – Sachanalyse und didaktische Analyse – Was kann die Sache sein? – Was bedeutet dann der Begriff „Auseinandersetzung“? – Grundmodi der Auseinandersetzung – Bilanz 2. Neuere komplementäre Konzepte erfolgreichen Unterrichts 38 2.1 Adaptiver Unterricht 38 Ausgang – Die Kerngedanken des Konzepts adaptiven Unterrichts 2.1.1 Erste Konkretisierung: Orientierung an Lernstrategien 39 Die Infrastruktur adaptiven Unterrichts – Auswahl und Festlegung der in Frage kommenden Unterrichtsstoffe – Festlegung und Überprüfung eines Erfolgskriteriums – Rückmeldungsmanagement – Alternative Lehr-/Lernstrategien – Zeitressourcen 2.1.2 Zweite Konkretisierung: Lernen/Lerndiagnose/Lückenschließendes Lernen 41 2.1.3 Dritte Konkretisierung in alternativer Sicht: kommunikativer adaptiver Unterricht 42 Multidimensionale Differenzierung 2.1.4 Vierte Konkretisierung: Rahmenbedingungen für die multidimensionale Differenzierung als adaptiver Unterricht 45 Flexibler Fächerkatalog – Die lerntheoretische Infrastruktur 2.1.5 Zusammenfassende Bemerkungen 45 2.2 Kommunikativer und offener Unterricht 48 Herleitung des Themas 2.2.1 Bestimmungsmerkmale kommunikativen und offenen Unterrichts 49 Kommunikativer Unterricht – Kommunikationsprobleme – Offener Unterricht – Probleme offenen Unterrichts 2.2.2 Konkretisierungsansätze für kommunikativen und offenen Unterricht 53 Unterricht als kommunikativer Prozess – Unterricht als Vermittlungsprozess – Rahmen und Spielraum – Probleme curricularer Konstruktion 2.2.3 Unterricht als organisierter Lernprozess 64 Zeitbudget – Kooperation der Lehrer – Flexible Raumnutzung und -ausstattung – Lernmaterialien 2.2.4 Zusammenfassende Bemerkungen 67 3. Der Gesamtrahmen des Unterrichts: Zwischen Vermittlung und neueren Lernarrangements 68 3.1 Grundlegung: Die drei Curricula schulischer Institutionen 68 3.1.1 Das Curriculum der Lerninhalte/Sachkompetenzen 68a 3.1.2 Das Curriculum der sozialen Kompetenzen 68a 3.1.3 Das Curriculum der Lernkompetenzen 68b 3.2 Das dreidimensionale Arrangement komplexer Lernsettings 68b 3.2.1 Lehrerorientierte Settings 68b 3.2.2 Lernerorientierte Settings 68d 3.2.3 Kommunikativ orientierte Settings 68h 3.3 Die Konsequenzen für die Organisation des Unterrichts 68j 4 Konventionelle Infrastrukturen des Unterrichts 71 4.1 Methodik der Lernanregungen 71 Das Problem – Problemlösungen unterschiedlicher Reichweite – Die Grundfolie: Lernprozess und Unterrichtsprozess 4.1.1 Der anthropologische Aspekt: Motivation oder Entwicklung von Sinn, Relevanz. Interesse? 75 4.1.2 Der methodische Aspekt: Lernanregungen als Unterrichtsstrategien 79 Der informierende Unterricht (Aufklärungsstrategie) – Der direkte, am Unterrichtsgegenstand Lernanregungen entwickelnde Unterricht (Konfrontationsstrategie) – Der indirekte, über Handlungen und Medien Lernanregungen schaffende Unterricht (Startrampen-Strategie) 4.1.3 Zusammenfassende Bemerkungen 85 4.1.4 Beziehungsorientierte Unterrichtsmethoden 87 Einleitung – Vier modellartige Ansätze 4.2 Lehrtechniken 96 4.2.1 Das Veranschaulichen 96 Vorbemerkungen – Erste Überlegungen: Anschaulicher Unterricht als erkenntnistheoretisches und ideologiekritisches Problem – Zweite Überlegung: Anschaulicher Unterricht als lernpsychologisches Problem – Dritte Überlegung: Anschaulicher Unterricht als didaktisch-methodisches Problem – Fixpunkte anschaulichen Unterrichts 4.2.2 Das Problematisieren 102 Problem – Möglichkeiten der Problementwicklung – Hilfen zur Problemlösung – Die Einschätzung des Ergebnisses: Lösungsfeststellung 4.2.3 Das Anregen und Fragen 109 Die Frage – Die Aufforderung – Weiterleitende Äußerungen – Mimik. Gestik. Gebärde – Stumme Impulse – Der Auftrag – Sach-Impulse 4.2.4 Das Informieren 116 Vier Gesichtspunkte einer didaktisch gestalteten Information – Didaktik der Informationsvermittlung 4.2.5 Das Strukturieren 122 Ausgang – Strukturieren als geordnetes Sammeln – Strukturieren als Problemaufriss – Strukturieren als Systematisieren – Strukturieren als Ordnen – Strukturieren als Ortsbestimmung – Strukturieren als Planungsaufriss – Funktionen des Strukturierens 4.2.6 Das Üben und Wiederholen 125 Kollektives Üben und Wiederholen – Erste praktische Konsequenzen – Lernen lehren: Anregungen für ein Eigenkonzept zum Lernen – Weitere praktische Konsequenzen – Individuelle Lernstrategie „Planvoll üben und wiederholen" 4.2.7 Das Metakommunizieren. erörtert am Beispiel des wahldifferenzierten Unterrichts 134 Die „Meta-Diskussion" in Pädagogik und Psychologie – Die Grundintention wahldifferenzierten Unterrichts und die Bedeutung der Metakommunikation – Paradigmenwechsel als langfristiges Ziel: Vom Stellvertreter-Modell zu einem interaktionistischen Modell der Unterrichtsplanung, -durchführung und -ausweitung 4.3 Gruppenarbeit 141 Terminologische Verabredungen – Didaktische Vorbereitung – Klärung der Zweckfrage – Adressatenanalyse – Didaktik der Kommunikation – Erfolgskontrollen für die Gruppenarbeit – Zusammenfassende Bemerkungen 4.4 Differenzierende Verfahren schulischen Unterrichtens 149 Das Problemfeld – Definition: Differenzierung, -skriterien, -sebenen – Leistungsdifferenzierung – Interessendifferenzierung – Binnendifferenzierung 4.5 Funktionen und Formen individualisierender Lernmaterialien 156 Lehr-, Lern-, Arbeitsmittel. Unterrichtsmedien oder Lernmaterialien? – Objektivierung oder Manipulation des Lernens durch Lernmaterialien? 4.5.1 Formen 158 4.5.2 Funktionen 160 4.5.2.1 Allgemeine Funktionen 160 4.5.2.2 Spezielle Funktionen 163 Sachstrukturelle Überlegungen für die Konstruktion von Lernmaterialien – Lernpsychologisch bestimmte Medienstrukturen – Unterrichtsstruktur „Zielerreichendes Lernen" – Unterrichtsstruktur „Selbstorganisation des Lernens mit Hilfe eines Medienverbundes“ – Unterrichtsstruktur „Autonomisierung des Lernens“ – Lernen mit dem Computer und dem Internet 4.5.3 Zusammenfassende Bemerkungen 171g 4.6 Die Moderationsmethode 171g Begriffliches – Die Moderationsmethode – Verfahrenstransparenz – Einstieg – Orientierungsphase – Problem- bzw. Themenbearbeitung – Ergebnissicherung – Abschluß – Fragen formulieren – Visualisierung (Metaplan-Technik) – Strukturieren – Blitzlichter (Befindlichkeiten rückmelden lassen) – Ergebnispräsentation – Die Kultivierung der Beziehungsebene – Die Moderatorenrolle – Die Mediation – Standpunkte vortragen – Lösungen finden – Vereinbarungen schriftlich einhalten – Nach der Schlichtung – Schluß – Literaturhinweise 5. Das Rollenspiel – Spiel oder Lernmethode? 173 Annäherungen – Das Rollenspiel – Das Rollenspiel als Lernspiel —Zusammenfassende Bemerkungen 6. Alternative Unterrichtsmethoden 186 6.1 Einführung: Selbstverantwortetes Lernen und adäquate Unterrichtsstrukturen 186 Kurze definitorische Bestimmungen – Die Begründung selbstverantworteten Lernens – Die zur Verfügung stehenden Teilkonzepte – Die Veränderung der Lehrer/innenrolle 6.2 Projektlernen, z.B. in der Grundschule 196 Annäherungen – Definitorische Festlegungen – Zentrale Grundlagen didaktischer und lernpsychologischer Art – Praktische Konsequenzen – Inhaltliche Aspekte – Alternativer Unterricht – Anfang, Planung und Ergebnis von Projekten – Planungsdidaktik – Reduktionen inhaltlicher, verfahrensmäßiger und zeitlicher Art – Zwei Beispiele und ihre Charakterisierung – Zusammenfassende Bemerkungen: Dimensionierung von Ernstsituationen 6.3 Handlungsorientierter Unterricht 210 Vorbemerkungen – Ein problematisches Beispiel am Anfang – Bestimmungsmomente handlungsorientierten Unterrichts (Übersicht 1) – Die Reinform handlungsorientierten Unterrichts (Übersicht 2) – Dimensionen handlungsorientierten Unterrichts (Übersicht 3) – Weiterungen – Offene Fragen 6.4 Lernen durch Lehren – Eine Variante handlungsorientierten Unterrichts 226 Die genauere Beschreibung der Methode – Zusammenfassung 6.5 Forschendes Lernen 234 Vorbemerkungen – Näherungen – Festlegungen: Forschendes Lernen als Lernprozess – Die unterrichtliche Folie: Situationen für forschendes Lernen – Didaktik-methodische Arrangements – Konkretisierungen – Forschendes Lernen im Physikunterricht – Forschendes Lernen im Geschichtsunterricht 6.6 Erkundungen 248 Das Problem – Unterrichtsgang – Erkundung – Schritte des Vorgehens – Ein Beispiel für eine Erkundung 6.7 Praktika 254 Beispiel: Berufs- und Betriebspraktikum für Schüler – Zielvorstellungen – Mögliche Verlaufsgestalten – Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Praktikums – Weitere zu beachtende Einzelheiten – Zusammenfassende Bemerkungen 7. Zur Konstruktion von Lernorten und Lernwelten 262 7.1 Simulierte Wirklichkeiten – Zwischen verbaler Vermittlung und außerschulischem Lernort 262 Das Problem – Didaktische Ausmessung der simulierten Wirklichkeit am Beispiel „Verkehr“ – Simulierte Wirklichkeiten in unterschiedlicher Konstruktion und damit abgestufter Wirklichkeitsnähe – Zusammenfassung 7.2 Lernwerkstätten – Anregungsstrukturen und Lernmöglichkeiten 269 Begriff und Begriffsumfeld – Didaktisch-methodische Systematisierung der Lernmöglichkeiten – Lernwerkstätten in Universitäten und Lehrer/-innenfortbildungseinrichtungen Literatur- und Anmerkungsapparat für die einzelnen Kapitel 281 Allgemeines Literaturverzeichnis: Unterrichtsmethoden 302 |
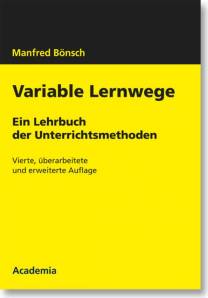
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen