|
|
|
Umschlagtext
Die Fortschrittsdynamik der postmodernen Gesellschaft und die Individualisierung sozialer Beziehungen verlangen vom Einzelnen viele Entscheidungen im Alltag (u.a. hinsichtlich des Konsum- und Lebensstils, der religiösen und sozialen Orientierung, des Studiums und des Berufs, aber auch hinsichtlich sozialer und politischer Streitfragen in der Gesellschaft). Verantwortliche Urteilsbildung gilt daher als eines der wichtigsten Erziehungsziele in der Allgemeinen Pädagogik und Didaktik wie auch in den Richtlinien und Lehrplänen. Aber es ist weitgehend unklar, wie Urteils-Bildung strukturiert, elementarisiert und in Prozessen eingeübt werden kann. Die in diesem Band versammelten Beiträge renommierter Autoren aus den Disziplinen Pädagogik, Philosophie und Psychologie zeigen auf, dass und wie verantwortliche Urteils-Bildung bei (jungen) Menschen gefördert werden kann, u.a. wenn sie bestimmte Regeln der Urteilsbildung beachten und im Diskurs mit anderen an der Qualität der Urteile arbeiten. Der Urteils-Bildungs-Prozess wird anhand ausgesuchter Streitfälle auf beiliegender DVD exemplarisch verdeutlicht.
Prof. Dr. Wolfgang Sander, Hochschullehrer (i.R.) am Institut für Erziehungswissenschaft der Westf. Wilhelms-Universität in Münster (Forschungsschwerpunkte: Erziehungsphilosophie, Urteilsbildung, Curriculumentwicklung in der politischen Bildung, Neue Medien im Unterricht) Christian Igelbrink, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Erziehungswissenschaft der Westf. Wilhelms-Universität in Münster (Forschungsschwerpunkte: Erziehungsphilosophie, Urteilsbildung, Geschichte der Erziehung, Theorie und Praxis der Lehrerbildung) Prof. Dr. Friedhelm Brüggen, Institut für Erziehungswissenschaft der Westf. Wilhelms-Universität in Münster (Forschungsschwerpunkte: Theoriegeschichte der Pädagogik, Erziehungs- und Bildungsphilosophie, Sozialisations- und Schultheorie) Rezension
Im Alltag benutzt man den Begriff „Urteil“ zur Bezeichnung einer Aussage, die eine bestimmte Position über eine Person oder über einen Sachverhalt zum Ausdruck bringt, meist unter Verwendung eines Wertbegriffs. Da Urteilsbildung, verstanden als Prozess und Ergebnis des Urteilens, als Beitrag zur Mündigkeit von Schülerinnen und Schüler gilt, wird sie in mehreren Bildungsplänen als das Hauptziel bestimmter Fächer ausgewiesen. Beispielsweise sollen nach dem baden-württembergischen Bildungsplan 2016 alle Schülerinnen und Schüler, die den Ethikunterricht besuchen, zur „ethisch-moralischen Urteilsbildung in praktischer Absicht“ (http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016 BW/ALLG/GYM/ETH) befähigt werden. In den „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Ethik“, beschlossen 1989 von der Kultusministerkonferenz, wird von den Schülerinnen und Schülern „ethische Urteilsbildung“ (https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/unterrichtsfaecher/religion-ethik-philosophie.html) gefordert. Seit fast 40 Jahren ist Urteilsbildung zudem als zentrales Unterrichtsziel sozialwissenschaftlicher Fächer etabliert. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung in der Didaktik der politischen Bildung hatte der Münsteraner Erziehungswissenschaftler Wolfgang Sander, der Anfang der 1980er Jahre sein „Modell politisch-moralischer Urteilsbildung“ entwickelte, nach dem der Prozess der Urteilsbildung sieben Phasen zu durchlaufen hat.
Zur Förderung der Urteilsbildung von Studierenden dient der von ihm, Christian Igelbrink und dem Erziehungswissenschaftler Friedhelm Brüggen 2014 herausgegebene Band „UrteilsBildung“, in dem die „lösbare pädagogische Herausforderung“ multiperspektivisch, d. h. hier allgemeinpädagogisch, philosophisch, moralpsychologisch und didaktisch, anhand fundierter Beiträge renommierter Wissenschaftler beleuchtet wird. Die in dem Buch abgedruckten Texte stammen bis auf drei Erstveröffentlichungen aus Büchern, Aufsatzbänden und Zeitschriften, erschienen zwischen 1976 und 2012. Daher gibt der Band zugleich einen guten Einblick in die Geschichte des interdisziplinären Diskurses „Urteilsbildung“. Angesichts globaler Krisen in der Spätmoderne, z. B. der Ökologie, der Demokratie und der menschlichen Psyche, ist das Anliegen der Münsteraner Autoren nicht nur als verdienstvoll anzusehen, sondern es erscheint geradezu als geboten, dass zumindest alle Studierenden der Erziehungswissenschaft, insbesondere alle angehenden Lehrpersonen zur Orientierung im Studium die Möglichkeit erhalten, ihre eigene reflektierte und damit ethisch konturierte Urteilsbildung zu fördern. Damit könnte auch der in der „Beschleunigungsgesellschaft“(Rosa) verbreiteten „Halbbildung“(Adorno) entgegengewirkt werden. Dieser gefährlichen gesellschaftlichen Entwicklung leistet allerdings eine Abhandlung des Buches Vorschub, nämlich die erstmals veröffentlichte des Erziehungswissenschaftlers Heinz Schirp. Der Beitrag zur Neurodidaktik fällt weit hinter das Reflexionsniveau der anderen Texte des Sammelbandes zurück, da in ihm Neuromythen unreflektiert, unter Ausblendung des wissenschaftlichen Forschungsstandes reproduziert werden, z. B. Neurokonstruktivismus, Spiegelneuronen-Hypothese, sozialer Intuitionismus. Zudem ist der von Schirp unter Bezugnahme auf Arbeiten von Humberto Maturana und Gerhard Roth vertretene neuronale, „harte“ Determinismus inkompatibel zu einer Sichtweise auf den Menschen, nach der dieser über eine wenn auch bedingte Willensfreiheit verfügt, welche aber die unabdingbare Voraussetzung für eigene Entscheidungen und Urteile ist. „Schon die Urteilskraft ist Willensfreiheit im weitesten Sinn.“, betonte der Vertreter des südwestdeutschen Neukantianismus Heinrich Rickert 1921 in seinem „System der Philosophie“, um den performativen Widerspruch jeglicher Variante des Determinismus aufzudecken. Neben den Aufsätzen enthält der Band zur „UrteilsBildung“ eine hilfreiche DVD u.a. mit elf Fallanalysen von Studierenden aus dem Münsteraner Seminar „Theorie und Praxis der Urteilsbildung“. Die vorgelegten Fallanalysen orientieren sich an Sanders Modell der Urteilsbildung mit den zentralen Schritten: „Spontanurteile“, „Normative Kriterien“, „Sachverhalt“, „Einzelurteile“ und „Gesamturteil“. Die in dem Seminar gewählten Fälle zu „gesellschaftsrelevanten Themen“ wie z. B. Sterbehilfe, Organspende, Fracking können auch Gegenstand des Ethikunterrichts sein. Auffällig ist allerdings in den von studentischer Seite präsentieren Fallanalysen, dass zwar Werte, Normen und „mittlere“ Prinzipien herangezogen werden, aber kaum auf moralphilosophische Theorien wie Aristoteles` eudämonistische Ethik, Utilitarismus, Immanuel Kants deontologische Ethik oder Hans Jonas` Verantwortungsethik Rekurs genommen wird, welche beispielsweise im baden-württembergischen Ethikabitur von den Schülerinnen und Schülern erwartet werden. Bei der „ethisch-moralischen Urteilsbildung in praktischer Absicht“ kommen nach den neuen baden-württembergischen Bildungsplänen für das Fach Ethik (vgl. M. Remme: Country Report: Germany (Baden-Württemberg)- Teaching Ethics Based on the New Curricula 2016, https://www.philosophie.ch/philosophie/literatur/zeitschriften/jdph) fachspezifische Kompetenzen zum Tragen, welche der Logik des kognitiven Prozesses gerecht werden: „wahrnehmen und sich hineinversetzen“, „analysieren und Interpretieren“, „argumentieren und reflektieren, „urteilen und (sich) entscheiden“ (http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016 BW/ALLG/GYM/ETH). Zur Durchführung von Fallanalysen, einer Methode zur Schulung von Urteilsfähigkeit im Ethikunterricht, haben gymnasiale Fachberaterinnen und Fachberater für Ethik in Baden-Württemberg zudem ein in der Unterrichts- und Abiturpraxis erprobtes Modell entwickelt, das folgende Schritte umfasst: „Spontanurteil“ [nur mündlich], „Sachanalyse“, „Ethische Analyse und Abwägung“ , „Wohlbegründetes eigenes Urteil und Entscheidung“ und „(Meta-)Reflexion“ [nur mündlich] (https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/ethik/gym/bp2004/fb3/2_fall/1_schema/). Dieses Konzept könnte m.E. auch die Grundlage für die Schulung der Urteilsbildung von Studierenden sein, zumal es gegenüber dem Modell von Sander sich durch eine stringente Orientierung am „Überlegungs-Gleichgewicht“(Rawls) und einen klaren didaktischen Aufbau auszeichnet. „UrteilsBildung“, erschienen im „LIT“-Verlag, liefert den Lehrkräften, insbesondere der Fächer Ethik und Politik, fundiertes Reflexionswissen zur Geschichte und Theorie dieser in der „flüchtigen Moderne“(Bauman) fundamentalen Fähigkeit eines selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Subjekts. Zur Realisierung dieses zentralen Unterrichtsziels werden Lehrerinnen und Lehrer durch das Werk zudem angeregt, didaktisch reflektierte Unterrichtsmaterialien zu erarbeiten. Diese mögen dazu beitragen, dass gerade in einer Zeit von „Retrotopia“(Bauman) Schülerinnen und Schüler, „nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftig möglich bessern Zustände des menschlichen Geschlechts“ - so Kant 1803 in seinen Pädagogik-Vorlesungen - gebildet werden. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Wolfgang Sander/Christian Igelbrink/Friedhelm Brüggen
UrteilsBildung. Eine Herausforderung für Pädagogik und Didaktik 1 I. Allgemeinpädagogischer Teil 41 Wolfgang Sander/Christian Igelbrink/Friedhelm Brüggen Leitfragen und Diskussionsanregungen 42 Dietrich Benner Moralische Erziehung und Bildung der Moral 44 Lutz Koch Pädagogik und Urteilskraft. Ein Beitrag zur Logik pädagogischer Vermittlungen 60 Wolfgang Sander Mündige Bürger – Gerichtshöfe der Vernunft. Wie ist politisch-moralische Urteilsbildung im Unterricht möglich? 73 II. Philosophischer Teil 95 Wolfgang Sander/Christian Igelbrink/Friedhelm Brüggen Leitfragen und Diskussionsanregungen 96 Otfried Höffe Die Kritik der praktischen Vernunft 98 Wolfgang Sander Wie kann der Mensch wissen, was moralisch ist? Die Lösung des Problems in der praktischen Philosophie Kants 123 Kurt Bayertz Praktische Philosophie als angewandte Ethik 146 Volker Gerhardt Vernunft und Urteilskraft. Politische Philosophie und Anthropologie im Anschluss an Immanuel Kant und Hannah Arendt 181 III. Psychologischer Teil 199 Wolfgang Sander/Christian Igelbrink/Friedhelm Brüggen Leitfragen und Diskussionsanregungen 200 Lawrence Kohlberg Moralstufen und Moralerwerb. Der kognitiv-entwicklungstheoretische Ansatz 202 Heinz Schirp Wer entscheidet, wenn ich mich entscheide? Anmerkungen zu Urteils- und Entscheidungsprozessen aus neurowissenschaftlicher und neurodidaktischer Sicht 243 Klaus Blesenkemper Gefühle geben zu denken. Zur Philosophie der Affekte am Beispiel der Scham 280 IV. Didaktischer Teil 299 Wolfgang Sander/Christian Igelbrink/Friedhelm Brüggen Leitfragen und Diskussionsanregungen 300 Georg Lind Die Methode der Dilemmadiskussion 302 Franz-Josef Kaiser/Hans Kaminski Die Fallstudienmethode im ökonomischen Unterricht 310 Dietrich Benner Auf der Suche nach einer Didaktik der Urteilsformen und einer auf ausdifferenzierte Handlungsfelder bezogenen partizipatorischen Erziehung 331 Wolfgang Sander/Christian Igelbrink „Das ist gut für mich!“ Ein Modellprojekt zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 6/7 348 Friederike Schewe Das Modell „FairUrteilen“ in der Praxis. Urteilsbildung im Politikunterricht der Sekundarstufe I 360 Quellennachweise der Beiträge und Hinweise zu den Autoren 388 Anleitung zum Öffnen der beiliegenden Moodle-Kurse 391 Inhalt der DVD Wolfgang Sander/Christian Igelbrink Vortrag „Strukturierte Urteilsbildung auf der Moodle-Lernplattform“ Wolfgang Sander/Christian Igelbrink E-Learning-Einheit „Forum Urteilsbildung“ Gerd Homberg E-Learning-Einheit „Urteilen lernen auf der Moodle-Lernplattform“ Studierende des Seminars „Theorie und Praxis der Urteilsbildung“ (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Sommersemester 2013) Exemplarische Urteilsfälle zu aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen |
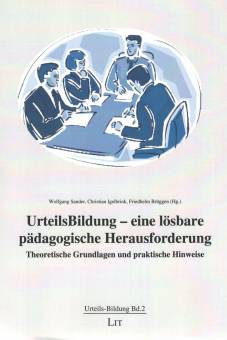
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen