|
|
|
Umschlagtext
Studieren im »Bachelor« hat es in sich: Ständig Prüfungen, überfrachtete Studienpläne, jede Note zählt, mehr Zeitdruck, Studiengebühren! – Du kennst das? Fühlst Dich unter Druck, hast Angst vor der nächsten Prüfung, oder es fällt Dir schwer, Dein Lernpensum zu bewältigen? Dann schau doch mal in dieses Buch, denn es bietet Hilfen für jede Phase des Studiums, von der Zeit kurz vor Studienbeginn bis zu den letzten Prüfungen. Die Autoren kennen alle kleinen und großen Nöte der »Studis« genau, denn sie leiten seit Jahrzehnten sehr erfolgreich eine studentische Beratungsstelle.
Alles drin ! Wie werde ich fit fürs Studium? Mit Bewegung, Ernährung, Entspannungstechniken, Genuss, Verstärkungstechniken und Selbstgesprächen Was hilft beim Lernen? Arbeitsplatz optimieren, Lernpläne erstellen, Zeitmanagement, Lern-/Gedächtnistechniken und Prüfungsstrategien Was tun im Notfall? Hilfen bei Motivations- und Konzentrationsproblemen, Prüfungsangst und Schreibblockaden Gut geschrieben ! Nicht belehrend, sondern helfend: Die Autoren schreiben in lockerer, verständlicher Sprache Mut machend: Das Buch gibt konkreten Rat, baut nach Misserfolgen wieder auf, tritt auch mal »in den Hintern« und verführt zum Lachen Mit Merksätzen, Zusammenfassungen sowie einem Bachelor-Quiz und vielen Arbeitsblättern zum Download im Internet Rezension
Studieren hat sich durch das Bachelor-Studium verändert: ständige Prüfungen, überfrachtete Studienpläne, jede Note zählt, mehr Zeitdruck, Studiengebühren. Die Folge: Studierende fühlen sich einem dauerhaften Druck ausgesetzt, viele geraten in eine Spirale der Angst und befürchten, sich durch kleine Nachlässigkeiten Ihre Zukunft für immer zu verbauen. Und besonders stark angestiegen ist: Die Prüfungsangst! Da sind die Abbrecherquoten hoch und die Beratungsangebote der Studentenwerke überlastet. - Die Autoren kennen die Nöte der „Studis" genau, denn Sie leiten die Beratungsstelle des Studentenwerks Mannheim und haben unzähligen Kommilitonen geholfen. In ihrem Ratgeber kommen Sie dann auch gleich zur Sache, immer direkt auf die Anforderungen im Bachelor bezogen: Wie rüste ich mich physisch und psychisch fürs Studium? Durch Bewegung, Ernährung, Entspannungstechniken und Genuss, Verstärkungstechniken und Selbstgespräche. Was hilft mir wirklich beim Lernen? Indem ich den Arbeitsplatz richtig einrichte, Lernpläne erstelle, ein gutes Zeitmanagement. Gedächtnistechniken und effektive Prüfungsstrategien anwende. Und was tun im Notfall? So wappnest Du Dich gegen Motivationsund Konzentrationsprobleme, Prüfungsangst und Schreibblockaden! Dieses Buch will nicht belehren, sondern helfen, in einer lockeren, verständlichen und liebevollen Sprache: Es ist ein treuer, effektiver und einfühlsamer Freund für das Studium, der durch alle Lern- und Prüfungsphasen begleitet und für (fast) alle Sorgen und Nöte einen Tipp parat hat. Es macht Mut, baut nach Misserfolgen wieder auf, gibt konkreten Rat, tritt auch mal „in den Hintern" und verführt zum Lachen. - Mit einem Bachelor-Quiz und vielen Arbeitsblätten zum Download im Internet.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Studienratgeber, der alles abdeckt: Lernstrategien, Stressmanagement, Hilfen zur Prüfungsangstbewältigung Direkte, verständliche, einfühlsame, humorvolle Sprache Von erfahrenen Studierenden-Beratern Speziell für die Anforderungen des Bachelor-Studiums Content Level » Lower undergraduate Stichwörter » Bachelor - Bachelor-Studium - Bachelorarbeit - Bologna-Prozess - Entspannungstechniken - Gedächtnistechniken - Gedächtnistraining - Konzentrationsprobleme - Lernen - Lernhilfe - Lernpläne - Lernstrategie - Lerntechnik - Lerntraining - Motivationsprobleme - Mündliche Prüfung - Prüfung - Prüfungsangst - Prüfungsstrategien - Prüfungsvorbereitung - Schreibblockaden - Schriftliche Prüfung - Selbsthilfe - Selbstmanagement - Studienhilfe - Studienmotivation - Studienratgeber - Studiertechniken - Zeitmanagement Inhaltsverzeichnis
I Wichtige Infos vorab 1
1 Revolution auf dem Campus: Die Einführung von Bachelor und Master 3 1.1 Was ist eigentlich ein »Bachelor «? 4 1.2 Bachelorabschlüsse und -studiengänge 5 1.3 Der Bologna-Prozess 6 1.4 Contra Bachelor 6 1.4.1 Arbeitsüberlastung 6 1.4.2 Verschulung 7 1.4.3 Soziale Auslese 7 1.4.4 Hohe Abbrecherquote 7 1.4.5 Eingeschränkte Akzeptanz seitens der Wirtschaft 8 1.5 Pro Bachelor 8 1.5.1 Förderung der Mobilität 8 1.5.2 Mehr Berufsnähe 8 1.5.3 Strukturiertheit des Studiums 9 1.5.4 Keine »Studi-Greisinnen und -Greise« mehr 9 2 Was ist anders? 11 2.1 Keine individuelle Studienplanung mehr 12 2.1.1 Früher? 12 2.1.2 Heute? 12 2.2 Keine Trennung mehr zwischen Grund- und Hauptstudium 12 2.2.1 Früher? 12 2.2.2 Heute? 13 2.3 Jede Note zählt 13 2.3.1 Früher? 13 2.3.2 Heute? 13 2.4 Reduzierter wissenschaftlicher Anspruch 16 2.4.1 Früher? 16 2.4.2 Heute? 16 2.5 Weitere Neurungen 17 2.5.1 Selbstauswahlrecht der Hochschulen 17 2.5.2 Einführung von Studiengebühren 17 2.5.3 Studienjahr 17 2.5.4 Anwesenheitspfl icht und Zwangsexmatrikulation 18 2.5.5 Regelstudienzeit 18 3 Welcher Bachelor soll es sein? 19 3.1 A bi machen ist nicht schwer, Student(in ) werden aber sehr! 20 3.2 Entscheidungshilfen bei der Studienwahl 20 3.2.1 Studienwunschbuch anlegen 20 3.2.2 Brainstorming und Brainwriting 21 3.2.3 Zwicky Box 23 3.2.4 Virtuelle Self-Assessments 25 3.2.5 Individuelle Testung 26 3.2.6 Stärken- und Schwächenanalyse 29 3.2.7 Realitätsprüfung 29 4 Start vor Studienstart 33 4.1 Das liebe Geld 34 4.1.1 Mögliche Finanzierungsquellen 34 4.1.2 Jobs für Studenten 35 4.2 Von Studentenbude bis »Hotel Mama « 35 4.2.1 Erkenne dich selbst 35 4.2.2 Vor- und Nachteile der einzelnen Wohnformen 36 4.3 Behördliches bei Studienbeginn 38 4.4 Where is where and who is who? 38 4.5 Haushaltsführung will gelernt sein 39 5 Von Kommilitonen und Dozenten 41 5.1 Überblick: Who is Who an den Hochschulen? 42 5.1.1 Hochschulleitung 42 5.1.2 Professoren 42 5.1.3 Akademischer Mittelbau 42 5.1.4 Nichtwissenschaftliches Personal 43 5.1.5 Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 43 5.2 Dozenten sind keine Lehrer 44 5.2.1 Das deutsche Hochschulsystem belohnt Forschung , nicht Lehre 44 5.2.2 Kein pädagogischer Auftrag für Hochschullehrer 44 5.2.3 Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden 45 5.3 Kommilitonen sind keine Mitschüler 46 5.3.1 Die amorphe Masse 46 5.3.2 Konkurrenz statt Kameradschaft ? 47 5.3.3 Fremde Welt 48 5.4 Social Skills und Knigge für Studierende 50 5.4.1 Social-Skill-Kurse 50 5.4.2 Benimmkurs e 50 5.5 Ansprechpartner bei Konflikten 52 II Die physische und psychische Ausrüstung 53 6 Bewegung und Ernährung 55 6.1 Brainfood 56 6.1.1 Nahrungsbestandteile und Gehirnleistung 56 6.1.2 Flüssigkeitszufuhr und Gehirnleistung 57 6.1.3 Man ist, wie man isst! 57 6.2 Brainfi t 59 6.2.1 Sport ist immer gut! 59 6.2.2 Bib- und PC-Gymnastik 60 7 Wege zur Entspannung 61 7.1 Was ist Entspannung ? 62 7.2 Stress und seine Auswirkungen 62 7.3 Entspannungsübungen gegen Lern- und Prüfungsstress 62 7.4 Klassische physische Entspannungsmethoden 63 7.4.1 Progressive Muskelrelaxation (PMR) 63 7.4.2 Yoga 64 7.4.3 Atementspannung 65 7.5 Mentale Entspannungsmethoden 65 7.5.1 Autogenes Training (AT) 65 7.5.2 Meditation 66 7.5.3 Phantasiereisen 67 7.6 Schlussbemerkung 68 8 Positive Verstärker und euthyme Techniken 71 8.1 Vorbemerkung 72 8.2 Prinzipien des Verstärkereinsatzes 72 8.3 Charakteristika wirkungsvoller Verstärker 73 8.4 Euthyme Techniken 74 8.4.1 Voraussetzungen für Genuss 74 8.4.2 Aktivierung der 5 Sinne 75 8.5 Unterschiede zwischen euthymen Techniken und positiven Verstärkern 76 9 Inneres Sprechen und positive Selbstinstruktionen 77 9.1 Jeder Mensch spricht mit sich selbst 78 9.2 Viele Selbstkommunikationen sind verzerrt 78 9.3 Typische Denkfehler 80 9.4 Bearbeitung von selbstschädigenden Überzeugungen 80 9.5 Positive Selbstinstruktionen 81 9.6 Mit innerem Sprechen auf Erfolgskurs 82 10 Langzeitmotivation als Erfolgsstrategie 83 10.1 Über den Sinn von Lebenszielen 84 10.2 Was sind eigentlich Lebensziele? 84 10.3 Wie findet man sie? 85 10.3.1 Lebenswunschbild als Zielcollage 85 10.3.2 Step by Step – Das Festlegen von Jahreszielen 86 10.3.3 Das SMART-Prinzip 87 10.4 Pläne B und C 88 10.5 Von der Kraft der Symbole 89 11 Studentsein gestern und heute: Vom Luftikus zum Bachelor 91 11.1 19. Jahrhundert: Lustig ist das Studentenleben 92 11.2 20. Jahrhundert: Revoluzzer an den Universitäten 92 11.3 21. Jahrhundert: Die Bachelors kommen 94 11.3.1 Ein Bachelor lebt asketisch 94 11.3.2 Ein Bachelor ist ein Krieger 95 III Das praktische Handwerkszeug 99 12 Rund um den Arbeitsplatz 101 12.1 Wohnort und Wohnform 102 12.2 Störfaktoren am Arbeitsplatz 102 12.2.1 Akustische Störfaktoren 102 12.2.2 Visuelle Störfaktoren 103 12.2.3 Klimatische Störfaktoren 104 12.3 Trennung von Arbeits- und Freizeitbereich 104 12.4 Arbeitsort 106 13 Lernpläne erstellen 107 13.1 Menge-Zeit-Berechnung 108 13.2 Kurz- und langzeitige Planung 108 13.3 Was tun, wenn die Zeit nicht reicht? 110 13.4 Länge der Arbeitsphasen 112 13.5 Planungsbesonderheiten 112 14 Zeitmanagement 113 14.1 Bachelorzeit 114 14.2 Baseline 114 14.3 Zeitbereiche 116 14.3.1 Lernzeit 117 14.3.2 Freizeit 117 14.3.3 Alltagszeit 118 14.4 Ergebnis des individuellen Zeitmanagements 118 14.5 Spezifi sche Zeitmanagementtechniken 119 14.5.1 Die ALPEN – Technik 119 14.5.2 Das Eisenhower-Prinzip 120 14.6 Vorteile von Zeitmanagementmethoden 120 14.7 Problemfälle 121 15 Effi ziente Lerntechniken 123 15.1 Karteikastenmethode 124 15.1.1 Manuelle Karteikastenmethode 124 15.1.2 Digitale Karteikastenmethode 124 15.2 SQ3R-Methode 126 15.2.1 Einzelne Schritte 127 15.2.2 Vorteile der SQ3R-Methode : 128 15.3 Mind-Mapping 128 15.3.1 Manuelles Mind-Mapping 128 15.3.2 Digitales Mind-Mapping 130 15.4 E-Learning 132 15.5 Rationelles Lesen 133 15.5.1 Hinderungsgründe für zielgerichtetes Lesen 134 15.5.2 Kognitive, visuelle und auditive Lesehilfen zum Speed Reading 135 15.6 Mach es dem Beo nach 136 16 Gedächtnistechniken 139 16.1 Wie funktioniert das menschliche Gedächtnis ? 140 16.1.1 Gedächtnistypen 140 16.2 Das Vergessen 141 16.2.1 Theoretische Erklärungen 141 16.2.2 Die Vergessenskurve 142 16.3 Blockierung von Abrufprozessen 142 16.3.1 Stress 143 16.3.2 Hemmungsprozesse 143 16.4 Erleichterung von Abrufprozessen 144 16.4.1 Kontextabhängigkeit 144 16.4.2 Enkodierspezifi tät 144 16.4.3 Sequenzielles Wiederholen 144 16.5 Spezifi sche Gedächtnistechniken 145 16.5.1 Grundregeln 146 16.5.2 Assoziieren und Visualisieren 146 16.5.3 Locitechnik 147 16.5.4 Kennworttechnik 149 16.5.5 Mind-Mapping 149 16.5.6 Schlüsselwortmethode 149 16.6 Bachelor-Turbotechnik 151 16.6.1 Verkürzte Schlüsselwortmethode 151 16.6.2 Buchstaben-Satz-Methode 152 16.7 Schlussbemerkung 152 17 Prüfungsstrategien 155 17.1 Vor der Prüfung 156 17.1.1 Bewältigungssätze 156 17.1.2 Entspannen und Visualisieren 157 17.2 Der Prüfungstag 157 17.3 Während der Prüfung 157 17.3.1 Schriftliche Prüfungen 157 17.3.2 Mündliche Prüfungen 158 17.4 Nach der Prüfung 160 17.4.1 Eventuell »Nothelfer « kontaktieren 160 17.4.2 Auf jeden Fall belohnen 160 18 Die Bachelorarbeit 163 18.1 Start 164 18.1.1 Abklärung des Themas 164 18.1.2 Betreuer(in ) fi nden 165 18.1.3 Formalia beachten 166 18.2 Rahmenbedingungen 167 18.2.1 Arbeitsort 167 18.2.2 Arbeitszeiten 168 18.2.3 Das soziale Netz 169 18.2.4 Arbeitsplan erstellen 169 18.3 Inhaltliche Kriterien 170 18.3.1 Charakteristika wissenschaftlichen Arbeitens 170 18.3.2 Literaturrecherche 174 18.3.3 Lesen und Exzerpieren 175 18.3.4 Gliederung erstellen 175 18.3.5 Das Bauherrenprinzip : Vom Groben zum Feinen 176 18.4 Schlussakkord 177 18.4.1 Der rote Faden 177 18.4.2 Vier bis sechs Augen sehen mehr 177 18.4.3 Ausdruck, Bindung, Abgabe 178 18.4.4 Und danach? 178 IV Probleme und (k)ein Ende 179 19 Was tun bei Motivationsproblemen? 181 19.1 Was ist Motivation ? 182 19.2 Extrinsische und intrinsische Motivation 182 19.3 Wie erklärt man hohe Leistungsmotivation ? 182 19.3.1 Maslow’sche Bedürfnispyramide 182 19.3.2 Erziehung und familiäre Einfl üsse 184 19.3.3 Das Risiko-Wahl-Modell 184 19.3.4 Erleben von Flow 184 19.4 Motivationskiller 185 19.4.1 Die Sache mit den Lebenshüten 185 19.4.2 Falsches Fach, falsche Uni, falscher Ort usw186 19.4.3 Überforderung 186 19.4.4 Misserfolge 187 19.4.5 Mangelnder Praxisbezug 187 19.4.6 Unklare oder fehlende Ziele 188 19.4.7 Belastende Lebensereignisse 188 19.4.8 Belohnungsaufschub und Anstrengungsbereitschaft 190 19.5 Gegenmittel oder der Knoblauch gegen den Vampir 191 19.5.1 Lebenshüte auf- und umsetzen 191 19.5.2 Realistische Selbsteinschätzung 192 19.5.3 Effi ziente Lern- und Prüfungsstrategien aneignen 192 19.5.4 »Schnupperpraxis « 192 19.5.5 Für Zielklarheit sorgen 193 19.5.6 Aussteigen auf Zeit 193 19.5.7 Engagement und Selbstverpflichtung 194 20 Was tun bei Konzentrationsproblemen? 197 20.1 Was ist Konzentration ? 198 20.2 Konzentrationsstörung 198 20.2.1 Symptome 198 20.2.2 Ursachen 198 20.3 Pseudo-Konzentrationsstörungen 202 20.3.1 Unrealistische Erwartungen 202 20.3.2 Wichtigkeit von Pausen 202 20.3.3 Selbstbeobachtung 203 20.4 Konzentrationstests 203 20.4.1 Einfache Online-Tests 204 20.4.2 Wissenschaftlich überprüfte Testverfahren 204 20.5 Spezielle Konzentrationsübung en 204 20.5.1 Wörter zählen 205 20.5.2 Laut lernen 205 20.5.3 Kommentieren, was man tut 205 20.5.4 Die innere Einstellung 205 20.5.5 Das Prinzip der Achtsamkeit 206 21 Was tun bei Prüfungsangst? 209 21.1 A llgemeines 210 21.1.1 Was ist Prüfungsangst ? 210 21.1.2 Zunahme der Problematik 210 21.2 Entstehung und Aufrechterhaltung von Prüfungsangst 211 21.2.1 Angst ist eine lebenswichtige Reaktion 211 21.2.2 Das Yerkes-Dodson-Gesetz: Etwas Angst hilft sogar! 212 21.2.3 Erklärungsmodelle für überschießende Prüfungsangst 212 21.2.4 Teufels - und Engelskreis 213 21.3 Den Teufel bei den Hörnern packen 215 21.3.1 Optimale Vorbereitung 216 21.3.2 Die vier Ebenen der Angst 216 21.4 Die kognitive Ebene 217 21.4.1 Identifi zierung von Angstgedanken 217 21.4.2 Immunisierungstechniken 217 21.4.3 Paradoxe Intention 217 21.5 Die emotionale Ebene 218 21.5.1 Emotionen sind kognitiv beeinfl ussbar 218 21.5.2 Belohnungen 219 21.5.3 Erfolgsphantasien 220 21.6 Die körperliche Ebene 220 21.6.1 Typische Angstsymptome 220 21.6.2 Entspannung , Sport und Phantasiereisen 221 21.6.3 Schlafhygiene 221 21.7 Die Verhaltensebene 222 21.7.1 Verhaltensziele festlegen 222 21.7.2 Konfrontation in vivo: Begib dich in die Höhle des Löwen 222 21.7.3 Mündliche Prüfung : Königsweg Rollenspiele 223 21.7.4 Konfrontation in sensu: Phantasiereise der anderen Art 224 21.8 Erste Hilfe bei Blackout 225 21.8.1 Was ist ein Blackout? 225 21.8.2 Wenn es passiert ist : 225 22 Was tun bei Schreibproblemen? 227 22.1 Allgemeines 228 22.1.1 Schreiben gehört zum Studium 228 22.1.2 Schreibprobleme sind weit verbreitet 228 22.1.3 Zur Prophylaxe 229 22.2 Symptomatik von Schreibproblemen 229 22.2.1 Angst vor dem leeren Blatt 229 22.2.2 Der innere Zensor 230 22.2.3 »Aufschieberinnen« und »Aufschieber « 230 22.2.4 Habe ich ein Schreibproblem ? 230 22.3 Ursachen und Bewältigung von Schreibproblemen 231 22.3.1 »Schreibmythen « 231 22.3.2 Exogene Ursachen und Bewältigungsstrategien 233 22.3.3 Psychogene Ursachen und Bewältigungsstrategien 235 22.4 Spezielle Schreibübungen bei Schreibblockaden 239 22.4.1 Clustering 239 22.4.2 Generative Writing 240 22.4.3 Worst Text 242 22.4.4 Linkshändiges Schreiben 242 22.4.5 Free Writing 243 22.4.6 Gemeinsamkeiten der Schreibübungen 243 23 Tipps und Tricks zwischen A und Z 245 23.1 A wie Ausschütteln 246 23.2 D wie Doktor 246 23.3 E wie Energizer 247 23.4 F wie Finger-Massage-Ring 247 23.5 G wie Glashaus 248 23.6 H wie Handanspannung 248 23.7 I wie International 249 23.8 L wie Latinum 250 23.9 O wie Ohrstöpsel 250 23.10 P wie Podcast-Lernen 251 23.11 S wie Smartpen 251 23.12 U wie Unsichtbare Helfer 252 23.13 W wie Wollknäuel 252 23.14 Z wie Zauberzunge 253 V Anhang 255 Schlussbemerkung 257 Literaturverzeichnis 261 Stichwortverzeichnis 265 |
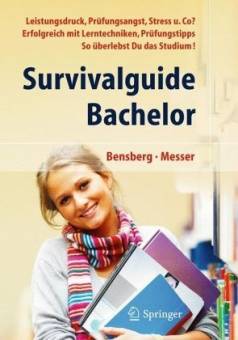
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen