|
|
|
Umschlagtext
Die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung: In den letzten Jahren zeichnet sich ein Wandel des klinischen Bildes von Menschen mit selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung ab, vom lebenslang zurückgezogenen ängstlichen Einzelgänger zum jungen Erwachsenen, der – durchaus medienerfahren – nicht zu einer reifen Kommunikation mit der Umwelt findet und sich der beständig nötigen Selbstaktualisierung und -darstellung in einer globalisierten Welt entzieht. Dieses Buch diskutiert klinische Implikationen dieser Störung und stellt einen kognitiv-behavioralen Therapieansatz vor.
Götz Berberich, Dr. med., Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Windach, Lehrkrankenhaus der LMU München, Leiter der Privatambulanz. Lehrauftrag an der LMU, Verhaltenstherapeut und Psychoanalytiker. Rezension
Globalisierung und Digitalisierung durchdringen alle Bereiche der Gesellschaft und machen auch vor dem Individuum nicht halt; selbst soziale Ängste und die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung verändern sich in diesen Zeiten. Soziale Phobien und ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörungen zählen zum Standardrepertoire der psychosomatischen Behandlung und finden sich nicht erst in unseren Tagen. Aber sie verändern sich. In den letzten zehn bis zwanzig Jahren stellten viele Fachleute in psychosomatischen Kliniken die bedenkliche Tendenz fest, dass immer mehr junge Erwachsene (etwa zwischen 18 und 25 Jahren) die Hilfe einer Klinik in Anspruch nehmen mussten. Die besondere Ausgestaltung der Symptomatik in einer computer- und internetaffinen Generation stellt die Behandler vor besondere Herausforderungen. Die Möglichkeiten und Versuchungen von sozialen Netzwerken und Onlinespielen verschleiern und verstärken die Symptomatik, sind gleichwohl Teil der heutzutage nicht mehr wegzudenkenden Realität dieser jungen Menschen. Dementsprechend müssen sie in der Therapie mit berücksichtigt werden. Das in diesem Buch dargestellte Therapiekonzept fußt auf der kognitiv-behavioralen Therapie, integriert jedoch zahlreiche weitere, aus den jeweiligen Kapiteln ersichtliche Therapieströmungen und -methoden.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
- Hochaktuell: Welche Rolle spielen Digitalisierung und Medienverhalten bei jungen Erwachsenen? - Neu: Wandel im klinischen Bild der selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung - Praxisnah und konkret: Mit vielen anschaulichen Fallbeispielen Mit Beiträgen von Götz Berberich Heribert Gampel Stefanie Hoffmann Gabriele Ludwig-Wallach Michael Maidl Katrin Müller-Franken Michaela Nafzger-Streicher Christine Rath Genia Rusch Wolfgang Schwarzkopf Heidi Unger Miriam Willibald Inhaltsverzeichnis
SOZIALE ÄNGSTE ERKENNEN UND VERSTEHEN 1
1 Soziale Ängste in Zeiten der Digitalisierung 3 Götz Berberich 2 Was sind soziale Ängste? – Symptomatik und Konzepte 7 Götz Berberich 2.1 Fallbeispiel: Herr M 7 2.2 Symptomatik 8 2.3 Konzepte und Diagnosen 10 2.4 Symptomwandel im digitalen Zeitalter 17 3 Diagnostische Klassifikationen und Instrumente 19 Götz Berberich 3.1 Deskriptive Diagnostik nach ICD-10 und DSM-IV/DSM-5® 19 3.2 Erfassung des Funktionsniveaus der Persönlichkeit 22 3.3 Psychometrie 25 4 Ätiologische Modelle für die Entstehung sozialer Ängste 27 Heidi Unger 4.1 Biologische und lerntheoretische Ansätze 27 4.2 Psychodynamische Modelle 30 4.3 Bindungstheorien 31 4.4 Verhaltenstherapeutische Modelle 32 SOZIALE ÄNGSTE BEHANDELN 37 5 Stand der Wissenschaft – Therapiekonzepte im Überblick 39 Stefanie Hoffmann 5.1 Psychotherapie 39 5.2 Psychopharmakotherapie 52 5.3 Weitere nicht-medikamentöse Therapieoptionen 56 6 Grundüberlegungen zur multimodalen Therapie einer »digitalisierten Generation« 57 Wolfgang Schwarzkopf 6.1 Therapie in der Transitionsphase 58 6.2 Fallbeispiel: Herr B 59 6.3 Fallbeispiel: Frau F 60 7 Beziehung und therapeutische Strategien – Die Einzeltherapie 63 Wolfgang Schwarzkopf 7.1 Die Etablierung der therapeutischen Beziehung – ganz analog! 63 7.2 Die Aufgabe des Sicherheits- und Vermeidungsverhaltens 64 7.3 Reduktion der Selbstaufmerksamkeit 66 7.4 Aufbau sozialer Kompetenzen 67 7.5 Erkennen negativer Grundüberzeugungen 68 7.6 Kognitive Umstrukturierung und Modifikation dysfunktionaler Einstellungen 69 7.7 Stressimpfungsübungen 71 7.8 Selbstsicherheitstraining (SST) 71 7.9 Exposition und Aufbau neuer Verhaltensmuster 72 8 Methodische Impulse – Die Gruppentherapie 76 Wolfgang Schwarzkopf 9 Im Mittelpunkt stehen – Das Selbstsicherheitstraining 81 Michaela Nafzger-Streicher, Michael Maidl, Heribert Gampel 9.1 Ziele 81 9.2 Ablauf der Gruppe 82 10 »Wenn ich könnte, wie ich wollte !« – Kunsttherapie 97 Christine Rath, Genia Rusch 10.1 Die Anfangsphase – Ankommen in der Gruppe 97 10.2 Die Themen – Annäherung an das Problem 98 10.3 Die Veränderungsphase – Verlauf der Kunsttherapie 103 10.4 Ausblick und Integration – Eine neue Rolle ausprobieren 111 11 Grenzen spüren und Stellung nehmen – Die Körpertherapie 112 Gabriele Ludwig-Wallach 11.1 Psychotonik bei sozialen Ängsten – die Grundidee 112 11.2 Die Überweisung – Erhebung des individuellen Patientenstatus 113 11.3 Einzelbehandlung – Wahrnehmen und Orientierung finden 114 11.4 Gruppensetting – Kommunikative Bewegungstherapie (KBT) 120 12 Essen und Genuss? – Therapeutisches Kochen 131 Miriam Willibald 12.1 Aufbau und Ablauf des Kochkurses 131 12.2 Fallbeispiel: Herr S 132 12.3 Zusammenfassung 133 13 Mut entwickeln – Therapeutische Selbstverteidigung 135 Katrin Müller-Franken 13.1 Die Gruppen und ihre Struktur 135 13.2 Ablauf der Gruppenstunden 135 13.3 Vermittlung theoretischer Grundlagen 136 13.4 Praktische Übungen 137 13.5 Fallbeispiel: Frau L 139 13.6 Stellenwert der Selbstverteidigung im Rahmen der multimodalen Therapie 140 Literatur 142 |
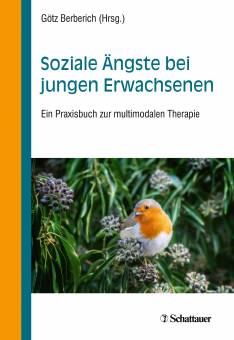
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen