|
|
|
Umschlagtext
Die Diskussion um Hauptschule wird seit einigen Jahren verstärkt geführt, die Abschaffung dieser Schulen scheint sich als Lösung anzubieten. Ausgehend von theoretischen Überlegungen kommt die vorliegende empirische Studie jedoch zu anderen Ergebnissen: Unter günstigen Bedingungen kann sich gerade an diesen Schulen ein Erziehungs- und Beziehungsmilieu etablieren, das auf Kinder aus benachteiligten gesellschaftlichen Milieus in besonderer Weise eingeht und das sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen sinnvolle Beziehungs- und Lernprozesse ermöglichen kann. - Eine Fallstudie in der Tradition ethnografischer Schulforschung.
Rezension
Als die ersten PISA-Studien nach der Jahrtausendwende verdeutlichten, dass in Deutschland Kinder aus sozial schwachen Familien sowie Kinder mit Migrationshintergrund im internationalen Vergleich besonders schlechte Ergebnisse erzielten, da war ein Schuldiger schnell gefunden: die Hauptschule. Und als im Februar 2006 die Lehrer der Rütli-Schule in Berlin-Neuköll ein reignierendes Fazit über ihre Hauptschule zogen ("Perspektivisch muss die Hauptschule in dieser Zusammensetzung aufgelöst werden zu Gunsten einer neuen Schulform mit gänzlich neuer Zusammensetzung“), da schien das Ende der Hauptschule besiegelt. Aber es gab und gibt auch Gegenstimmen, die den Hauptschulen sehr gute Werte bescheinigen, was die Beziehungen zwischen SchülerInnen und LehrerInnen anbelangt: Gerade dort fühlten sich die SchülerInnen besonders geachtet und unterstützt, gerade da seien in den vergangenen Jahren neue pädagogische Konzepte entstanden. Auch die hier anzuzeigende Studie beschriebt, wie gerade an kleinen Hauptschulen auch ein Erziehungs- und Beziehungsmilieu entstehen kann, das SchülerInnen aus benachteiligten Milieus in besonderer Weise gerecht wird.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die Diskussion um Hauptschule wird seit einigen Jahren verstärkt geführt, die Abschaffung dieser Schulen scheint sich als Lösung anzubieten. Die Studie beschreibt jedoch, wie gerade an kleinen Hauptschulen auch ein Erziehungs- und Beziehungsmilieu entstehen kann, das SchülerInnen aus benachteiligten Milieus in besonderer Weise gerecht wird. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Einleitung 13 I. Theoretische Zugänge Kapitel 1 Zur Debatte um Hauptschulen 20 Kapitel 2 Die pädagogische Beziehung 29 2.1 Pestalozzi – die Liebe zum Kinde 30 2.2 Herman Nohls pädagogischer Bezug 32 Kapitel 3 Pädagogische Beziehungen aus Sicht einer intersubjektiven Pädagogik 41 3.1 Psychoanalyse und Pädagogik 41 3.2 Psychoanalyse als Beziehungslehre 43 3.2.1 Selbst, Identität und Anerkennung 48 3.3 Aspekte einer intersubjektiven Pädagogik 52 3.3.1 Fürsorge und Konfrontation 55 3.3.2 Emotionalität und Lernerfolg 58 3.3.3 Adoleszenz und Schule 60 Kapitel 4 Der Einfluss des Habitus auf die pädagogischen Beziehungen 69 4.1 Bourdieus Habitustheorie 70 4.2 Schulischer Habitus und Herkunftsmilieus 74 4.2.1 Von der Schule erwarteter Habitus und Herkunftsmilieus der SchülerInnen 74 4.2.2 Habitusdifferenz als Beziehungsproblem der LehrerInnen 78 4.2.3 Der Habitus unterer Milieus und Schule 83 4.3 Ethnische Aspekte des Habitus im schulischen Kontext 95 4.3.1 Irritationen zu Beginn des Kulturkontakts 96 4.3.2 Auswirkungen ethnisch differierender Situationsdeutungen: Am Beispiel von SchülerInnen türkischer Herkunft 99 4.3.3 Synergieorientiertes LehrerInnenhandeln als Vermittlungsmöglichkeit 111 4.4 Gender und Schule 115 4.4.1 Geschlechtsspezifische Habitusformen bei Jungen und Mädchen 116 4.4.2 Doing gender und Jungenforschung – Aspekte der gegenwärtigen Debatte 123 4.4.3 Auswirkungen der Geschlechterdifferenz auf Seiten der LehrerInnen 127 Kapitel 5 Institutionelle und strukturelle Bedingungen 134 5.1 Pädagogisches Handeln in einem institutionellen Rahmen 134 5.2 Restriktionen der Institution Schule 137 5.3 Unterrichten und Lernen als Problem 143 5.4 Pädagogische Beziehungen im institutionellen Kontext 151 Kapitel 6 Kulturen im Kontext von Schule 155 6.1 Schulkultur 155 6.2 SchülerInnen- und LehrerInnenkultur 161 Kapitel 7 Forschungsfragen 167 II. Forschungsverständnis Kapitel 8 Forschungstheoretische und -methodische Bezüge 173 8.1 Qualitatives Forschungsparadigma 173 8.2 Ethnografische Feldforschung 177 8.2.1 Forschungsmethodische Aspekte 180 8.3 Grounded Theory 186 8.4 Zur Interviewführung 192 8.5 Zum forschungspraktischen Vorgehen 197 8.6 Schulforschung in ethnografischer und sozialwissenschaftlich-hermeneutischer Tradition 198 Kapitel 9 Verlauf der Feldphase 208 9.1 Wieder-Annäherung 208 9.2 Die Luisenschule 210 9.3 Zugang zum Feld 214 9.4 Im Lehrerzimmer 216 9.5 Kontakte knüpfen im Kollegium 222 9.6 Beziehungen zu den LehrerInnen 225 9.7 Eigene Befindlichkeit 228 9.8 Nähe und Distanz zum Forschungsfeld 231 9.9 Zugehörigkeit und Fremdheit 234 Kapitel 10 Zum Forschungsverlauf 238 10.1 Das Forschungsprojekt 238 10.1.1 Zur Transkription der Interviews 239 10.2 Interviews mit den LehrerInnen 240 10.3 Interviews mit den SchülerInnen 242 Kapitel 11 Der pädagogische Rahmen 245 11.1 Erste Eindrücke und offene Fragen 245 11.2 Hauptschule als Ausgangsbedingung 247 11.2.1 Vom Vorteil kleiner Hauptschulen 247 11.2.2 Profilierung durch zusätzliche Schulabschlüsse 249 11.2.3 Das Verhältnis zur Schulhierarchie 252 11.3 Die LehrerInnenkultur 256 11.3.1 Die Philosophie der LehrerInnenkultur 256 11.3.2 Herr Kröger, der Rektor 259 11.3.3 Das Kollegium 263 11.4 Eine Erziehungs- und Beziehungskultur 271 11.4.1 Die Philosophie der pädagogischen Beziehung 271 11.4.2 Grenzen setzen, Konfrontation 279 11.4.3 Regeln und Rituale 290 11.4.4 Schülerorientierte Angebote, Fürsorge und Identifikation 299 11.5 Die SchülerInnenkultur 309 Kapitel 12 Die pädagogischen Beziehungen 315 12.1 Die Ausgangslage 315 12.2 Eine schwierige Beziehung 316 12.3 Beziehungsarbeit als Überbrückungsarbeit 329 12.4 Aspekte gelingender pädagogischer Beziehungen 348 12.4.1 Pädagogische Beziehungen und schulische Organisation 348 12.4.2 Identifikationsmöglichkeiten der LehrerInnen 352 12.4.3 Überbrückungsarbeit und Pädagogische Kreativität 360 12.5 Schulkultur als Überbrückungskultur 373 Fazit und Ausblick 381 Literatur 390 Weitere Titel aus der Reihe Juventa Paperback |
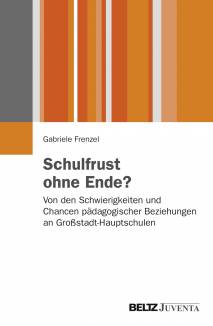
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen