|
|
|
Umschlagtext
Dieses Handbuch erschließt Rilkes Gesamtwerk auf dem Stand der neuesten Forschung und
Beziehungen zu anderen Kulturräumen, zu bildender Kunst, Musik, Philosophie und Psychoanalyse. „Rainer Maria Rilke war schlecht für diese Zeit geeignet. Dieser große Lyriker hat nichts getan, als dass er das deutsche Gedicht zum erstenmal vollkommen gemacht hat.“ Robert Musil Rezension
Eines meiner Lieblingsgedichte ist „Der Panther“ von Rainer Maria Rilke:
„Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe Und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille – und hört im Herzen auf zu sein.“ Angeregt durch den Bildhauer Auguste Rodin hatte Rilke im Jahre 1902 vor Abfassung des Gedichts zehn Stunden vor dem Panther-Käfig im Botanischen Garten „Jardin des Plantes“ des 5. Pariser Arrondissements verbracht. – Dieses Rilke-Handbuch bietet „Leben – Werk – Wirkung“. Sehr gelungen! Und die Register ermöglichen z.B. schnelles Auffinden von Informationen im jeweiligen Werk-Kontext. - Muss man mehr zu Rilke sagen? Und zu diesem Handbuch? Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Rilke hat "das deutsche Gedicht zum ersten Mal vollkommen gemacht", urteilte Robert Musil. Grund genug, Leben und Werk in einem eigenen Handbuch unter die Lupe zu nehmen. Von bleibender Aktualität, skeptisch gegenüber allen einseitig rationalen, psychologisch-soziologischen Welterklärungen entwirft Rilke ein Menschenbild mit rein poetischen Mitteln. Rilkes Biografie, seine Beziehungen z.B. zur russischen Literatur und den Dichterinnen Marina Zwetajewa und Anna Achmatova, zur Psychoanalyse und zu anderen Künsten erschließen das Schaffen in allen Schattierungen. Autoreninformation: Manfred Engel, Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken. Veröffentlichungen zur Literatur der Klassik, Romantik und Moderne, zur Romantischen Anthropologie, zur kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft und zur Kultur- und Literaturgeschichte des Traumes. Mitherausgeber von KulturPoetik. Zeitschrift für kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft. Bei J.B. Metzler sind erschienen: Rilkes "Duineser Elegien" und die moderne deutsche Lyrik, Der Roman der Goethezeit, Bd. 1: Zwischen Klassik und Frühromantik. Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis VII Vorwort XI Hinweise zur Benutzung XIV 1. Leben und Persönlichkeit 1 2. Kontakte und Kontexte 27 2.1 Kulturräume und Literaturen 27 Ägypten 27 Antike 33 Bibel 37 Mittelalter 44 Deutschsprachige Literatur 49 Frankreich 60 Italien 88 Rußland 98 Schweiz 112 Skandinavien 116 Spanien 124 2.2 Bildende Kunst 130 2.3 Musik 151 2.4 Philosophie 155 2.5 Psychoanalyse 165 3. Dichtungen und Schriften 175 3.0 Vier Werkphasen 175 3.1 Das Frühwerk 182 3.1.1 Lyrik 182 Die frühen Gedichtsammlungen 182 Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke 210 Das Stunden-Buch 216 Das Buch der Bilder (1. Fassung, 1902) 227 Einzelgedichte bis 1902 233 3.1.2 Erzählungen 239 3.1.3 Dramatische Dichtungen 264 3.2 Das mittlere Werk (1902–1910) 283 Die weiße Fürstin (2. Fassung, 1904) 283 Das Buch der Bilder (2. Fassung, 1906) 290 Neue Gedichte / Der Neuen Gedichte anderer Teil 296 Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 318 Einzelgedichte 1902–1910 336 3.3 Das späte Werk (1910–1922) 355 Das Marien-Leben 355 Duineser Elegien 365 Einzelgedichte 1910–1922 384 3.4 Späteste Gedichte (1922–1926) 405 Die Sonette an Orpheus 405 Deutschsprachige Einzelgedichte 1922–1926 424 Französische Gedichte 434 3.5 Das übersetzerische Werk 454 3.6 Schriften zu Kunst und Literatur 480 3.7 Das Briefwerk 498 4. Rilke als Autor der literarischen Moderne 507 Anhang 529 Ausgaben und Hilfsmittel 529 Siglen und Abkürzungen 537 Literaturverzeichnis 543 Ausgaben und Hilfsmittel 543 Forschungsliteratur 546 Register 553 Personen 553 Werke Rilkes 560 Die Autorinnen und Autoren 570 Inhaltsverzeichnis Vorwort XI Hinweise zur Benutzung XIV Aufbau der Artikel XIV – Literaturverzeichnisse XIV – Zitierweise XIV. 1. Leben und Persönlichkeit 1 (Joachim W. Storck) Herkunft und Kindheit 1 – Die Lehrjahre 2 – Neuanfang 5 – Pariser Jahre 7 – Die großen Reisen. Die große Krise 10 – Krieg und Revolution 15 – Die Schweizer Jahre 17 – Krankheit und Tod 20 – Forschung 23. 2. Kontakte und Kontexte 27 2.1 Kulturräume und Literaturen 27 Ägypten (Alfred Grimm) 27 Erste Kontakte mit »aegyptischen Dingen« 27 – Die Ägyptenreise 30 – Verarbeitung der Eindrücke 30 – Forschung 32. Antike (Uwe Spörl) 33 Jugend und Frühwerk 33 – Das mittlere Werk und die Gegenstände aus der Antike 33 – Orpheus, Orphik und die Neubildung des Mythos im Spätwerk 36 – Forschung 37. Bibel (Katja Brunkhorst) 37 Einzelaspekte 39 – Forschung 43. Mittelalter (Katja Brunkhorst) 44 Einzelaspekte 45 – Forschung 48. Deutschsprachige Literatur 49 (Rüdiger Görner) Das Lesen als poetisches Motiv 50 – Frühe Lektüren 50 – Der Fall Goethe oder: Vom Abstand zum Großen 50 – Auf der Suche nach Wahlverwandtem: Hölderlin 52 – Der ›Lesewinter‹ in Ronda 1912/13 54 – Rilke und der Tod in Venedig in Ronda 54 – Stifter und die ›Idee Österreich‹ 55 – Rilkes Lesart des Romantischen 56 – Von der Innigkeit zur Größe: Kassners Wirkung auf Rilke 58 – Forschung 59. Frankreich (Dorothea Lauterbach) 60 Übersicht über Rilkes Frankreichaufenthalte 60 – Das Zentrum: Paris 61 – Reisen in Frankreich (Der Norden und ›das Gotische‹; Der Süden: Landschaftserlebnis und Anverwandlung der Historie) 66 – Sprache: Differenz und Potential des Französischen 71 – Lektüren und Begegnungen (Charles Baudelaire; Marcel Proust; Paul Valéry; Zur zeitgenössischen Rezeption Rilkes in Frankreich) 74 – Forschung 86. Italien (Bernard Dieterle) 88 Florenz 89 – Rom 91 – Capri 92 – Venedig 94 – Duino 96 – Rilke und Italien 97 – Forschung 97. Rußland (Jürgen Lehmann) 98 Biographische Hintergründe 99 – Rilkes Rußland-Bild 100 – Auseinandersetzung mit russischer Literatur und bildender Kunst (Gedichte in russischer Sprache, Übersetzungen aus dem Russischen; Russische Lektüren; Russische Kunst) 102 – Auswirkungen auf das dichterische Werk 106 – Zur Rezeption Rilkes in Rußland 109 – Forschung 110. Schweiz (Rätus Luck) 112 Helfer und Freunde 113 – Geschichte, Literatur und Kunst, Politik, Wirtschaft 113 – Rilkes Schweiz 115 – Die Schweiz und Rilke 115 – Forschung 116. Skandinavien (Theodore Fiedler) 116 Eine neue Sicht des Nordens 117 – In Schweden und Dänemark 118 – Skandinavien und der Malte 119 – Lektüren nach 1910 121 – Forschung 123. Spanien (Bernard Dieterle) 124 Zuloaga und El Greco 124 – Die Spanienreise 126 – Literarische Erträge 127 – Forschung 128. 2.2 Bildende Kunst (Antje Büssgen) 130 Anfänge: Student der Kunstgeschichte und Kunstliterat 130 – Motivationen für die Beschäftigung mit bildender Kunst 130 – Bildende Künste als sichtbare Künste 131 – Sehen-Lernen (Sehen als Handwerk des Dichtens; Der Prozeß des ›Sehen-Lernens‹) 133 – Rilkes Hinwendung zu den Sprachen des Sichtbaren als Reaktion auf die Sprachkrise der Moderne (Die ›Krise des Anschauens‹) 136 – Worpswede 137 – Auguste Rodin 139 – Briefe über Cézanne 142 – Rilke VII und die Avantgarde: Abstraktion als ›Verhängnis‹ 145 – Forschung 148. 2.3 Musik (Rüdiger Görner) 151 Rilke, Busoni und ›Benvenuta‹ 151 – Verdinglichte Musik 152 – Musik als ›Verführung zum Gesetz‹ 152 – Malte und Musik 153 – Musik, ein Urphänomen? 153 – Zur Forschung 154. 2.4 Philosophie (Ronald Perlwitz) 155 Philosophische Interpretationen Rilkes 155 – Philosophische Lektionen (Romantische Naturphilosophie; Nietzsche; Bergson) 159 – Forschung 163. 2.5 Psychoanalyse (Theodore Fiedler) 165 Erste Bekanntschaft 165 – Die Psychoanalyse als mögliche Heilmethode 166 – Rilkes Aneignung der Psychoanalyse 170 – Forschung 173. 3. Dichtungen und Schriften 175 3.0 Vier Werkphasen (Manfred Engel) 175 Das Frühwerk 175 – Das mittlere Werk 178 – Das späte Werk 179 – Das späteste Werk 180. 3.1 Das Frühwerk 182 3.1.1 Lyrik 182 Die frühen Gedichtsammlungen (Jutta Heinz) 182 Entstehung und biographischer Hintergrund 182 – Entwicklung der Poetik 183 – Leben und Lieder 185 – Larenopfer 187 – Wegwarten 190 – Traumgekrönt 192 – Advent 195 – Christus-Visionen 197 – Dir zur Feier 200 – Mir zur Feier 203 – Forschung 208. Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (Wolfgang Braungart) 210 Entstehung und Druckgeschichte 210 – Sprache 211 – Hinweise zur Deutung 212 – Forschung 215. Das Stunden-Buch (Wolfgang Braungart) 216 Zur Entstehung 216 – Religiöse Dichtung? 217 – Zum Titel »Stunden-Buch« 218 – Zyklische Struktur 219 – Das erste Buch: Die Gottes- und Subjekt-Konzeption – einige grundsätzliche Deutungsperspektiven 220 – Das zweite Buch 223 – Das dritte Buch 224 – Forschung 226. Das Buch der Bilder (1. Fassung, 1902) (Jutta Heinz) 227 Entstehung 227 – Gliederung und Inhalt 228 – Forschung 233. Einzelgedichte bis 1902 (Jutta Heinz) 233 Biographische Bezüge 234 – Poetologische Selbstreflexion 235 – Entwürfe und Widmungsgedichte 237 – Forschung 238. 3.1.2 Erzählungen (Bernard Dieterle) 239 Vorbemerkungen 239 – Einzelne Erzählungen (Was toben die Heiden?; Ihr Opfer; Pierre Dumont; Am Rande der Bürgerlichkeit; Frau Blaha’s Magd; Die Turnstunde; Ewald Tragy; Der Totengräber) 241 – Sammelbände (Am Leben hin. Novellen und Skizzen; Zwei Prager Geschichten; Die Letzten; Geschichten vom lieben Gott) 247 – Rilkes Erzählungen im Kontext der Jahrhundertwende 261 – Forschung 262. 3.1.3 Dramatische Dichtungen (Monika Ritzer) 264 Naturalistische Dramen (Die häßliche Wirklichkeit; Aufbruch ins Leben; Problemstücke) 264 – Psychodramen 270 – Maeterlinck-Rezeption (Überwindung des Naturalismus; Dramatik der Seele; Kritik an den Todesdramen; Versöhnung von Seele und Welt) 271 – Symbolistische Dramen (Symbolismus, Jugendstil, Stilkunst; Die weiße Fürstin, 1. Fassung; Spiele) 276 – Aporien des Theaters 280 – Forschung 282. 3.2 Das mittlere Werk (1902–1910) 283 Die weiße Fürstin (2. Fassung, 1904) (Monika Ritzer) 283 Entstehung und Motivkomplex 283 – Von der Erstzur Zweitfassung 284 – Seelenwelt 285 – Jenseits der Seele 287 – Forschung 289. Das Buch der Bilder (2. Fassung, 1906) (Jutta Heinz) 290 Entstehung 290 – Die »charakteristische Einheit« der Zweitfassung 290 – Forschung 295. Neue Gedichte / Der Neuen Gedichte anderer Teil (Wolfgang Müller) 296 Entstehung 296 – Die Dichtungskonzeption der Neuen Gedichte (Der Dingbezug; Die phänomenologische Dingkonzeption; Modellanalyse; Dinggedicht und symbolistisches Gedicht; Moderne Poetologie: ›Äquivalenz‹, ›objektives Korrelat‹, ›Transformation‹) 298 – Formale und thematische Aspekte (Ikonizität erster Inhaltsverzeichnis VIII Ordnung; Ikonizität zweiter Ordnung; Verwandlung als Epiphanie; Das Gedicht als Bewegungsstudie und das Gedicht als ›Figur‹; Die metaphorische Komponente; Substantivierung als Mittel der Abstraktion; Zur Anordnung der Gedichte; Drei Themenbereiche) 302 – Forschung 316. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Dorothea Lauterbach) 318 Entstehung 318 – Die Geschichte, die keine Geschichte mehr ist 320 – Stoffe, Motive Verknüpfungstechniken 322 – Erzählverfahren (Figurenkonzeption; ›Vokabeln der Not‹; Evokatives Arrangement statt diskursiven Erzählens) 323 – Thematik 329 – Forschung 331. Einzelgedichte 1902–1910 (Winfried Eckel) 336 Einzelgedichte 1902–1905 (Der Rückgriff auf die Gebetform; Verdinglichung und Stilisierung) 339 – Einzelgedichte 1906–1910 (I): Im Umkreis der Neuen Gedichte (Die Wiederkehr der Subjektivität; Die Requien) 341 – Einzelgedichte 1906–1910 (II): Vorbereitungen des Spätwerks (Die Capreser Lyrik; Ausgänge aus der Krise) 347 – Forschung 353. 3.3 Das späte Werk (1910–1922) 355 Das Marien-Leben (Ronald Perlwitz) 355 Entstehung 355 – Doppelte Traditionslinie: Ikonenmalerei und apokryphe Überlieferung 356 – Das Marien-Leben als Variation christlicher Tradition 357 – Forschung 363. Duineser Elegien (Anthony Stephens) 365 Die Duineser Elegien lesen 365 – Entstehungsgeschichte 371 – Die erste Elegie 372 – Die zweite Elegie 374 – Die dritte Elegie 374 – Die vierte Elegie 376 – Die fünfte Elegie 378 – Die sechste Elegie 379 – Die siebente Elegie 379 – Die achte Elegie 380 – Die neunte Elegie 381 – Die zehnte Elegie 381 – Forschung 382. Einzelgedichte 1910–1922 (Anthony Stephens) 384 Lebenskrise und »erfüllte Bilder« 384 – Das Vermächtnis des Malte Laurids Brigge 391 – Die Gedichte an die Nacht 393 – Raum, Gefühl, Erkenntnis 396 – Sonstige Gedichtsammlungen 400 – Forschung 403. 3.4 Späteste Gedichte (1922–1926) 405 Die Sonette an Orpheus (Manfred Engel) 405 Entstehung 405 – Orphische Verwandlung 1: ›Orpheus‹ und ›Wera‹ (Erneuerung des Orpheus-Mythos; Wera Ouckama Knoops mythopoetische Verwandlung) 406 – Orphische Verwandlung 2: Poetik der Figur 412 – Poetische Lebenskunst-Lehre 417 – Zum Aufbau des Zyklus 420 – Sonettform 421 – Forschung 422. Deutschsprachige Einzelgedichte 1922–1926 (Manfred Engel) 424 Überblick 424 – Abstrakte Naturlyrik: Die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten 425 – Sprachmagische Lyrik: Gedichte aus »Wortkernen« (Der Dichter als Magier; Poetik der Sprachmagie) 428 – Briefwechsel in Gedichten mit Erika Mitterer 432 – Forschung 434. Französische Gedichte (Manfred Engel, Dorothea Lauterbach) 434 Rilkes lyrische Zweisprachigkeit (Anlässe; Das Experiment der Doppeldichtungen) 434 – Überblick zu Textbestand und Entwicklung der französischen Lyrik (Textbestand und Phaseneinteilung; Die zwei Hauptphasen von Rilkes reifer französischer Lyrik; Sammelhandschriften) 437 – Anfänge: die frühen Einzelgedichte 439 – Vergers (Zur Entstehung; Lyrische Obstgärten: zur Bedeutung des Titels; Themen, Motive und Formen) 440 – Les Quatrains Valaisans 443 – Les Roses 444 – Les Fenêtres (Zur Entstehung; Liebesgeschichte versus Daseinsfigur) 445 – Einzelgedichte ab September 1923 (Einzelgedichte September 1923 bis April 1925; Einzelgedichte Mai 1925 bis September 1926) 446 – Forschung 452. 3.5 Das übersetzerische Werk (Bernard Dieterle) 454 Grundprobleme literarischen Übersetzens 454 – Rilkes Vielfalt 456 – Anfänge und Probleme 457 – Rilke und die Fremdsprachen 459 – Übersetzungen aus dem Russischen 461 – Übersetzung aus skandinavischen Sprachen 462 – Übersetzungen aus dem Englischen 463 – Übersetzungen aus dem Italienischem (Leopardi, D’Annunzio, Dante, Petrarca, Gaspara Stampa; Michelangelo) 466 – Übersetzungen aus dem Französischen (Maurice Maeterlinck und Charles Baudelaire; Anna de Noailles, Louise Labé, Abbé Bonnet, Maurice de Guérin, Lettres portugaises – das Thema der Liebe; André Gide; Paul Valéry) 470 – Forschung 477. 3.6 Schriften zu Kunst und Literatur (Manfred Koch) 480 Textbestand 480 – Kritische Anfänge 481 – ›Vorwand‹ und ›Geständnis‹ 483 – Die Innenwelt in der Außenwelt 485 – Frühe Sprachskepsis? 487 – Psychologie der Dinge: Maeterlinck, Mann, Jacobsen 488 – Schauen, Arbeit, Absichtslosigkeit 491 – Paris 493 – Ausblick 496 – Forschung 496. 3.7 Das Briefwerk (Joachim W. Storck) 498 Rilke als Briefschreiber 498 – Editionsgeschichte 502 – Fazit 504 – Forschung 505. 4. Rilke als Autor der literarischen Moderne 507 (Manfred Engel) Drei ›Moderne‹-Begriffe 507 – Modernität durch Anti-Modernismus 509 – Kunstmetaphysik, Mythopoesie und Abstraktion 513 – Mythopoetische Weltmodelle: am Beispiel des Stunden-Buch 519 – Abstrakte Gestaltung: Poetik der ›Figur‹ am Beispiel der Neuen Gedichte 521 – An der Grenze zum Konkreten: Räume aus Sprache 524. Anhang 529 Ausgaben und Hilfsmittel (Manfred Engel) 529 Ausgaben und Editionsgeschichte 529 – Konkordanzen und Wortindex 532 – Briefe und Tagebücher 532 – Bibliographien 533 – Biographien und Bildbände 534 – Institutionen: Rilke-Archive, die »Internationale Rilke-Gesellschaft« und ihre Blätter, die »Fondation Rainer Maria Rilke« 535 – Rilke im Internet 536. Siglen und Abkürzungen 537 1. Werksiglen 537 – 2. Werkausgaben, Tagebücher, Übersetzungen 537 – 3. Briefausgaben, Erinnerungsbücher, Kataloge, Bildbände 538 – 4. Zeitungen und Zeitschriften 541. Literaturverzeichnis 543 1. Ausgaben und Hilfsmittel: 1.1 Werk- und Sammelausgaben (Auswahl in chronologischer Folge) 543 – 1.2 Briefe 544 – 1.3 Tage- und Taschenbücher 544 – 1.4 ›Hörbücher‹: Rezitationen, Texte und Musik, Vertonungen 544 – 1.5 Kommentare 545 – 1.6 Indices und Konkordanzen 545 – 1.7 Bibliographien und Forschungsberichte; zur Rezeption 545 – 1.8 Biographien und Bildbände 546 – 2. Forschungsliteratur: 2.1 Sammelbände 546 – 2.2 Ausgewählte Monographien und Aufsätze 547. Register 553 Personen 553 – Werke Rilkes 560. Die Autorinnen und Autoren 570 |
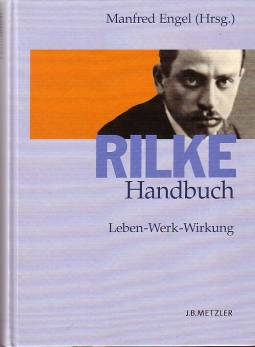
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen