|
|
|
Umschlagtext
Diese Einführung ist auf die Bedürfnisse des Mediävistik-Studiums zugeschnitten. Sie beschreibt das Mittelhochdeutsche historisch-systematisch nach seiner Stellung innerhalb der Geschichte der deutschen Sprache und vermittelt knapp und übersichtlich die Kenntnisse, die zum Verstehen und Übersetzen mittelhochdeutscher Texte nötig sind. Die bedeutungsgeschichtlichen Erläuterungen werden darum besonders willkommen sein.
Das Buch möchte Mut zum Lernen machen: Mittelhochdeutsch ist eine uns fremd gewordene Vorstufe des Neuhochdeutschen, aber keine Fremdsprache. Hilkert Weddige ist Akademischer Direktor i. R. für deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Bei C.H.Beck ist von ihm erschienen: Einführung in die germanistische Mediävistik. Vierte Auflage. 2008. Rezension
Das Standardwerk zur Mädiavistik von Hilkert Weddige liegt nun in der 8. Auflage vor. Es bietet eine kompakte sprachgeschichtliche Einführung in das Mittelhochdeutsche, die vor allem für das Verstehen und Übersetzen mittelhochdeutscher Literatur unerlässlich ist. Neben der Einführung in die Lautgeschichte und Morphologie des Mittelhochdeutschen sind die vielen kommentierten Übungstexte (Hartmann von der Aue: „Der kleine Heinrich“, Das Nibelungenlied, Walter von der Vogelweise u.a.) zum persönlichen Studium gut geeignet. Ein Grundlagenwerk, das besonders im Rahmen des Germanistikstudiums sehr hilfreich sein kann!
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung. XI
1. Einleitung 1.1 Indoeuropäisch - Germanisch - Deutsch. 1 1.1.1 Die indoeuropäischen (oder indogermanischen) Sprachen. 1 1.1.2 Die germanischen Sprachen. 3 1.1.3 Zur zeitlichen und räumlichen Gliederung des Deutschen. 6 1.2 Schreibung und Aussprache des Mittelhochdeutschen. 10 1.2.1 Zur Schreibweise in mittelhochdeutschen Handschriften. 10 1.2.2 Zur Regelung der Schreibweise in Editionen mittelhochdeutscher Texte. 11 1.2.3 Zur Aussprache und Betonung des Mittelhochdeutschen. 13 1.2.4 Reflexe gesprochener Sprache in der Schriftlichkeit (Proklise - Enklise, Apokope - Synkope, Auslautverhärtung, Kontraktion). 13 2. Lautgeschichte 2.1 Sprechen und Sprache. 15 2.1.1 Zur Phonologie. 15 2.1.2 Zum phonetischen Beschreibungsinstrumentarium. 16 2.2 Zum geregelten Lautwandel im Konsonantismus. 19 2.2.1 Die erste (oder germanische) und die zweite (oder hochdeutsche) Lautverschiebung. 19 2.2.2 Der Grammatische Wechsel und seine historisch-genetische Erklärung nach dem Vernerschen Gesetz. 27 2.2.3 Dentalberührung (auch: Germanische Spirantenregelung vor / t / oder Primärer Berührungseffekt). 29 2.2.4 Konsonantengemination. 30 2.3 Zum geregelten Lautwechsel und Lautwandel im Vokalismus. 31 2.3.1 Veränderungen im Vokalismus vom Mittel- zum Neuhochdeutschen. 31 2.3.1.1 Neuhochdeutsche Diphthongierung und Monophthongierung. 31 2.3.1.2 Neuhochdeutsche Dehnung und Kürzung. 33 2.3.1.3 Rundung, Entrundung und Senkung. 34 2.3.2 Veränderungen im Vokalismus vom Indogermanischen, Germanischen und Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen. 34 2.3.2.1 Ablaut. 34 2.3.2.2 Kombinatorischer Lautwandel. 35 Der älteste kombinatorische Lautwandel und die Alternanz mhd. / e / - /i /. 35 Brechung und die Alternanz mhd. / u / - / o /, / iu / - / ie /. 36 Althochdeutsche Monophthongierung und die Alternanz ahd.mhd. / ei / - / ê /, / ou / - / ô /. 37 i-/j-Umlaut. 38 2.3.2.3 Nebensilbenabschwächung. 40 3. Zur Morphologie des Mittelhochdeutschen 3.1 Grundbegriffe der Morphologie. 42 3.2 Zum Formenbau der Verben. 43 3.2.1 Die Hauptmerkmale des deutschen Konjugationssystems. 43 3.2.2 Die schwachen Verben. 47 3.2.3 Die starken Verben. 49 3.2.4 Besondere Verbalbildungen. 55 3.2.4.1 Präterito-Präsentien. 55 3.2.4.2 wellen, Wurzelverben und kontrahierte Verben. 56 3.3 Zum Formenbau der Nomina. 57 3.3.1 Zur Deklination der Substantive. 57 3.3.2 Zur Flexion und Stellung der Adjektive. 61 3.3.3 Adverbien. 63 3.4 Pronomina. 63 3.4.1 Personalpronomina. 64 3.4.2 Reflexivpronomina der 3. Person. 64 3.4.3 Possessivpronomina. 65 3.4.4 Demonstrativpronomina und bestimmter Artikel. 65 3.4.5 Interrogativpronomina. 66 3.4.6 Indefinitpronomina. 66 4. Zur Syntax 4.1 Grundbegriffe der Satzbeschreibung in der historischen Grammatik. 68 4.2 Kasus, v.a. Genitivkonstruktionen. 70 4.3 Abhängige Nebensätze und ihre Einleitungen. 72 4.4 Die Negation im Mittelhochdeutschen. Zur Negation in konjunktivischen Nebensätzen. 75 4.4.1 Negation. 75 4.4.2 Negation in konjunktivischen Nebensätzen. 76 4.4.3 Zur Auswechselbarkeit positiver und negativer Ausdrucksweise. 77 5. Semantik 5.1 Semantische Grundbegriffe. 78 5.2 Zur Lexikographie des Mittelhochdeutschen. 80 5.3 Typen der Wortbildung. 84 5.3.1 Verben. 84 5.3.2 Nomina. 86 5.3.2.1 Substantive. 86 5.3.2.2 Adjektive. 89 5.4 Entlehnung. 89 5.5 Bedeutung und Bedeutungswandel an Wortbeispielen vornehmlich aus der höfischen Literatur. 92 amîs/amîe - angest - arbeit - arm - art - âventiure - bescheiden - biderbe - bilde -bîspel - bœse - brût - bûhurt - buoze - burc - degen - diemuot/diemüete - dienest/dienestman - diet/tiu(t)sch - dörper/dörperlîch/dörperheit - ê, êwe - edel(e) - ellende - êre - gast - dinc/gedinge - gelücke - gemach - gemeit - genâde - genôz - geselle - gesinde/ingesinde - guot - hêrre - herze - hôch(ge)zît - hövesch - holt/hulde - huote - juncvrouwe - kebese - kiusche - kleine - kneht - kranc - künne - kunst - leit - liep/liebe - lîp - list - liut/liute - mære - maget - mâc - man - mâze - milte - minne - muot/hôher muot - orden - rât - recke - rîche - ritter - riuwe - sælde - sene/senedære - sin - stæte - süeze - swære - tiure/tiuren - triuwe - trût/triuten/triutinne - trôst - tugent - tump - urloup -veige - volc - vriedel - vriunt/vriundinne - vrouwe - vrum - wân - wîgant - wine - wîp - wîse - witze - zuht 5.6 Zum Übersetzen aus dem Mittelhochdeutschen. 137 Übungstexte 1. "Dû bist min, ich bin dîn". 141 2. Aus dem mnd."Sachsenspiegel" Landrecht II 59 § 3-4. 142 3. Hartmann von Aue, "Der arme Heinrich". 142 a) Heidelberger Handschrift Cpg. 341: Überschrift und Prolog, v. 1-21. 142 b) Der kritisch hergestellte Text des Prologs, v. 1-28. 143 c) Die Exposition der Fallhöhe im "Armen Heinrich", v. 29-119. 145 4. Spätmittelalterliche Kleinepik: mære "Von der Übeln Adelheit und irem man". 148 5. Späthöfische Epik: Heldenepik/aventiurehafte Dietrichepik "Laurin", v. 1-80. 154 6. Hochhöfische Epik: Artusroman Hartmann von Aue, "Erec". 157 a) Die Aufbruchsmotivierung im "Erec", v. 1-149. 158 (mit diplomatischer Transkription der Ambraser Fassung, v. 1-72) b) "Erec", v. 2924-2998: Verfehlung und Krise. 163 c) "Erec", v. 5288-5371: Eine âventiure unterwegs. 166 7. Hochhöfische Epik: Heldenepik Das Nibelungenlied. 168 a) Die Eingangsâventiure mit Kriemhilds Falkentraum (Str. 1-13 C). 169 b) Aus der 14. Aventiure: Wie die küneginne einander schulten (Str. 815-822, 826-829, 838-840, 845-849). 172 c) Aus der 16. Aventiure: Wie Sîfrit erslagen wart (Str. 969, 973, 976-981). 175 d) Aus der 36. Aventiure: Wie diu küneginne den sal vereiten hiez (Str. 2086, 2111-2117). 176 8. Früher donauländischer Minnesang. 178 a) Der Kürenberger (MF 7, 19; 8, 1; 8, 17; 9, 29). 178 b) Der Burggraf von Regensburg (MF 16, 1). 179 c) Dietmar von Eist (MF 34, 3; 34, 11; 37, 4). 179 9. "Hohe Minne" unter dem Einfluß der provenzalischen Lyrik. 181 a) Friedrich von Hausen (MF 45, 37-46, 29). 181 b) Rudolf von Fenis (MF 80, 1-80, 17). 182 10. Walther von der Vogelweide, sog. Elegie (L.- K. 124, 1). 183 Anhang Abkürzungen. 189 Literaturauswahl. 193 Verzeichnis der Abbildungen und Quellennachweis. 199 Register. 201 Sachregister. 201 Wortregister. 205 |
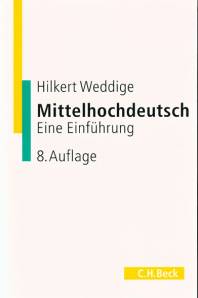
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen