|
|
|
Umschlagtext
Die Untersuchung präsentiert Aspekte der Lebenwelt von Studentinnen türkischer Herkunft in Deutschland. Anhand von qualitativen Interviews stellt die Autorin die Bedingungen für gelingende Lebensentwürfe von Migrantinnen der dritten Generation dar. Entgegen des vorherrschenden Diskurses, der Migrantinnen als Opfer ihrer Herkunftskultur beschreibt, werden in den Biografien verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren erkennbar. Die jungen Frauen setzen sich intensiv mit dem in unserer Gesellschaft präsenten Stereotyp der „typisch türkischen Frau“ auseinander und fordern ein differenziertes Bild ihrer individuellen Lebenssituation ein. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Orientierungs- und Handlungsmuster im Kontext von sozialer Ein- und Ausgrenzung, wobei dem sozialen Umfeld und den individuellen Handlungsstrategien im Hinblick auf Fremd- und Selbstzuschreibungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Das Buch macht deutlich, dass weder die Opferrolle noch der allgemein attestierte Kulturkonflikt für die Situation der jungen Frauen entscheidend ist.
Rezension
Nach Meinung der Autorin unterliegt die öffentliche Beschreibung der Situation türkischer Migrantinnen in der BRD seit Jahren einem falschen Stereotyp, wonach die türkische Frau ein unterdrücktes und hilfloses Opfer ptriarchalischer Herkunftskulturen ist (vgl. Kap. 3). Demgegenüber präsentiert die Untersuchung differierende Aspekte der Lebenwelt von Studentinnen türkischer Herkunft in Deutschland. Anhand von qualitativen Interviews stellt die Autorin die Bedingungen für gelingende Lebensentwürfe von Migrantinnen der dritten Generation dar. Entgegen des vorherrschenden Diskurses, der Migrantinnen als Opfer ihrer Herkunftskultur beschreibt, werden in den Biografien verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren erkennbar. Die jungen Frauen setzen sich intensiv mit dem in unserer Gesellschaft präsenten Stereotyp der „typisch türkischen Frau“ auseinander und fordern ein differenziertes Bild ihrer individuellen Lebenssituation ein. Ziel der Arbeit ist es nicht, teilweise vorhandene patriarchalische Normvorstellungen zu negieren, sondern erfolgreiche Handlungsmuster von Frauen vorzustellen.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Kategorie(n): Feministische Wissenschaften - Pädagogik / Psychologie - Philosopie / Politik / Soziologie - Pädagogik - Erwachsenenbildung - Schule / Hochschule / Lernen - Sozialwissenschaften - Berufssoziologie / Bildungssoziologie - Kultursoziologie - Sozialarbeit - Familiensoziologie - Frauenforschung / Soziologie der Geschlechter - Sozialpädagogik Die Autorin, geb. 1979 in Ahaus, Diplom-Pädagogin, absolvierte ein Studium der Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Freiburg (Breisgau). Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in einer Beratungsstelle für Migrantinnen in Berlin und bereitet derzeit ihre Promotion vor. Rezension: "Die Arbeit ist ein Plädoyer für eine plurale, nicht klischeehafte Sichtweise. Konflikte werden von den jungen Frauen ausgehandelt. Verengte Sichtweise wird als 'eurozentristisch' entschleiert. ... In ihrer humanen Generalaussage und in ihrer methodischen Anlage ist die Arbeit vorbildlich. Die Einführung in die Problematik ist umfassend und informativ. Dem Bändchen ist eine weite Verbreitung zu wünschen. Für Seminare ist es Fundgrube und Exempel." (Interkulturell und Global, heft 1/2, 2007) Inhaltsverzeichnis
Einleitung 11
1. „Lebenswelt" 14 1.1 Definition des Begriffs der „Lebenswelt" 14 1.2 Definition des Begriffs der Migranten - Generationen 15 2. Migrationsforschung 18 2.1 Geschichte der Migrationsforschung 18 2.2 Die Phaseneinteilung der Migrationsforschung 18 2.2.1 Die schwierige Emanzipation der Migrationsforschung 20 2.3 Überblick über Themenbereiche aktueller Migrationsforschung 23 3. Das stereotype Wahrnehmungsmuster der „türkischen Frau" 27 3.1 Der Patemalisierungseffekt in der Migrantinnenforschung 27 3.1.1 Feministischer Ethnozentrismus: Die Migrantin als hilfloses Opfer ihrer Herkunftskultur 32 3.1.2 Eurozentrismus in der Migrantinnenforschung 34 3.1.3 Der Subjektbegriff in der Migrantinnenforschung 38 3.2 Das Spannungsfeld „Generationenkonflikt, Kulturkonflikt und Identitätskonflikt" 39 3.2.1 Erziehungsvorstellungen bei Migrantenfamilien türkischer Herkunft 40 3.2.1.1 Kulturkonflikt 48 3.2.1.2 Identitätskonflikt 49 3.3 „Viele Welten leben": Die Notwendigkeit eines Perspektivenwechsels 52 3.3.1 Bildungsmotivation 54 3.3.2 Familialismus 58 3.3.3 Religiosität 59 3.3.4 Geschlechterrollenorientierungen 61 3.3.5 Selbstverortung 63 3.3.6 Selbst-und Fremdbilder 64 3.3.7 Interkulturelle Kompetenzen 67 3.3.8 Lebenszufriedenheit und Zukunftsperspektiven 67 3.4 Zusammenfassende Bemerkungen zum theoretischen Diskurs 69 4. Methodisches Herangehensweise 72 4.1 Anspruch an die Methode des qualitativen Interviews 72 4.1.1 Qualitatives Interview 73 4.1.2 Problemzentriertes Interview 73 4.1.3 Begründung der Auswahl des qualitativen problemzentrierten Interviews 74 4.1.4 Instrumente des qualitativen problemzentrierten Interviews 74 4.2 Bemerkungen zu methodischen Besonderheiten in der Untersuchung 75 4.3 Eigenes Vorgehen bei der Datenerhebung 78 4.3.1 Kriterien zur Auswahl der Interviewpartnerinnen 79 4.3.2 Interviewpartnerinnen 79 4.3.2.1 Interviewleitfaden 80 4.3.2.2 Erhebungssituation 82 4.3.2.3 Die Auswertung des Materials 82 5. Vier Lebensentwürfe junger Migrantinnen türkischer Herkunft 85 5.1 „Mir egal, was ihr denkt, ich mach mein Ding" Havva 85 5.2 „Weil ich diskutieren musste ohne Ende" Layla 103 5.3 „Was bleibt, ist immer die Familie" Melek 126 5.4 „Ich möchte einfach so sein, wie ich bin" Summ 141 6. Einblick in die Lebenswelten 155 7. Ausblick 169 Bibliografie 174 Anhang I 182 Anhang II 183 |
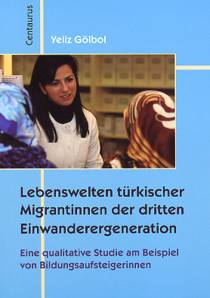
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen