|
|
|
Umschlagtext
»Kommunikation ist die Quelle aller Missverständnisse«, lässt sich in Abwandlung eines bekannten Dichterwortes sagen. Wer nicht weiß, warum er so spricht und handelt, wie er es tut, der wird auch kaum effektiv und zielführend kommunizieren können. Doch genau das ist für jede Pflegekraft unabdingbar: Kommunikative Fähigkeiten müssen erkannt, entwickelt und gepflegt werden.
Dieses Buch, das nun in der zweiten, aktualisierten Auflage vorliegt, liefert eine ausgezeichnete Grundlage, auf der Pflegekräfte ihre eigenen kommunikativen Fähigkeiten entwickeln können. So werden im ersten Teil zunächst die grundlegenden Theorien und Modelle der Gesprächsführung vorgestellt. Im zweiten Teil wird der praktische Einsatz dieser Modelle in konkreten Gesprächssituationen veranschaulicht: Gerontopsychiatrie, Begleitung Sterbender und Trauernder, Kommunikation mit Aphasikern. Hinzu kommt die wichtige Kommunikation mit Mitarbeitern und Angehörigen. Mitarbeiter in der Alten- und Krankenpflege lernen so Schritt für Schritt, wie sie eine Beziehung zum Klienten/Patienten aufbauen, wie sie informieren, anleiten und beraten. Denn: Gute Kommunikation ist die Basis jeder Beziehung. Der Autor Jürgen Wingchen ist Diplom-Pädagoge und arbeitet in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften sowie Ergo- und Physiotherapeuten. Rezension
Das Lehr- und Arbeitsbuch ist in zwei große Bereiche unterteilt. Während der Autor im ersten Teil unterschiedliche Kommunikationstheorien und -modelle verständlich und praxisnah dargelegt, werden im zweiten Teil des Buches ausgewählte Aspekte der Kommunikationstheorien auf klinische Situationen übertragen.
Die 14 Kapitel befassen sich im Einzelnen mit folgenden Themen: Das erste Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Inhalte und Ziele der folgenden Kapitel. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen menschlicher Kommunikation. Dabei werden unter anderem gängige Theorien wie das Sender-Empfänger-Modell und das Vier-Ohren-Modell von Friedrich Schulz von Thun behandelt, als auch Aspekte der Metakommunikation und unterschiedliche Gedächtnissysteme. Im dritten Kapitel wird die personenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers erläutert. Ein wichtiger Baustein dieses Kapitel bildet Carl Rogers Persönlichkeitsmodell. Das vierte Kapitel widmet sich den Grundsätzen der Direktiven Gesprächsführung nach Albert Ellis. Jürgen Wingchen geht in diesem Teil auf die untrennbare Wechselbeziehung von Denken und Fühlen ein (Rational-Emotive Therapie, RET) und die „Anatomie der Emotionen“ (ABC der Emotionen). Die Grundlagen der Transaktionsanalyse von Eric Berne bilden den Grundstock des fünften Kapitels. Der Autor führt in das Persönlichkeitsmodell der Transaktionsanalyse ein und geht im Folgenden auf Sigmund Freuds Instanzmodell ein. Kapitel sechs befasst sich mit dem Modell des Neurolinguistischen Programmierens (NLP). Der Autor geht hier besonders auf den Aspekt ein, wie Menschen sich selbst und ihre Umwelt wahrnehmen und diese Informationen verarbeiten und entsprechend kommunizieren. Aspekte der nonverbalen Kommunikation werden in Kapitel sieben ausführlich dargelegt. Haltung, Mimik, Gestik, Körpersprache und Berührung spielen in diesem Teil des Buches eine bedeutende Rolle. Im letzten Kapitel des theoretischen wird die Funktion von Lachen im Bereich der Kommunikation aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Teil B widmet sich ausgewählten Kommunikationsfeldern und Pflegephänomenen. Dabei behandelt der Autor folgende Themengebete: Kommunikation und Gesprächsführung in der Gerontopsychiatrie, Die Begleitung Sterbender und Trauernder, Kommunikation und Aphasie, Kommunikation und Mitarbeiterführung, Angehörigenarbeit und Beschwerdemanagement, Kommunikation in Krisensituationen. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich Hinweise zur Fort- und Weiterbildung. Außerdem findet der Leser und Lerner am Ende der einzelnen Kapitel einen Lernzielkatalog, mit dem das erworbene Wissen überprüft werden kann. Hilfreich sind die Stichworte am Seitenrand, mit denen man sich schnell einen Überblick verschaffen kann und die die Suche nach bestimmten Stichpunkten erleichtern. Das Buch eignet sich besonders für Lehrende und Lernende im Gesundheits- und Pflegebereich, die daran interessiert sind, ihre kommunikative Kompetenz zu vertiefen und zu erweitern. Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Modelle 15 1.2 Kommunikationsfelder 16 1.3 Anhänge und Marginalien 16 A Modelle 2 Grundlagen menschlicher Kommunikation 18 2.1 Kommunikation und Interaktion 18 2.2 Das Sender-Empfänger-Modell 19 2.3 Metakommunikation 20 2.4 Gedächtnissysteme und Kommunikation 22 2.5 Schichtenspezifischer Sprachgebrauch 25 2.6 Paul Watzlawick: Inhalts- und Beziehungsaspekte von Kommunikation 27 2.7 Die Erweiterung: Friedemann Schulz von Thun »Mit vier Ohren hören« 30 2.8 HoRmo Sapiens 31 2.9 Die Bedürfnis-Pyramide nach Maslow 33 2.10 Frustrations-Aggressions-Hypothese 38 2.10.1 Die Neuformulierung der Frustrations- Aggressions-Theorie durch Leonard Berkowitz 39 2.10.2 Frustrationstoleranz 42 2.10.3 Aggressionsverschiebung 43 Lehrzielkatalog 45 Weiterführende Literatur 46 3 Die personenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers 47 3.1 Carl Rogers: Das Persönlichkeitsmodell 47 3.2 Effektive Rahmenbedingungen für seelisches Wachstum 51 3.2.1 Hilfen für die Schaffung effektiver Kommunikation 52 5 3.2.1.1 Kommunikative Türöffner 52 3.2.1.2 Effektives (passives) Zuhören 53 3.2.1.3 Aktives Zuhören 54 3.2.2 Drei Forderungen an eine personenzentrierte Gesprächsführung 56 3.2.2.1 Akzeptanz 56 3.2.2.2 Kongruenz 60 3.2.2.3 Empathie 62 3.2.3 Kommunikationssperren und »Killerphrasen« 66 Lehrzielkatalog 70 Informationen zu Fort- und Weiterbildung 71 Weiterführende Literatur 71 4 Direktive Gesprächsführung nach Albert Ellis 72 4.1 R-E-V-T: Das Persönlichkeitsmodell 73 4.1.1 Reize, Reaktionen, Kognitionen 74 4.1.2 Zentrale Menschliche Werte 78 4.2 Albert Ellis: Von der Psychoanalyse zur Rational-Emotiven (Verhaltens-)Therapie 79 4.3 R-E-V-T: Das A-B-C-Modell 80 4.3.1 Emotionen 80 4.3.2 Irrationale Ideen – Versuch einer Klassifikation 82 4.4 Der Kommunikationsprozess: Der sokratische Dialog 87 4.4.1 Voraussetzungen therapeutischer Kommunikation 88 4.4.2 Phasen der Intervention 89 4.4.2.1 Identifikation der auslösenden Reize 89 4.4.2.2 Konfrontation mit irrationalen Lebensauffassungen 90 4.4.2.3 Alternative rationale Lebensauffassungen 92 4.5 R-E-V-T in der psychosozialen Beratung 93 Lehrzielkatalog 95 Informationen zu Fort- und Weiterbildung 97 Weiterführende Literatur 97 5 Grundlagen der Transaktionsanalyse 98 5.1 Transaktionsanalyse: Das Persönlichkeitsmodell 98 5.1.1 Das Instanzenmodell nach Sigmund Freud 99 5.1.2 Die Ich-Zustände der Transaktionsanalyse 100 5.1.3 Die Strukturanalyse 101 5.1.3.1 Das Kind-Ich 101 5.1.3.2 Das Eltern-Ich 104 5.1.3.3 Das Erwachsenen-Ich 105 5.2 Analyse von Transaktionen 106 5.2.1 Komplementäre Transaktionen 107 5.2.2 Gekreuzte Transaktionen 109 5.2.3 Verdeckte Transaktionen 113 5.3 Komplexe Transaktionen 115 5.3.1 Verfahren 116 5.3.2 Rituale 116 5.3.3 Zeitvertreibe 116 5.3.4 Spiele 117 Lehrzielkatalog 118 Informationen zu Fort- und Weiterbildung 119 Weiterführende Literatur 119 6 Neurolinguistische Programme (NLP) 120 6.1 Statt eines Persönlichkeitsmodells 121 6.1.1 Landkarten des Denkens 121 6.1.1.1 Neurologische Einschränkungen 122 6.1.1.2 Soziale Einschränkungen 123 6.1.1.3 Individuelle Einschränkungen 124 6.1.2 Repräsentationssysteme 126 6.1.2.1 Lern- und Gedächtnistypen 127 6.1.2.2 Repräsentationssysteme und Wortwahl 128 6.1.2.3 Repräsentationssysteme und Augenbewegungsmuster 129 6.1.2.4 Weitere Indikatoren für die Identifikation von Repräsentationssystemen 130 6.2 Spezifische NLP-Techniken 132 6.2.1 Herstellen von »Rapport« 132 6.2.1.1 Ähnliche Einstellungen und Vorlieben 132 6.2.1.2 Gemeinsamkeiten der Repräsentationssysteme 133 6.2.1.3 Gemeinsamkeiten der Körpersprache 133 6.2.1.4 »Pacing« und »Leading« 133 6.2.2 Ankern 134 6.2.2.1 Klassisches Konditionieren nach Pawlow 134 6.2.2.2 Koinzidenz-Detektor Gehirn 135 6.2.3 Reframings 136 6.2.3.1 Kontext-Reframings 137 6.2.3.2 Bedeutungs-Reframings 138 6.2.3.3 Inhalts- und inhaltsfreies Reframing 139 6.2.4 Therapeutische Metaphern 139 6.2.4.1 »Wohlgeformte« Zielformulierungen in Metaphern 140 6.2.4.2 Isomorphismus in Metaphern 141 6.2.4.3 Die Kategorien von Virginia Satir in Metaphern 142 6.2.4.4 Umgang mit Repräsentationssystemen in Metaphern 143 6.2.4.5 Offene Metaphern 143 Lehrzielkatalog 144 Informationen zu Fort- und Weiterbildung 146 Weiterführende Literatur 146 7 Nonverbale Kommunikation 147 7.1 Dimensionen nonverbaler Kommunikation 147 7.2 Geist und Körper 149 7.2.1 Die Haltung 152 7.2.1.1 Kopf und Hals 153 7.2.1.2 Perspektiven von Kommunikation 154 7.2.1.3 Standpunkte 155 7.2.1.4 Der Gang 156 7.2.1.5 Das Sitzen 157 7.2.2 Die Mimik 157 7.2.2.1 Der Stirnbereich 158 7.2.2.2 Das Mittelgesicht 158 7.2.2.3 Mund und Kinnpartie 159 7.2.3 Die Kleidung 160 7.2.4 Die Gestik 161 7.2.4.1 Ersatzhandlungen 162 7.2.4.2 Gesten zwischen Gefühlen und interpersonellen Einstellungen 163 7.2.4.3 Gesten zur Veranschaulichung 163 7.2.5 Redeweise 163 7.2.6 Reviere 165 7.2.6.1 Sitzpositionen 165 7.2.6.2 Territorialansprüche 167 7.2.7 Berührungen 170 7.2.8 Olfaktorisch-gustatorische Kommunikation 172 7.3 Körpersprache: Angeboren oder erlernt? 173 7.3.1 Kulturübergreifende Verhaltensweisen 174 7.3.2 Kulturüberformte Verhaltensweisen 175 7.3.3 Angeborene »Pflegeauslöser« 175 7.4 Störungen der Körpersprache 177 Lehrzielkatalog 179 Weiterführende Literatur 180 8 Lachen und Kommunikation 181 8.1 Verhaltensbiologische Anmerkungen zu Lächeln und Lachen 183 8.1.1 Das Lächeln im menschlichen Verhalten 183 8.1.2 Die Bedeutung des Lachens im menschlichen Verhalten 184 8.2 Tiefenpsychologie des Lachens 187 8.2.1 Das Komische bei Sigmund Freud 187 8.2.1.1 Das Komische wird gefunden 187 8.2.1.2 Das Komische wird gemacht 188 8.2.2 Humor 188 8.2.3 Der Witz 190 8.2.3.1 Harmlose Witze 190 8.2.3.2 Tendenziöse Witze 191 8.3 Lachen als Therapie: Befreiendes Lachen 193 8.3.1 Lachen: Ausdruck des Lustprinzips 194 8.3.2 Prinzip »Clown« 196 8.3.3 Therapeutisches Lachen und Rapport 196 8.4 »Lach-Techniken« 198 Lehrzielkatalog 202 Weiterführende Literatur 204 B Kommunikationsfelder 9 Kommunikation und Gesprächsführung in der Gerontopsychiatrie 208 9.1 Das Freudsche Instanzenmodell und die psychiatrische Klassifikation 208 9.1.1 Neurosen und endogene Psychosen 209 9.1.2 Verwirrtheit 211 9.2 Kommunikation mit Verwirrten und Wahnkranken 211 9.2.1 Kongruenz, Akzeptanz und Empathie in der Kommunikation mit Wahnkranken 211 9.2.2 Kongruenz, Akzeptanz und Empathie in der Kommunikation mit verwirrten alten Menschen 214 9.2.3 Der personenzentrierte Ansatz nach Tom Kitwood 217 Lehrzielkatalog 222 Weiterführende Literatur 223 10 Die Begleitung Sterbender und Trauernder 224 10.1 Das Sterben 224 10.1.1 Modelle des Sterbens 224 10.1.2 Kommunikation in der Begleitung Sterbender 230 10.1.2.1 Veränderte Wahrnehmung 230 10.1.2.2 Klientenzentrierte Begleitung 230 10.1.2.3 Die Symbolik der Sprache Sterbender 233 10.1.2.4 Bewusstsein und Orientierung Sterbender 234 10.2 Verlassen sein: Die Trauer 235 10.2.1 Modelle des Trauerns 235 10.2.2 Trauern: Eine Aufgabe 240 10.2.3 Trauern und Kommunikation 241 Lehrzielkatalog 244 Weiterführende Literatur 245 11 Kommunikation und Aphasie 246 11.1 Apoplex und Kommunikationsstörungen 247 11.1.1 Neglect-Syndrom 247 11.1.2 (Sprach-)Apraxie 248 11.2 Aphasien: Eine Differenzierung 248 11.2.1 Die amnestische Aphasie 248 11.2.2 Die Broca-Aphasie 249 11.2.3 Die Wernicke-Aphasie 250 11.2.4 Die Global-Aphasie 251 11.3 Gespräche führen mit Aphasikern 251 11.3.1 Kongruenz, Akzeptanz und Empathie 252 11.3.2 Besondere Hinweise für die Kommunikation mit Aphasikern 254 Lehrzielkatalog 255 Weiterführende Literatur 256 12 Kommunikation und Mitarbeiterführung 257 12.1 Informationsgespräche 257 12.1.1 Der Phasenverlauf von Informationsgesprächen 258 12.1.2 Motivation und Vermittlung in Informationsgesprächen 258 12.2 Beurteilungsgespräche 262 12.2.1 Beurteilungsfehler 263 12.2.2 Verlauf eines Beurteilungsgespräches 264 12.3 Kritikgespräche 266 Lehrzielkatalog 269 Weiterführende Literatur 269 13 Angehörigenarbeit und Beschwerdemanagement 270 13.1 Beschwerden und Konfusionen 271 13.2 Beziehung schaffen 271 Lehrzielkatalog 273 Weiterführende Literatur 273 14 Kommunikation in Krisensituationen 274 14.1 Krisen und Probleme 274 14.2 Phasenmodell der Krisenbewältigung nach Gerald Caplan 276 14.3 Krankheit als Krise 279 Lehrzielkatalog 282 Weiterführende Literatur 282 Literatur 284 Register 292 |
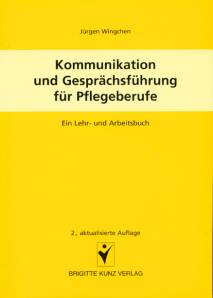
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen