|
|
|
Umschlagtext
Wir sind erfolgreich im Beruf, führen eine glückliche Ehe und haben ein schönes Haus. Den ganzen Tag sind wir damit beschäftigt, an der Optimierung unserer Lebensbaupläne zu feilen – aber wir sprechen nicht gerne über das Scheitern, denn dahinter verbergen sich geplatzte Träume und verlorene Illusionen. Doch gerade in unserer Zeit, in der jeder Einzelne hochgesteckte Ziele und Ansprüche hat, stehen unsere Chancen zu scheitern so gut wie nie zuvor. Christiane Zschirnt zeigt jedoch, dass Scheitern nicht das schwarze Loch ist, vor dem wir uns fürchten müssen - sondern dass es zu unserem Leben gehört un dwir einen souveränen Umgang damit lernen können.
Jeder Mensch scheitert auch einmal in seinem Leben. Scheitern ist eine Erfahrung, die uns alle angeht. Und doch ist das Thema ein Tabu in unserer Hochtourigen Erfolgsgesellschaft: Wir breiten den Mantel des Schweigens über unsere Niederlagen und vermeiden es, über geolatzte Träume und verlorene Illusionen zu sprechen. Aber wir kommen nicht länger umhin, uns mit dem Scheitern auseinanderzusetzen. Denn wir leben in einer Zeit, in der es scheint, als könne jeder alles erreichen: Wir haben große Erwartungen und stellen die höchsten Ansprüche an uns selbstdoch damit stehen auch unsere Chancen zu scheitern so gut wie nie zuvor. Christiane Zschirnt zeigt, dass Scheitern aber nicht das schwarze Loch ist, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern ein Teil unseres Lebens, den wir betrachten können und der damit seinen Schrecken verliert. Scheitern ist eine Erfahrung, die uns ermutigen soll, unser Leben unter neuen Vorzeichen zu beginnen. Christiane Zschirnts kluges und glänzend geschriebenes Buch ist ein Plädoyer für einen neuen Umgang mit der Kehrseite des Erfolgs und fordert uns auf, einen souveränen Umgang mit Misserfolgen und Niederlagen zu erlernen: Moderne Menschen scheitern - aber sie können das auch. Christiane Zschirnt wurde 1965 in Bremen geboren. Sie studierte Anglistik, Kunstgeschichte und Germanistik in Hamburg. 2001 veröffentlichte sie das "Shakespeare-ABC" und 2002 das viel beachtete "Bücher. Alles, was man lesen muss". Christiane Zschirnt lebt als Autorin in Hamburg. Rezension
Unter dem Titel "Keine Sorge, wird schon schiefgehen" stellt man sich wohl am ehesten ein Buch vor, das als Motivationstrainer dient und Wege aufzeigt, wie man das Scheitern im beruflichen und privaten Bereich verhindern kann. Christiane Zschirnts Buch beschreibt jedoch eine Phänomenologie des Scheiterns: Sie zeigt, was Scheitern zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten der europäischen Kulturgeschichte bedeutet hat, anhand von Bildern (insbesondere anhand von Pieter Bruegels "Sturz des Ikarus") und Geschichten, besonders anhand von Geschichten der Weltliteratur (Odyssee, Ödipus-Sage, Hamlet, Don Quijote usw.). Wer wollte behaupten, Scheitern sei kein Thema, wenn es sich gerade in den großen Werken der Literatur findet? Deren Aktualität wird damit ebenso erkennbar wie die besondere Gefährdung gerade des modernen Menschen, zu scheitern (siehe Leseprobe). Insofern kann die Lektüre des Buchs nicht nur eine genüssliche Lesereise durch die europäische Kulturgeschichte unter dem Schlagwort "Scheitern" bieten, sondern auch helfen, persönliche Erfahrungen im neuen Licht zu sehen und damit auch zu verarbeiten und die Angst vor dem Scheitern zu bekämpfen.
Melanie Förg, Lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Ein brillant geschriebener Streifzug durch die Kulturgeschichte des Scheiterns – und ein Plädoyer für einen positiven Umgang mit der Kehrseite des Erfolgs. Wir sind erfolgreich im Beruf, führen eine glückliche Ehe und haben ein schönes Haus. Den ganzen Tag sind wir damit beschäftigt, an der Optimierung unserer Lebensbaupläne zu feilen – aber wir sprechen nicht gerne über das Scheitern, denn dahinter verbergen sich geplatzte Träume und verlorene Illusionen. Doch gerade in unserer Zeit, in der jeder Einzelne hochgesteckte Ziele und Ansprüche hat, stehen unsere Chancen zu scheitern so gut wie nie zuvor. Christiane Zschirnt zeigt, dass Scheitern nicht das schwarze Loch ist, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern ein Teil unseres Lebens, den wir betrachten können und der damit seinen Schrecken verliert. Scheitern ist eine Erfahrung, die uns ermutigen soll, unser Leben unter neuen Vorzeichen zu beginnen. Autoreninformation: CHRISTIANE ZSCHIRNT wurde 1965 in Bremen geboren. Sie studierte Anglistik, Kunstgeschichte und Germanistik in Hamburg. 2001 veröffentlichte sie das "Shakespeare-ABC" und 2002 das viel beachtete "Bücher. Alles, was man lesen muss". Christiane Zschirnt lebt in Hamburg. (Info unter www.randomhouse.de/goldmann) Inhaltsverzeichnis
Die Welt, in der wir scheitern
Einleitung Warum wir alle scheitern Große Erwartungen Gefühltes Scheitern Ausweglosigkeit Scheitern als Chance Das Scheitern anderer betrachten Fliegen und tief fallen: Pieter Bruegel, Sturz des Ikarus Gewinner und Verlierer: Männer am Südpol Scheitern meistern Auf dem Weg nach Amerika Ehre, Status und Erfolg „Jeder Mann trägt sein Glück in seinen eigenen Händen“ Verdient scheitern: Robinson Crusoe Pflichterfüllung: Samuel Smiles und Herbert Spencer Heiter Scheitern: Mr. Micawber In Amerika Ohne Fleiß kein Preis: Benjamin Franklin Strebe und Siege: Horatio Alger „Gott gab mir mein Geld“: John D. Rockefeller „Ich könnte nur noch heulen“: Die Quarterlife Crisis Scheitern erleben Schiffbruch erleiden: Odysseus Sich mit Missgeschicken abfinden 1: Ödipus Sich mit Missgeschicken abfinden 2: Sündenfall Intelligent scheitern: Hamlet Scheitern und Erkenntnis: Montaigne Desillusionierung: Don Quijote Scheitern für alle: Glück und Liebe Luftschlösser bauen: Anton Reiser Scheitern und Lebenslüge: Der Grüne Heinrich Scheitern verwandeln Auffallen statt Fallen: Bohemiens Die Latte hochlegen, dann darunter hindurchgehen: Dada und Samuel Beckett Das eigene Leben wahrnehmen:Virginia Woolf Charlies heimliche Macht über das Scheitern: Charlie Chaplin Besser scheitern können LESEPROBE: (von www.randomhouse.de/goldmann) Die Welt, in der wir scheitern Einleitung Wir sprechen nicht gern über das Scheitern. Wir denken auch nicht gern darüber nach. Wir mögen dieses Wort nicht besonders: scheitern. Wir mögen es so wenig wie das, was es bezeichnet: Erfolglosigkeit, verlorene Träume, Desillusionierung. Aber das Scheitern gehört zum Leben dazu, sagt man. Möglichst nicht zu unserem eigenen Leben, natürlich. Nur, wir hören überall davon. Von geplatzten Karriereaussichten, von einer kaputten Ehe. Von einer beendeten Beziehung – gerade, als der Nachwuchs unterwegs ist. Von Arbeitslosigkeit und der Angst vor Statusverlust oder Armut. Wir haben vom Traum von der eigenen Firma gehört, der zum Albtraum wurde. Und von den einst schönen Aussichten auf Haus und Kinder und Erfolg. Die Abendnachrichten meldeten die Blamage eines bekannten Politikers, dessen Bilderbuchlaufbahn, in der alles immer so glatt zu laufen schien, nun beendet ist. Und im Freundeskreis durchlebt jemand eine Lebenskrise, die plötzlich alles, was er erreicht hat, was er besitzt und was er geworden ist, in Frage stellt. Der amerikanische Soziologe Richard Sennett bezeichnete das Scheitern Ende der 90er Jahre als das letzte große Tabu der modernen Gesellschaft. Er hat Recht. Wir behandeln das Scheitern wie die Untertanen der Königin Viktoria das Thema Sex: Alle denken ständig daran, keiner spricht darüber. In unserer hochtourigen Erfolgsgesellschaft, in der die Frage Erfolg oder nicht? nur eine einzige Antwort kennt, ist das Scheitern immer da, wie ein lästiges Hintergrundgeräusch: als Angst vor dem Versagen, als Angst vor Armut, als Angst, den Status nicht aufrechterhalten zu können. Als Angst, nicht gut genug zu sein, oder als Angst, das eigene Niveau nicht halten zu können. Im sexfeindlichen 19. Jahrhundert konnte es im Extremfall passieren, dass im bürgerlichen Wohnzimmer die gedrechselten Beine eines Flügels mit Stoff verhüllt wurden, damit ihr hölzerner, aber doch wohl auch irgendwie femininer Charme niemanden auf falsche Gedanken bringen konnte – aber zur selben Zeit existierte, als komplementäres Element zur Prüderie, eine nicht allzu geheim gehaltene Kultur der verbotenen Lüste und Perversionen, mit Bordellen, pornografischer Literatur und SM-Clubs, den so genannten „Flagellation-Clubs“. Auch das gegenwärtige Schweigen über das Scheitern hat eine solche Gegenkultur hervorgebracht: Im selben Maße, in dem das 19. Jahrhundert seine unterdrückte Lust übersteuerte und im Verborgenen wuchern ließ, produziert heute die große Angst vor dem Scheitern eine medienwirksame Geschwätzigkeit, die das Schweigen nicht bricht, sondern höchstens den Voyeurismus befriedigt. Das öffentlich zelebrierte Scheitern von Fußballspieler- Ehen oder Politikern und die exhibitionistischen Erlebnisberichte gescheiterter Start-ups aus den vergangenen Jahren sind Medienereignisse und dienen unserer Unterhaltung. Die Massenmedien lieben eine ordentliche Fallhöhe, aber sie können natürlich nicht erklären, was es bedeutet zu scheitern, und sie können auch nicht sagen, was uns davon abhält, selbstbewusst mit unserem persönlichen Waterloo umzugehen. Frei nach der Devise des englischen Dandys, Max Beerbohm, das Scheitern sei viel interessanter als der Erfolg, präsentieren sie dieses Phänomen als bunten Strauß aus Peinlichkeiten und generieren so die Schwierigkeit, darüber zu sprechen. Normalerweise geben unsere Erfolge die Themen für den sozialen Umgang miteinander vor, nicht unsere Misserfolge. Wer kennt nicht die freundlich taxierende Frage, die Partygäste einander stellen: „Was machen Sie denn?“, die in Wirklichkeit heißt: „Sind Sie etwa erfolgreicher als ich?“ Wir erzählen kaum einmal unseren Freunden von unseren Fehlschlägen, wir sprechen nicht offen über das, was wir offensichtlich nicht können oder was uns danebengegangen ist. Wir schweigen und kippen Sand auf das, was darunter weiterschwelt, denn mit den psychischen, finanziellen oder existenziellen Folgen müssen wir so oder so klarkommen. Je dramatischer, je tief greifender die Folgen unseres Scheiterns, desto unwahrscheinlicher, dass wir darüber sprechen. Wir behalten unser Versagen für uns, wir offenbaren anderen nicht die Nachweise unserer Unfähigkeit – es sei denn, es handelt sich dabei, rückblickend, um Anekdoten auf dem Weg zum Erfolgreichsein. Dass B. sechsmal durch die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule geflogen ist, erzählt sich gut, wenn sie bereits auf dem besten Weg ist, ein Star zu werden. Dass K’s Roman jahrelang niemand haben wollte, verrät sich leicht, nachdem er sich 30 000-mal verkauft hat. Dass M. 1984 das Abi nicht geschafft hat, muss nicht mehr verheimlicht werden, wenn die erste Million verdient ist. Doch der Satz: „Ich bin in diesem oder jenem Punkt gescheitert“, kommt uns grundsätzlich nicht über die Lippen, solange das Ende noch offen ist. Und es ist wohl – unter den gegebenen Umständen – auch nicht ratsam, ihn überall auszusprechen und sich damit schutzlos einer Umwelt auszuliefern, in der das Scheitern als etwas Blamables, etwas Unaussprechliches gilt. Man scheitert eben nicht. Oder doch? Der gewaltigen Flut von Selbsthilfebüchern über das Erfolgreichsein, die uns das Blaue vom Himmel versprechen, steht eine Hand voll von Veröffentlichungen gegenüber, die helfen wollen, wenn es trotz der guten Ratschläge nicht geklappt hat – mit dem Reichwerden und/oder dem Geliebtsein. Und blicken wir in die Seminare der Universitäten. Die Literatur kennt seit ihren Anfängen zwei wiederkehrende Themen, die Liebe und das Scheitern. Aber die Doktorarbeiten und Habilitationen der Literaturwissenschaftler werden vorzugsweise über andere Themen geschrieben, jedenfalls nicht darüber, was es bedeutet, wenn Menschen mit ihren Ambitionen und Wünschen an eigene oder fremde Grenzen stoßen. Man schreibt hier lieber über die erzähltechnischen Besonderheiten des Turmmotivs. Und nicht anders verhält es sich im Berufsleben. Viele Personalberater sind heute längst nicht mehr ausschließlich fixiert auf schöne, in einer makellosen Linie nach oben deutende Lebensläufe. Sie machen aus der Not eine Tugend und gehen kreativ mit den eher unrühmlichen Ereignissen einer Biographie um. Aber niemand sollte sich deshalb ermutigt fühlen, das Kind in einem Assessment-Center beim Namen zu nennen. Er oder sie sollte stattdessen von Herausforderungen oder Flexibilität oder Lernbereitschaft sprechen, in jedem Fall nicht dieses Wort benutzen, das mit Sch beginnt. Während ich an diesem Buch arbeitete, bekam ich täglich frisch eine Liste von fünf bis zehn Internetseiten, auf denen es ums Scheitern ging. Die Auswahl war dem Medium entsprechend wahllos, allerdings tauchte Scheitern auf den deutschsprachigen Seiten stets in denselben Kontexten auf. Es ging um das Scheitern von Gipfelgesprächen, das Scheitern der Bildungspolitik, das Scheitern von Ich-AGs unter ökonomischen Gesichtspunkten – aber in all den Wochen und Monaten, in denen ich jeden Morgen erfuhr, wo ein Projekt im Sand verlaufen oder wo politische Verhandlungen ergebnislos geblieben waren, gab es nicht den geringsten Hinweis darauf, dass das Scheitern auch in Lebensläufen vorkommen kann. Die Internetseiten, die aus Amerika kamen, waren anders. Etwa ein Drittel von ihnen thematisierte das Scheitern als dramatischen Einbruch in die Biographie. Was dann im Einzelnen geraten wurde, um mit den Problemen umzugehen, war ganz unterschiedlich und hing davon ab, ob die Seite von einer Baptistengemeinde stammte, von einer Universität oder einem Karriere- Coach. Der größte gemeinsame Nenner war bei allen amerikanischen Seiten jedoch, dass sie das Scheitern als Folge nicht erbrachter individueller Leistungen sahen und die Meinung vertraten, jeder könne sich selbst aufgrund eigener Anstrengungen aus seinem persönlichen Jammertal herausbringen, um anschließend den ersehnten triumphalen Erfolg zu erleben. In welchem Maße dies etwas über einen empfehlenswerten Umgang mit dem Scheitern aussagt, oder über die amerikanische Kultur, werden wir sehen. Doch zweifellos: im Unterschied zu Deutschland steht das Thema „Scheitern in Biographien“ in den USA auf der Tagesordnung, und damit dort, wo es auch bei uns hingehören sollte. Zu scheitern bedeutet, an eine Grenze zu kommen, an der es nicht weitergeht, jedenfalls nicht so wie bisher. Wer scheitert, der trifft mit seinen Ambitionen auf etwas, was er nicht gewollt hat, gegen das er sich nicht wehren kann. Die beiden großen Metaphern für das Scheitern brachten diese Grunderfahrung seit jeher zum Ausdruck: im Bild vom Schiffbruch und im Bild vom tiefen, schicksalhaften Fall eines einzelnen Menschen. Seit der Antike drückten beide Bilder einen dramatischen Einbruch im menschlichen Leben aus und führten sinnbildlich vor, was geschieht, wenn einzelne Menschen unberechenbaren Gewalten hilflos ausgeliefert sind. Auch heute sprechen wir vom „Schiffbruch „ und „Absturz“ und fürchten die Unberechenbarkeit des Scheiterns. Scheitern ist immer eine schreckliche Erfahrung. Eine Welt bricht zusammen, es ist danach nichts mehr so, wie es vorher war; ganz egal, ob es die Beziehung ist, der Beruf, das Studium oder ein lang gehegter Traum, der aufgegeben werden musste. Es ist beängstigend und entmutigend, und es stellt außerordentliche Ansprüche an den, der das erlebt. Er oder sie muss dann weitermachen, irgendwie, ohne klar definiertes Ziel und ohne Plan, denn es liegt in der Struktur des Scheiterns, dass man nicht wissen kann, wie es danach weitergehen soll. Scheitern lässt die Zukunft für eine Weile abhanden kommen. Ausgerechnet das, was man nun am dringendsten braucht – einen Plan, eine Perspektive –, ist nicht zu haben, weil mit dem Erleben des Scheiterns die eigene Vergangenheit und die Gegenwart mit erschüttert sind. Es gibt dann erst einmal keine sichere Position mehr, von der aus sich etwas entscheiden ließe. Dies ist das gewaltige Dilemma. Und dies kommt, wie ich zeigen werde, in der beliebten Floskel vom „Scheitern als Chance“ nur sehr verhalten zum Ausdruck. Wer heute an eine Grenze stößt, die unüberwindbar scheint oder es auch ist, der kommt damit nicht gut klar. Das liegt nicht nur daran, dass niemand gerne Schwächen oder Fehleinschätzungen eingesteht. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Grenzen immer nur dann sichtbar werden dürfen, wenn es darum geht, sie zu überschreiten. Fast jeder urban lebende, global denkende Zeitgenosse zwischen zwanzig und fünfzig ist ein Virtuose der Grenzüberschreitung. Wir können Weltmusik hören, in der sich afrikanische Rhythmen mit französischen Chansons vermischen, wir können, wenn nötig, die Grenzen der Geschlechterrollen überspringen, wir zucken auch nicht mit der Wimper, wenn wir Fusion- Food essen sollen, Sushi mit Steckrübenragout. Wer es sich leisten kann, bucht Helikopter-Skiing im Himalaja, alle anderen haben wenigstens noch das Guinnessbuch der Rekorde. Wir testen ständig irgendwelche Grenzen und denken dabei: wie hoch, wie weit, wie viel, wie schnell, wie lang – und meinen eigentlich: Darf es noch ein bisschen mehr sein? Den Marathonlauf nach 38 Kilometern vor Erschöpfung abbrechen zu müssen, das unverfilmte Drehbuch für immer in der Schublade verschwinden zu lassen, nach einem Bewerbungsgespräch eine Absage erteilt zu bekommen: das sind schmerzhafte Niederlagen, die wir anders wahrnehmen als irgendeinen alltäglichen Misserfolg. Was bestimmte Situationen des Unvermögens unerträglicher macht als andere, ist das Bewusstsein der Grenzerfahrung. Scheitern ist nicht das Malheur, Missgeschick und Pech, die Panne oder der Irrtum. Es ist etwas anderes als der ganz normale Schlamassel des Alltags, zu dem es beispielsweise gehört, dass man sein geparktes Auto nicht auf Anhieb wiederfindet, sich morgens Marmelade aufs Hemd kleckert oder vergeblich versucht, die Rückwand aus Pappe in ein Ikea- Möbel zu schieben. Scheitern spielt sich in anderen Dimensionen ab, wer scheitert, wirft kein Wasserglas um. Es geht um mehr: Es ist eine Grenzerfahrung, die das ganze Leben in Mitleidenschaft zieht. Die Folgen können von Fall zu Fall unterschiedlich dramatisch sein, aber in jedem Fall verändern sie die Vorstellung davon, wer man ist, was man kann, was man hat. Die Vorstellung von einer alles erschütternden Grenzerfahrung im menschlichen Leben hat die europäische Kultur seit der Antike erschreckt, und vor allem: fasziniert. In der griechischen Tragödie wurde das ganze Publikum Zeuge eines gewaltigen Untergangs des Protagonisten auf der Bühne. Dort war das Scheitern noch das fragwürdige Privileg des Helden. Erst mit Anbruch der Moderne wird es eine Erfahrung, die jeder Mensch machen kann, weil sich nun einzelne Menschen fragen mögen:Wer bin ich, was kann ich, was habe ich? Wenn solche Fragen an sich selbst möglich sind, riskiert man bei dem Versuch, eine Antwort darauf zu finden, erschüttert zu werden. Weil sich jeder in der modernen Welt ständig diese Fragen stellen kann (oder muss), fallen auch die Antworten darauf entsprechend unterschiedlich aus, je nachdem, wer sie sich an welche Stelle seines Lebens stellt und unter welchen Bedingungen. Wenn wir in der modernen Welt vom Scheitern sprechen, haben wir es also mit einem gewaltigen Spektrum zu tun. Während sich der eine als gescheitert empfindet, weil er in seinen Ambitionen nicht dort angekommen ist, wo er hätte ankommen können, liegt ein anderer in jeder Hinsicht am Boden. An dem einen nagt der Zweifel des Erfolgs, weil er zwar Universitätsprofessor geworden ist, nicht aber der Wissenschaftsstar, der er hätte werden wollen; ein anderer kann seine Miete nicht bezahlen. Das Erleben des Scheiterns ist beiden vertraut. Hinter diesen individuellen Erfahrungen persönlicher Tiefschläge steht eine Kultur des Scheiterns, die wir kaum kennen. Diese selten betretenen Räume werde ich beschreiben, denn wir sollten mit der Kultur der Niederlagen in jedem Fall besser vertraut sein als mit der Angst vor Niederlagen, damit sich unsere Perspektive beim Blick auf das Scheitern nicht völlig verzerrt. Statt ein diffuses und ungutes Gefühl beim bloßen Gedanken an das Wort „scheitern“ zu durchleben, können wir uns genauso gut an der Fülle von Bildern, Figuren und Erzählungen schadlos halten: an Ikarus, am tiefen Fall des Helden in der antiken Tragödie, am Schiffbruch, am gescheiterten Genie, an der ironischen Freude am kaputten Leben, an der Lebenslüge, am Comeback. Wenn wir das Scheitern auf diese Weise mit Distanz betrachten, können wir erkennen,was daran schrecklich ist (und was nicht), und wenn wir dies erst einmal tun, kann es zumindest nicht mehr beschämen. Wenn wir das Scheitern als Teil unserer Kultur verstehen, brauchen wir auch nicht mehr automatisch den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn es uns zustößt. Gescheitert müssen wir uns dann auch nicht ausgestoßen fühlen, oder so, als habe man uns die Existenzberechtigung entzogen. Wenn wir auch begreifen, wie die Angst vor dem Scheitern konstruiert wurde und woher sie stammt, verliert sie ein wenig von ihrer Macht über unsere Schreckensphantasien. Niemand kann das Scheitern wollen, aber man kann versuchen, es zu verstehen, um – vielleicht – irgendwann souveräner damit umzugehen. In diesen Wochen im Frühjahr 2005, in denen ich diesen Text schreibe, könnte man in Versuchung geraten, „Scheitern“ mit Arbeitslosigkeit kurzzuschließen. Aber hinter der Idee, ein Buch über das Scheitern zu schreiben, stand nicht die Zahl von über fünf Millionen Arbeitslosen in Deutschland. Und es wäre auch nicht angemessen, Scheitern mit Arbeitslosigkeit gleichzusetzen, weil nicht jeder, der arbeitslos wird, schon automatisch gescheitert ist und weil natürlich auch nicht bloß jene scheitern, die ohne Arbeit und Geld sind. Scheitern kann, aber muss nicht, identisch sein mit Statusverlust oder Armut. Dass wir Scheitern mit beruflichem Misserfolg identifizieren, hat natürlich seine Gründe: In einer Gesellschaft, in der nur die Partnerwahl romantisch begründet sein muss, während alle weiteren großen Entscheidungen des Lebens wenigstens vordergründig am Geld hängen können, haben wir uns angewöhnt, das Gelingen einer Biographie daran zu bemessen, wie erfolgreich jemand im Beruf ist oder gar, wie viel er verdient. Wo die kulturellen Hintergründe für diese traute Zweisamkeit von beruflichem Misserfolg und der Angst vor dem Scheitern zu vermuten sind, werde ich zeigen. Sie zu verstehen ist wichtig, aber noch längst nicht alles, was es über das Scheitern ans Licht zu holen gibt. Als ich die Idee hatte, ein Buch über das Scheitern zu schreiben, wollte ich etwas anderes sichtbar machen. Scheitern ist die Erfahrung von Modernität in Biographien. Scheiternd erfahren wir eine Welt, deren Komplexität wir nicht bewältigen können, im eigenen Leben. In der globalisierten Gesellschaft gibt es für jeden Gelegenheiten zu scheitern. Das unterscheidet unsere Biographien von Lebensläufen vorangegangener Jahrhunderte. Das Scheitern ist allgegenwärtig, vermutlich, weil wir gelernt haben, uns vorzustellen, alles erreichen zu können. Aber wir erleben auch, dass alles ganz anders kommen kann. Wir werfen Lebenspläne wieder um. Wir werden arbeitslos, obwohl wir dachten, eine Banklehre sei eine sichere Sache. Wir bauen uns was auf, ein eigenes Haus, und es fällt um oder stürzt ein, weil drinnen die Beziehung kaputtgeht. Wir trennen uns von unseren Partnern und Kindern, weil es das Beste für alle Beteiligten ist und weil die Gesellschaft uns nicht mehr zwingt, das ganze Leben mit derselben Person zu verbringen. Unsere Kinder haben, wenn sie die Schule verlassen, pro forma so viele Möglichkeiten, „etwas aus sich zu machen“, wie noch keine Generation zuvor – die ganze Welt steht ihnen offen –, aber der Arbeitsmarkt teilt ihnen zur selben Zeit etwas völlig anderes mit, und wir wissen, dass es „den Kindern“ einmal nicht „besser gehen „ wird, weil die alte Erzählung von der sozialen Aufwärtsmobilität über mehrere Generationen ein ganz neues Ende bekommen hat. Wir versuchen uns an allen möglichen Rollen, können dies sein und das: Superstar, Lebensretter, Powerfrau, Mutter, Vater – was wir wollen. Wir probieren die in den Massenmedien erfundenen Idealverläufe von Biographien samt der dazugehörenden Verhaltensweisen und bewegen uns am Ende in der dauerhaften Illusion, der oder die andere sei noch viel wichtiger, noch cooler, noch erfolgreicher als wir selbst. Oder aber wir sind richtig gut und bekommen trotzdem keine Chance. Dies ist ein Buch über die Erfahrung des Scheiterns in Biographien, und nicht über die politischen oder wirtschaftlichen Gründe, die dazu führen (wie sollte man die auch in einem einzigen Buch je beschreiben können). Es zeigt, was Scheitern eigentlich ist, was es zu unterschiedlichen Zeiten bedeutet hat, und betrachtet es aus immer wieder neuen Blickwinkeln. Es ist kein Beitrag zu den immergleichen Schlachtrufen jener Lebensratfibeln, die uns in den Erfolg führen, notfalls auch über Klippen. Dieses Buch behandelt ein Thema, für das uns meistens die Worte fehlen, obwohl es uns unter den Nägeln brennt. Es stellt Fragen über das Verhältnis von Erfolg und Misserfolg, die wir in der Erfolgsgesellschaft mit semireligiöser Entschlossenheit immer schon für beantwortet halten. Was bedeutet Scheitern, welche Vorstellung haben wir davon? Warum ist es ein Tabu-Thema? Gibt es eine Typologie des Scheiterns, und wie sieht sie aus? Wie gehen wir damit um? Warum unterscheiden wir schuldhaftes und unverschuldetes Scheitern? Können Amerikaner besser scheitern als Europäer? Warum drückt uns die Angst vor dem Scheitern im Zeitalter der Machbarkeit? Kennt das Scheitern andere Alternativen als die des Erfolgs? Warum ist Scheitern im Beruf verwerflich, scheitern als Vater jedoch ein Kavaliersdelikt? Ich würde nicht ein Buch über das Scheitern schreiben, wenn ich der Meinung wäre, dass man nicht darüber nachdenken sollte, nicht darüber sprechen kann und dass uns das Thema nichts angeht. Das Scheitern ist näher an uns herangekommen, als das kokette Etikett der Erfolgsgesellschaft oder der Leistungsbegriff uns dies glauben machen wollen. Aber ich denke nicht, dass dies ein Grund zur Panik ist. |
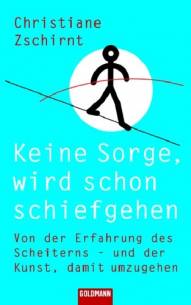
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen