|
|
|
Umschlagtext
Die Friedensethik des Moraltheologen Eberhard Schockenhoff
Eberhard Schockenhoffs Buch gibt Orientierung für das 21. Jahrhundert: Die Friedensethik des profilierten Moraltheologen ist kompetent, allgemeinverständlich und aus christlicher Grundhaltung. Der Kompass für eine Welt, die sich nach Frieden sehnt. In der Friedensethik vollzog sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel: Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Frage, unter welchen Bedingungen die Anwendung militärischer Gewalt gerechtfertigt sein kann, sondern welche Wege zum Frieden führen. Das Buch analysiert die Kriegserfahrungen und Friedenshoffnungen der Menschen von der Antike bis zur Gegenwart. Es verfolgt die Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg und skizziert die Herausforderungen einer Friedensethik für das 21. Jahrhundert. Dabei zeigen sich auch im Konzept des gerechten Friedens Spannungen und Widersprüche. Das Ziel der angestrebten Gewaltfreiheit gerät mit der Schutzverantwortung für Menschen in Not in Konflikt. Das Buch analysiert dieses ethische Dilemma und zeigt konstruktive Wege zu seiner Überwindung. Eberhard Schockenhoff (1953-2020), Dr. theol., war Professor für Moraltheologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, von 2001 bis 2016 Mitglied des Nationalen bzw. Deutschen Ethikrats, seit 2009 ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und seit 2010 Mitglied in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Seine profilierten Beiträge zu innerkirchlichen Fragen und Problemstellungen fanden durchweg Widerhall in Kirche und Theologie. Als wichtiger Brückenbauer unterstützte er nachdrücklich den Reformkurs der katholischen Kirche in Deutschland. Durch sein Engagement im Nationalen bzw. Deutschen Ethikrat erlangte er durch seine Beiträge zu Fragen der Lebensethik Bekanntheit weit über die Fachgrenzen hinaus und trat als eloquenter Gesprächspartner in den verschiedenen Kontexten in Erscheinung. Schockenhoff zählte zu den produktivsten und meistgelesenen theologischen Autoren der Gegenwart, der seine verlegerische Heimat im Verlag Herder gefunden hatte. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen zählen: Zur Lüge verdammt? Politik, Medien, Medizin, Justiz, Wissenschaft und die Ethik der Wahrheit (2000/2005), Wie gewiss ist das Gewissen? (2003), Grundlegung der Ethik (2007/2014), Theologie der Freiheit (2007), Ethik des Lebens (2009/2013), Chancen zur Versöhnung? Die Kirche und die wiederverheirateten Geschiedenen (2011), Erlöste Freiheit – Worauf es im Christentum ankommt (2012), Die Bergpredigt (2014), Kein Ende der Gewalt? Friedensethik für eine globalisierte Welt (2018) und Frieden auf Erden? Weihnachten als Provokation (2019). Seine postum veröffentlichte Sexualethik Die Kunst zu lieben. Unterwegs zu einer neuen Sexualethik (2021) stößt im Kontext der Debatten des Synodalen Weges auf breite Resonanz und wird von wichtigen Fachvertretern als Referenzwerk und Pflichtlektüre (Konrad Hilpert) gewürdigt. Schockenhoffs wichtige Impulse für eine erneuerte, menschenfreundliche Moralverkündigung wirken fort. Seine eigene Stimme und Präsenz wird in den aktuellen kirchlichen Auseinandersetzungen jedoch schmerzlich vermisst. Rezension
Die Sorge um den Frieden ist ein zentrales Anliegen christlicher Ethik und darüber hinaus aller Menschen. Wenn es Aufgabe der Ethik ist, eine reflektierte Theorie menschlicher Lebensführung zu erarbeiten, muss diese in ihren Überlegungen der überragenden Bedeutung, die Frieden hat, breiten Raum widmen. Die grundsätzlichen Fragestellungen der Friedensethik in ihren gegenwärtigen Herausforderungen sind vielseitig und weit verzweigt in zahlreichen Einzelwissenschaften, insbesondere der Geschichtswissenschaft, der (historischen) Friedensforschung, der Theorie der internationalen Politik, der Nationalökonomie, der Völkerrechtswissenschaft und der philosophischen
und theologischen Ethik. Dieses voluminöse Buch verfolgt die Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden und skizziert die Herausforderungen einer Friedensethik für das 21. Jahrhundert. Das erste Kapitel seiner gut 750 Seiten starken Darstellung widmet Schockenhoff einer historisch-staatsrechtlichen Betrachtung der Kriege von der Antike bis in die Gegenwart. Daran schließt er eine ausführliche Betrachtung des „gerechten Kriegs“ an. In ihrer Blütezeit verband sich mit der Lehre vom „gerechten Krieg“ die Hoffnung auf eine dauerhafte Einhegung dieser Art von Gewalt. Zwar war Krieg „erlaubt“, die Zivilbevölkerung sollte jedoch möglichst geschont werden. Im 20. Jahrhundert versagten diese Ideen endgültig. Eine neue Herausforderung stellt sich der Friedensethik mit der nuklearen Abschreckung im Kalten Krieg und der damit verbundenen Möglichkeit, die menschliche Zivilisation vollständig zu vernichten. Nach diesem Grundlagenteil entwirft der Autor eine moderne Friedensethik. In der christlichen Ethik gibt es schon lange Ideen eines gerechten Friedens, der die jahrhundertealte Lehre vom gerechten Krieg ablösen und zugleich die pazifistischen Impulse des biblischen Friedensverständnisses in sich aufnehmen soll. Der Autor benennt vier Säulen des gerechten Friedens: Schutz der Menschenrechte, Demokratieförderung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und eine Stärkung der internationalen Staatengemeinschaft. Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Der profilierteste deutschsprachige Moraltheologe Kompetente, allgemeinverständliche Analysen aus christlicher Grundhaltung Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5
Erster Teil: Kriegserfahrungen und Friedenshoffnungen von der Antike bis zur Gegenwart 1. Der Gestaltenwandel des Krieges und die Entwicklung der Friedensethik 19 1.1. Die Funktion einer Typologie der Kriege für das Verständnis des Friedens 21 1.2 Städtekriege und Eroberungsfeldzüge: Der Krieg in der antikenWelt 22 1.3. Fehden, Glaubenskriege und Kreuzzüge: Kriegführung im Mittelalter 25 1.4. Fürstenkriege, Erbfolgekriege und Staatenbildungskriege: Kriegsverdichtung in der frühen Neuzeit 33 1.5. Die zwischenstaatlichen Kriege im 18. und 19. Jahrhundert 41 1.6. Nationale Kriege im Zeitalter der Französischen Revolution 46 1.7. Die Vorboten des totalen Krieges 51 1.8. Der totale Krieg im 20. Jahrhundert 57 1.9. Versuche zur völkerrechtlichen Ächtung des Krieges 64 1.10. Friedenssicherung und Kriegsgefahren im Atomzeitalter 67 a. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs zur Nachkriegsordnung 67 b. Stellvertreterkriege im außereuropäischen Raum 70 c. Die Logik der atomaren Abschreckung 72 d. Zweifel an der Doktrin der massiven Vergeltung 76 e. Der Weg der Abrüstungsverhandlungen 81 f. DerWeg zu einer neuen politischen Friedensordnung in Europa 87 g. Zwischenüberlegung: Das moralische Dilemma der Entspannungspolitik 91 h. Die Anerkennung der Menschenrechte als Bedingung eines gerechten Friedens 93 i. Die unverhoffte Rückkehr der Gewalt 96 Zweiter Teil: Die Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg 1. Antike Ursprünge I: Krieg und Frieden in der politischen Ethik Ciceros 104 1.1. Der Friede als Ziel des Krieges 106 1.2. Die Kriege in der Anfangszeit des römischen Reiches 109 1.3. Legitimation des römischen Imperialismus? 114 2. Antike Ursprünge II: Krieg und Frieden bei Augustinus 118 2.1. Augustinus als Gründungsvater der Lehre vom gerechten Krieg? 118 2.2. Der polemische Kontext der Aussagen zu Krieg und Frieden 121 a. Die Unschuld der Christen am Untergang Roms 122 b. Die Einheit von Altem und Neuem Testament 124 c. Jahwe als oberster Kriegsherr 127 d. Kriege aus Ruhmsucht und Machtstreben 129 2.3. Der Krieg als Grundübel 131 2.4. Der Friede als höchstes Gut, der Krieg als Nicht-Sein-Sollendes 133 2.5. Das Anliegen der Kriegsbegrenzung und Gewaltminimierung 134 2.6. Mahnung zu Friedfertigkeit und Demut 137 2.7. Resümee: Der prekäre Zustand des irdischen Friedens 139 3. Die mittelalterliche Lösung: Systematisierung der Kriterien gerechter Kriegführung bei Thomas von Aquin 143 3.1. Der theologische Kontext der thomanischen Friedenslehre 143 3.2. Kriegführen als Notmaßnahme zur Abwehr des Unrechts und zur Bestrafung der Schuldigen 147 a. Die legitime Autorität des Fürsten 147 b. Der gerechte Grund: Materielles Unrecht und formelle Schuld der Verantwortlichen 152 c. Die Intention der Kriegführenden: Vermeidung von Rache und Bestrafung der Schuldigen 156 3.3. Der Gehorsam der Soldaten 158 3.4. Schrankenlose Gewalt im gerechten Krieg? 159 3.5. Die Grenzen der thomanischen Friedenslehre 162 4. Das frühneuzeitliche Paradigma: Auf der Suche nach einer neuen Weltfriedensordnung: Francisco de Vitoria 164 4.1. Die gewandelte Ausgangslage nach der Auflösung der Einheit des Reiches 165 4.2. Grundzüge der politischen Ethik 170 4.3. Die Verpflichtungskraft menschlicher Gesetze und die Denkfigur subjektiver Rechte 172 4.4. Der Mensch als soziales und politisches Wesen 175 4.5. Die Notwendigkeit politischer Herrschaft 176 4.6. Die Übertragung der Staatsgewalt auf den Herrscher 179 4.7. Gültige Rechtstitel der Spanier zum Krieg gegen die Indigenen? 182 a. Pflicht zur Glaubenszustimmung oder Freiheit des Glaubens? 183 b. Intervention zur Unterdrückung von Kannibalismus und Menschenopfer? 184 c. Freies Gastrecht der Spanier und Verteidigung der Missionsfreiheit? 189 4.8. Ein Seitenblick auf die politische Ethik von Francisco Suárez 193 a. Die vielen Staaten und die eine Menschheit 194 b. Das Volk als Träger der politischen Gewalt 196 c. Merkmale souveräner Staatlichkeit 198 4.9. Die Kriegslehre im engeren Sinn: Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Pazifismus 199 4.10. Das Erfordernis der rechtmäßigen Gewalt 202 a. Jurisdiktion im Inneren und Schutz der Rechtsordnung nach außen 202 b. Die Befragung weiser und erfahrener Ratgeber 204 4.11. Das Erfordernis eines gerechten Grundes zum Krieg 205 a. Die Forderung der Verhältnismäßigkeit der Strafe 206 b. Der Krieg als ultima ratio 208 c. Können beide Seiten über einen gerechten Grund verfügen? 209 d. Der Rückschluss auf die Schuld des Übeltäters 211 e. Die Prüfungspflicht der einfachen Soldaten 213 4.12. Die rechte Art der Kriegführung 215 a. Die tugendethische Betrachtungsweise des Krieges 216 b. Die Sorge um den künftigen Frieden 217 c. Das Verbot der Tötung Unschuldiger 218 d. Gewaltsame Herrschaftswechsel und Tyrannentötung 221 4.13. Kritische Würdigung: Stärke und Grenze einer moralischen Betrachtungsweise des Krieges 223 5. Die Verrechtlichung des Krieges in der klassischen Epoche des europäischen Völkerrechts 227 5.1. Balthasar de Ayala und Alberico Gentili 227 a. Kompetenzstreitigkeiten zwischen Theologen und Juristen 228 b. Der Krieg als Duell zwischen gleichberechtigten Feinden 230 c. Der Verzicht auf einen gerechten Kriegsgrund 232 d. Die Einhegung des förmlich erklärten Krieges 235 e. Die Ambivalenz der Entmoralisierung des Krieges: Der Wegfall naturrechtlicher Beschränkungen 236 5.2. Hugo Grotius 239 a. Die Unterscheidung des Völkerrechts vom Naturrecht 240 b. Der Ursprung des Völkerrechts in der geschichtlichen Erfahrung 242 c. Der Frieden als Ziel des Krieges 243 d. Der förmliche und öffentliche Krieg 245 e. Präventivkriege und Präemptivkriege 247 f. Restriktionen militärischer Gewalt im Krieg 251 5.3. Emer de Vattel 253 a. Die Gleichheit freier und souveräner Nationen und das Gebot der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten 255 b. Das Problem der Präventivkriege 257 c. Das Gleichgewicht unter den Nationen als Garant des Friedens 260 d. Das Recht der Völker im Krieg 262 5.4. Die Hoffnung auf eine Humanisierung des Krieges 265 6. Der Zusammenbruch der Lehre vom gerechten Krieg im 20. Jahrhundert 267 6.1. Erste Versuche zur Kodifizierung des humanitären Völkerrechts 269 a. Die Ziele der europäischen Friedensbewegung 270 b. Der Lieber’s Code der US-amerikanischen Streitkräfte 272 c. Die Haager Landkriegsordnung 273 d. Die Wirkungsgeschichte der Haager Landkriegsordnung 276 6.2. Die Nicht-Anwendbarkeit der Lehre vom gerechten Krieg auf die Kolonialkriege 277 a. Die Bekämpfung von Aufständischen und Partisanen 277 b. Die mangelnde Staatlichkeit „unzivilisierter“ Völker 280 c. Das Völkerrecht im Banne hegemonialer Ideologien 282 6.3. Die moralische und religiöse Legitimation des Vernichtungskriegs 284 a. Spiegelbildliche Argumentationsmuster in Deutschland und Frankreich 285 b. Die Religion im Dienst der Rechtfertigung des Krieges 287 c. Repräsentanten des kulturellen und politischen Katholizismus 290 d. Die Lehre vom gerechten Krieg in der zeitgenössischen Moraltheologie 292 e. Die Parallele zwischen Soldatentod und Martyrium 294 f. Liberale Intellektuelle und Hochschullehrer im Gleichklang mit der nationalen Erhebung 295 g. Ernüchterung durch die Konfrontation mit dem realen Kriegserleben 299 6.4. Wachsende Zweifel an der Möglichkeit eines gerechten Krieges 300 a. Der Wandel Bischof Faulhabers: Von der Kriegsverherrlichung zum Friedensappell 301 b. Die Vision einer künftigen Friedensordnung: Der Moraltheologe Joseph Mausbach 303 c. Zweifel an der Lehre vom gerechten Krieg bei ihren Anhängern 307 d. Wir sind keine Kriegsfanatiker: Erzbischof Conrad Gröber 308 6.5. Debatten innerhalb der katholischen Friedensbewegung 314 6.6. Der lange Weg zur völkerrechtlichen Ächtung des Krieges 320 a. Der Krieg als internationales Verbrechen: Der Briand-Kellogg Pakt 321 b. Verzicht auf das freie Kriegsführungsrecht der Staaten: Der Völkerbund 321 c. Gründe für das Scheitern des Völkerbundes 324 d. Das umfassende Gewaltverbot der UN-Charta 325 e. Unklare Konturen und uneingelöste Hoffnungen 328 7. Friedensethische Debatten in der Zeit des Kalten Krieges 332 7.1. Der Streit um die Legitimität der nuklearen Abschreckung 335 a. Die US-amerikanische just war theory 335 b. Die Auseinandersetzung in der deutschsprachigen katholischen Moraltheologie und in der protestantischen Ethik 340 aa. Innere und äußere Freiheit 345 bb. Direkte und indirekte Tötung Unschuldiger 346 cc. Kombattanten und Nicht-Kombattanten 348 dd. Die Frage der Kontrollierbarkeit von Atomwaffen 349 ee. Friedensethische Konsensformeln im Protestantismus: Komplementarität und vorläufige Rechtfertigung 351 7.2. Das ethische Dilemma einzelner Abschreckungsstrategien 355 a. Rational kalkulierende Akteure auf beiden Seiten? 357 b. Moralische Äquivalenz von Einsatz und Drohung? 360 c. Das Dilemma zielgenauer Nuklearwaffen mit begrenzter Zerstörungskraft 366 7.3. Sicherheitspolitik als Teil einer umfassenden Friedenspolitik 370 a. Sicherheit als gemeinsame Sicherheit 371 b. Das Raketenabwehrprogramm SDI und der NATO-Doppelbeschluss aus der Perspektive des Gegners 374 c. Wachsende Vorbehalte in den christlichen Kirchen 376 d. Verschiedene Interpretationen der noch möglichen moralischen Billigung der Abschreckung 379 e. Die pazifistische Bewegung des Global Zero 381 f. Neue Risiken für den Weltfrieden 386 Dritter Teil: Die Hoffnung auf Frieden in der Bibel 1. Die Entwicklung messianischer Friedenshoffnungen im Alten Testament 395 1.1. Gewaltverherrlichung in der Bibel? 395 1.2. Historische Rahmenkonstellationen und theologische Deutungen 399 1.3. Jahwes Kriege als wunderbares Eingreifen zugunsten Israels 401 1.4. Vorkehrungen zur Gewalteindämmung in Israels Kriegen 405 1.5. Wachsende Distanz gegenüber Krieg und Gewalt bei den Propheten Israels 407 1.6. Frieden als politischer Frieden und als umfassender Heilszustand 410 1.7. Die Gerichtsdrohung der vorexilischen Prophetie 412 1.8. Die Geburtsstunde messianischer Friedenshoffnungen 414 1.9. Die Entdeckung der Einzigartigkeit Jahwes und die Universalisierung der Friedenshoffnung Israels 419 1.10. Die gewaltkritische Sicht der priesterschriftlichen Schöpfungserzählung 421 1.11. Die Universalisierung der Heilserwartung als Folge des Monotheismus 424 1.12. Der Perserkönig Kyros als Werkzeug in der Hand Jahwes 427 1.13. Schwerter zu Pflugscharen, Lanzen zu Winzermessern? 430 1.14. Die Lieder vom Gottesknecht als radikaler Gegenentwurf zu aller Gewalt 432 1.15. Die Verheißung eines messianischen Friedenskönigs 437 1.16. Kuss oder Kampf? Das Miteinander von Frieden und Gerechtigkeit 441 1.17. Rückblick auf die Friedensbotschaft des Alten Testaments 443 2. Die Friedensbotschaft des Neuen Testaments 447 2.1. Die Verkündigung des Reiches Gottes als Evangelium des Friedens 448 2.2. Jesus als messianischer Friedenskönig: das Lukas-Evangelium 453 a. Die Geburt Jesu als Friedensereignis 456 b. Der Einzug des Friedenskönigs in seine Stadt 459 2.3. Wege zum Frieden in der Verkündigung Jesu 461 a. Das Beispiel des Lebens Jesu 462 b. Die Mahnung zur Gewaltlosigkeit in den Seligpreisungen der Bergpredigt 463 c. Die Mahnung zur Gewaltlosigkeit in den Antithesen der Bergpredigt 466 d. Die Aufforderung zur Feindesliebe in den Seligpreisungen der Bergpredigt 470 e. Die Aufforderung zur Feindesliebe in den Antithesen der Bergpredigt 471 aa. Der Vergleich mit biblischen und religionsgeschichtlichen Parallelen 472 bb. Die Reichweite der Feindesliebe: die Tendenz zur Entnationalisierung 473 cc. Die Grundlage der Feindesliebe: das gemeinsame Menschsein 476 dd. Das Ziel der Feindesliebe: die Verwandlung des Feindes 478 2.4. Der Friede als Gabe Gottes: Paulus und Johannes 482 a. Der Friede als Versöhnung mit Gott 482 b. Der Friede als Versöhnung der Menschen untereinander 487 c. Der Friede als Lebensraum aller Menschen 489 d. Der kosmische Friede 491 e. Der Friede Christi und der Friede der Welt 492 f. Entweltlichung des Friedensverständnisses? 494 Vierter Teil: Systematische Entfaltung der Friedensethik 1. Dimensionen des Friedens 501 1.1. Der himmlische und der irdische Friede 501 1.2. Der positive und der negative Friede 503 1.3. Der innergesellschaftliche und der zwischenstaatliche Friede 509 1.4. Phasen des Friedensaufbaus: Vom peace making zum peace building 512 1.5. Das Ziel des gerechten Friedens als Leitvorstellung der Friedensethik 514 2. Der anthropologische Konflikt: Menschsein zwischen Gewaltbereitschaft und Friedensfähigkeit 517 2.1. Wege zur dauerhaften Überwindung des Krieges: der Pazifismus 518 a. Spielarten des Pazifismus 518 b. Historische Rückblenden auf Friedensentwürfe der Neuzeit 520 c. Pazifistische Friedenstheorien der Gegenwart 522 2.2. Der Krieg als Weg zur Eindämmung des Bösen: der Bellizismus 524 a. Das philosophische Erklärungsmodell 524 b. Das staatsrechtliche Erklärungsmodell 527 c. Das psychoanalytische Erklärungsmodell 529 d. Das ethnographische Erklärungsmodell 533 2.3. Die anthropologische Basis der Theorie des gerechten Friedens 537 a. Die Einheit der Menschen und das natürliche Wohlwollen unter ihnen 537 b. Neuere humanwissenschaftliche Erkenntnisse über die Kooperationsfähigkeit des Menschen 540 c. Die ungesellige Geselligkeit des Menschen und Kants Lehre vom radikal Bösen 542 d. Der anthropologische Gehalt der christlichen Erbsündenlehre 544 2.4. Die Tugenden der aktiven Friedensbereitschaft 549 a. Der soziale Sinn und die politische Bedeutung von Tugenden 550 b. Die komplementäre Funktion von Tugenden und Regeln 551 c. Friedfertigkeit durch Affektkontrolle? 553 d. Friedfertigkeit als Ausdruck von Achtung und Wohlwollen 554 e. Tugenden als Gegenstrategien der Liebe gegen den Hass 556 aa. Toleranz 558 bb. Gewaltfreiheit und Gewaltlosigkeit 561 cc. Dialog- und Kompromissfähigkeit 564 dd. Tapferkeit, Mut, Zivilcourage und Opferbereitschaft 566 ee. Entschlossenheit und Geduld 570 ff. Versöhnungbereitschaft 573 3. Die Säulen eines gerechten Friedens 578 3.1. Die Entstehung eines neuen Paradigmas kirchlicher Friedensethik 578 3.2. Das Konzept des gerechten Friedens und die Theorie der internationalen Politik 582 3.3 Die formale Bestimmung des gerechten Friedens als Basis politischer Versöhnung 584 3.4. Die materialen Kriterien des gerechten Friedens als Grundlage dauerhaften Friedens 587 3.5. Die erste Säule des gerechten Friedens: Weltweiter Schutz der Menschenrechte, Entwicklungsförderung und Armutsbekämpfung 591 a. Menschenrechte als universale Rechtsprinzipien der internationalen Staatengemeinschaft 594 b. Die Menschenrechte als oberster Konstruktionspunkt kirchlicher Friedensethik 596 c. Der innere Konnex von Menschenrechtsschutz und Weltfrieden 598 d. Die Parallele zwischen der inneren und äußeren Friedensfähigkeit von Staaten 601 e. Das Konzept der menschlichen Grundsicherheit (Human Security) 604 f. Das Leitbild der Schutzverantwortung (Responsibility to protect) 605 3.6. Die zweite Säule eines gerechten Friedens: Demokratieförderung und Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen 612 a. Die Theorie des democratic peace 614 b. Historische Gegenbeispiele 618 c. Das politikwissenschaftliche Erklärungsmodell 619 d. Emerging right to democracy? 621 e. Ist die Demokratie die einzige achtbare Regierungsform? 624 3.7. Die dritte Säule eines gerechten Friedens: Friedenssicherung durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, Industrialisierung und freien Welthandel 626 a. Die pazifistische Ausrichtung des Kapitalismus 630 b. Die Forderung nach einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung 632 c. Die OECD-Welt als Teil des Problems, nicht der Lösung 636 3.8. Die vierte Säule eines gerechten Friedens: Friedenssicherung durch den Ausbau supranationaler Verflechtung 639 a. Internationale Organisationen und Regime 640 b. Der Beitrag von NGOs, kirchlichen Hilfswerken und zivilgesellschaftlichen Akteuren 642 c. Die Selbstblockade der UNO und ihre Folgen 645 d. Die Zielvorstellung: Weltstaat oder föderative Weltrepublik? 649 e. Der Schlussstein einer gerechten internationalen Friedensordnung: ein obligatorischer Gerichtshof 652 aa. Die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit in den europäischen Friedensentwürfen 653 bb. Die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit als zentrale Forderung kirchlicher Friedensethik 654 cc. Die völkerrechtliche Begründung einer obligatorischen internationalen Gerichtsbarkeit 657 dd. Die Entwicklung eines Weltstrafrechts mit einem Weltstrafgerichtshof 659 ee. Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im gegenwärtigen Völkerrecht 660 ff. Die erfolgreiche Tätigkeit der Ad-hoc-Strafgerichtshöfe der UNO 663 4. Neue Herausforderungen der Friedensethik 666 4.1. Das Paradigma des gerechten Friedens und der Lehre vom gerechten Krieg 667 4.2. Die sogenannte humanitäre Intervention 673 a. Zur Benennung (und zur Vorgeschichte) „humanitärer“ Interventionen 673 b. Die ethische Beurteilung von militärischen Interventionen zu humanitären Zwecken 677 aa. Der gerechte Grund 679 bb. Die legitime Autorität 685 cc. Die rechte Absicht 688 dd. Weitere Kriterien: Ultima ratio, Verhältnismäßigkeit und Erfolgsaussicht 692 4.3. Krieg gegen den Terrorismus 696 4.4. Gezielte Tötungen 703 a. Definition und Verbreitung des targeted killing 703 b. Die moralische und rechtliche Problematik gezielter Tötungen 705 aa. Moral der schmutzigen Hände? 706 bb. Die Revisionist Just War Theory 709 cc. Fazit: Gezielte Tötungen als moralischer und rechtlicher Tabubruch 717 4.5. Der Einsatz autonomer Waffensysteme („Kampfdrohnen“) 718 a. Das ethische Problem: Das Verschwinden menschlicher Verantwortungsträger 720 b. Das völkerrechtliche Problem: Der fehlende Wille der Staatengemeinschaft zu einem Verbot 725 4.6. Virtuelle Kriege im Cyber Space? 727 4.7. Gefahren für den Weltfrieden durch die Weiterverbreitung von Atomwaffen und die Krise der nuklearen Abrüstung 731 a. Das Scheitern der Non-Proliferation von Atomwaffen 732 b. Global Zero – ein unerreichbarer Traum? 737 Personenregister 742 Sachregister 747 |
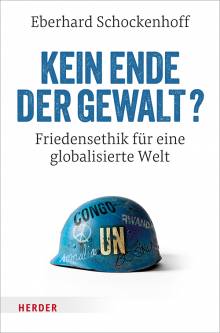
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen