|
|
|
Umschlagtext
Mit dem auf vier Bände angelegten Werk wird erstmalig eine Ikonologie der christlichen Kunst im historischen Ablauf geschildert.
Die komplexe Geschichte des Bildes in der Kirche wird ausgehend von der Intention der Darstellungen auf den verschiedenen Bildträgern aufgezeigt und die Weise der damit verbundenen Argumentation fundiert dargelegt. Eingebettet in allgemeine historische Entwicklungen wird der Wandel der Themenkreise beschrieben. Im zweiten Teil stehen mit Blick auf die Neubegründung staatlicher Macht im Westen sowie die Scholastik zunächst Werke der Buchmalerei, der Kirchendekoration und der Ausstattung im Zentrum. Ein häufiges Phänomen ist hier die Argumentationsweise der Typologie. Mit der Gotik setzt sich ein neuer Naturalismus durch, der gesehene Wirklichkeit im Bild wiedergeben will und auch alte Themen verändert. Der Bildschmuck der Kathedralportale wird ebenso wie die zunehmende Komplexität der Altarretabel beleuchtet. Teils auf östlichen Einflüssen basierend, gewinnt im Spätmittelalter die Tafelmalerei, ebenso wie die neuen Medien der Druckgraphik (Holzschnitt und Kupferstich), in der Privatandacht wie im Wallfahrtswesen an Bedeutung. Rezension
Tassilokelch (777, Stift Kremsmünster), Kirchdekoration (817-824, Rom, S. Prassede), Egbertschrein (Ende 10. Jh., Trier, Domschatz), Bernwardskreuz (um 1010, Hildesheim, Domschatz), Taufbecken (1129, Freckenhorst, Stiftskirche St. Bonifatius), Antependium (vor 1140, Großcomburg Stiftskirche St. Nikolaus), Barbarossakopf (um 1160, Kappenberg, Stiftskirche St. Johannes Evangelist), Verduner Altar (Klosterneuburg, 1181), Georgenchor (um 1220/30, Bamberg, Dom St. Peter und St. Georg), Südportale (Anfang 13. Jh., Chartres, Notre-Dame), Karlsschrein (frühes 13. Jh., Aachen, Münsterschatz), Madonna des Kanzlers Rolin von Jan van Eyck (um 1436, Paris, Louvre), Anna selbdritt (um 1300, Stralsund, Nikolaikirche), Leuchtermadonna (Anfang und spätes 14. Jh., Doberan, Münster), Palmesel (um 1505, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum), Torgauer Altar von Lucas Cranach des Älteren (1509, Frankfurt am Main, Städel), Jüngstes Gericht von Michelangelo (1541, Rom, Sixtinische Kapelle). Was verbindet diese christlichen Kunstwerke miteinander? Sie sind besondere Objekte der mittelalterlichen Bildkunst. Die symbolischen Formen von Kunstwerken sind Gegenstand einer bestimmten Forschungsrichtung der Kunstgeschichte, der so genannten „Ikonologie“.
Ein umfassende, fachlich fundierte, mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Abbildungen und Lesebändchen versehene Darstellung der komplexen Geschichte des Bildes in der christlichen Kirche von ihren Anfängen bis zur Gegenwart liefert das auf vier Bände angelegte Werk „Ikonologie der christlichen Kunst“ von Hans Georg Thümmel (*1932). Das Opus magnum des Kirchenhistorikers, der von 1990 bis 1997 als Professor für Kirchengeschichte, christliche Archäologie und Geschichte der Kirchlichen Kunst an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald lehrte, erscheint im Verlag Ferdinand Schöningh, einem Imprint der Brill-Gruppe. Es liegen bereits vor der Band 1 „Alte Kirche“(2019) und Band 2 „Bildkunst des Mittelalters“(2020). Geplant sind noch Band 3 zur „Bildkunst der Neuzeit“, der im Herbst dieses Jahres erscheinen soll, sowie Band 4 zu den Entwicklungen in der Ostkirche. Im zweiten Band seines Handbuchs zeigt Thümmel gekonnt die kunstgeschichtlichen Entwicklungslinien des Bildes im Mittelalter anhand souverän ausgewählter Artefakte unter Berücksichtigung des historischen Kontextes auf. Darstellungen auf unterschiedlichen Bildträgern wie Kathedralportalen, Tafeln, Druckgraphiken oder in Werken der Buchmalerei geben Auskunft über das Gottesbild, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, über das Verhältnis von weltlicher und geistlicher Macht, über das heilsgeschichtliche Weltbild, über Formen der Liturgie und über moralische Normen. Durch Thümmels Werk erhält man einen guten Zugang u.a. zu den Bildprogrammen der Fünten, der Altarretabel oder der Tympana. Lehrkräfte der Fächer Religion und Bildende Kunst werden durch die sehr gute Darstellung des Kirchenhistorikers eingeladen, der christlichen Ikonologie im Unterricht mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Fazit: Hans Georg Thümmels hervorragender Band zur „Bildkunst des Mittelalters“ leistet einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Gedächtnis Europas. Seine Lektüre kann allen an der Kunst- und Ideengeschichte des Christentums Interessierten nur zur Lektüre empfohlen werden, betrachtet man danach doch die Bilder in der christliche Kirche mit anderen Augen. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Mit dem auf vier Bände angelegten Werk wird erstmalig eine Ikonologie der christlichen Kunst im historischen Ablauf geschildert. Die komplexe Geschichte des Bildes in der Kirche wird ausgehend von der Intention der Darstellungen auf den verschiedenen Bildträgern aufgezeigt und die Weise der damit verbundenen Argumentation fundiert dargelegt. Eingebettet in allgemeine historische Entwicklungen wird der Wandel der Themenkreise beschrieben. Im zweiten Teil stehen mit Blick auf die Neubegründung staatlicher Macht im Westen sowie die Scholastik zunächst Werke der Buchmalerei, der Kirchendekoration und der Ausstattung im Zentrum. Ein häufiges Phänomen ist hier die Argumentationsweise der Typologie. Mit der Gotik setzt sich ein neuer Naturalismus durch, der gesehene Wirklichkeit im Bild wiedergeben will und auch alte Themen verändert. Der Bildschmuck der Kathedralportale wird ebenso wie die zunehmende Komplexität der Altarretabel beleuchtet. Teils auf östlichen Einflüssen basierend, gewinnt im Spätmittelalter die Tafelmalerei, ebenso wie die neuen Medien der Druckgraphik (Holzschnitt und Kupferstich), in der Privatandacht wie im Wallfahrtswesen an Bedeutung. Inhaltsverzeichnis
Vorwort XI
Allgemeine Literatur und Abkürzungen XIII Definition und Grenzen XV I Das Frühmittelalter Geschichte 3 Karl der Große. Die Kapelle 3 Ottonen und Salier 11 Die Zeit der Staufer 12 Die Scholastik I 15 Allgemeines 15 Die Entwicklung 16 Das mittelalterliche Weltbild 19 Das Geschichtsbild 20 Kunstgeschichtliches 23 Der Kirchenbau 23 Stilentwicklung 25 Die Bilderfrage im Mittelalter 27 Die Franken und die Bilder 28 Rom und Byzanz 29 Die Franken und Nikaia II 30 Positionen in der Bilderfrage 31 Frühe Werke der Bildkunst. 35 Kunstwerke im Liber Pontificalis 35 Einzelne Werke 35 Bilder an Chorschranken 38 Schatzkunst 39 Buchmalerei 41 Der Bucheinband 49 Karolingische, ottonische und romanische Kirchdekoration 63 Allgemeines 63 Die karolingische Zeit 65 Rom 65 Das Frankenreich 70 Ottonische und romanische Zeit 72 Rom und Italien 72 Frankreich 80 Spanien 80 Deutschland 80 Skulpturen 82 Resume 85 Die Gestaltung des Altars. Das Antependium 99 Reliquiare, Tragaltäre, Bilder 111 Allgemeines 111 „Redende" Reliquiare 111 Tragaltäre 113 Reliquiar und Skulptur 114 Kreuzreliquiare 120 Gott und die Welt 129 Typologische Argumentation 139 Implizite Typologie 143 Zwischenstufe 144 Die explizite Typologie. Die typologische Reihe 146 Der Klosterneuburger Ambo "Verduner Altar") 146 Erbauungsliteratur 149 Die Quantitätenreihe 151 Gerät 159 Altargerät 159 Weiteres Inventar 163 Kleinkreuze 163 Leuchter 166 Reliquienschreine 167 Fünten 169 Ambone, Kanzeln, Lesepulte und anderes 170 Das Bildnis als Grabmal 189 Frühe Kruzifixe und Madonnen 191 Der Kruzifixus 192 Drei- und Viemagelung 195 Croci dipinte 196 Madonnen 197 Marienkrönung 199 Chorschranke und Lettner. Das Triumphkreuz 199 II Die Gotik Allgemeines 223 Geschichte 223 Geistesgeschichte. Mystik 229 Die Scholastik II 232 Gotische Sinnlichkeit 237 Christliches Leben. 238 Architektur 243 Bildtheorie 246 Die Bildkunst. Der neue Naturalismus 248 Leben und Bilder 259 Die Ikonologie der Kathedrale (der gotischen Grosskirche) 277 Kirchdekoration in gotischer Zeit 281 Rom und Italien 281 Weiteres 284 Bettelorden 284 Plastik im Architekturverband. Portalprogramme 291 Prinzipien und Tendenzen 291 Frankreich 292 Das Ostreich 295 Einzelwerke 298 Die neuen Themen 309 Die Entwicklung 309 Narratives 310 Biblische Szenen 311 Heilige Familie und Heilige Sippe 312 Der Kreuzweg 314 Weiteres 314 Christus 318 Der Kruzifixus 318 Der Schmerzensmann (imago pietatis, misericordia domini) 320 Weiteres 322 Die Madonna 327 Engel 342 Die Zwölf Apostel 342 Mystikererlebnisse 343 Die Christus-Johannes-Gruppe 344 Herz]esu 345 Namenjesu 345 Verbildlichte Theologie 345 Die Sakramente als Aktualisierung und Visualisierung des Heils 349 Anweisungen und Gebote 350 Der Rosenkranz 351 Ars moriendi. 365 Der Totentanz 365 Weiteres 365 Propheten und Sibyllen 366 Liturgie und geistliches Schauspiel. Das Heilige Grab 366 Die Anlage inJerusalem und ihre Kopien 367 Die Liturgie 368 Die Gruppe der Frauen am Grabe 370 Gernrode 371 Der Grabchristus 372 Heilig-Grab-Gruppen mit Grabchristus 372 Das Andachtsbild der Grablegung 374 Die Kopie in der Landschaft 374 Heilige des späteren Mittelalters und ihre Patronate 383 Allgemeines 384 Patrone von Personen und Gruppen 387 Heilige mit allgemeinem Wirkungsbereich 390 Spezielle Patronate. Krankheit 393 Zusammenfassung 397 Ost und West. Die italobyzantinische Ikone und die „Maniera greca" 407 Die neue Malerei. Italien und Böhmen 415 Das Altarretabel 423 Definitionen und Allgemeines 423 Vorformen und Zwischenformen des Retabels 427 Das Madonnenbild in Italien 429 Frühe Tafelretabeln 431 Der Reliquienschrein 437 Der Übergang zum wandelbaren Bildretabel 447 Das Bildretabel bis ca. 1450 460 Die Entwicklung nach 1450 466 Tendenzen des 16. Jahrhunderts 469 Altarretabeln als übergreifendes Bildprogramm 472 Sonderform: Das Diptychon 473 Die Wandlungen des Retabels (Meßnerpflichtbücher) 473 Stiftungen und Altäre von Gruppen 479 Einzelstücke 482 Der Genter Altar 482 Dominikaner-Altar im Städel 485 Hieronymus Bosch 485 Zusammenfassung: Die Themen 486 Fastentücher 501 Sakramentshäuser 503 Fensterprogramme (Glasmalerei) 505 Das Epitaph I 511 Druckgraphik 513 Allgemeines 513 Themen 516 Das Einzelblatt 516 Die Folge 520 Der Holzschnitt als Vorlage 520 Buch und Bild 521 Wallfahrtswesen und Pilgerkunst 525 Die Entstehung und Frühgeschichte des Porträts 529 Mehrdeutigkeit 545 Renaissance und Endzeit 547 Abbildungsnachweis 549 Register 561 |
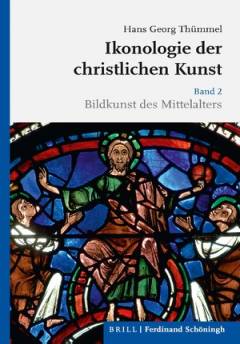
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen