|
|
|
Umschlagtext
Das "Handbuch der Semiotik" informiert über die Geschichte, die zeichen- und kommunikationbstheoretischen Grundlagen, die verschiedenen Strömungen und Tendenzen sowie über die Forschungsfelder der Wissenschaft von den Zeichenprozessen in Natur und Kultur. Es umfaßt Themen wie Bio- und Zoosemiotik, nonverbale Kommunikation, Semiotik von Sprache, Literatur, Malerei und Musik sowie Kultur- und Mediensemiotik. Gegenüber der ersten Auflage von 1985 wurde diese zweite Auflage völlig neu konzipiert, aktualisiert und auf mehr als das Doppelte erweitert.
Rezension
Die Lehre von den Zeichen wird immer wichtiger; sie durchzieht zunehmend die verschiedenen kulturellen Bereiche wie Sprache, Medien und Ästhetik. Ein wirkliches Handbuch zur Semiotik, das auch dem Laien grundlegende Kenntnisse vermittelt, ohne vorschnell einer Schulrichtung sich zuzuordnen. - Pädagogen/innen haben es vielfältig mit Semiosen zu tun, nicht nur in Text und Sprache, auch non-verbal, medial und kulturell. Insofern kann die Semiotik helfen, den Alltag zu verstehen und zu bewältigen.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Das "Handbuch der Semiotik" informiert über die Grundbegriffe der Semiotik und über die verschiedenen Theorieansätze. Ihre Anwendungsfelder sind Sprache, Medien und Film, aber z.B. auch nichtsprachliche Kommunikation; neuere Forschungen beschäftigen sich etwa mit Kultur- und Alltagssemiotik. Gegenüber der ersten Auflage von 1985 wurde das "Handbuch der Semiotik" völlig überarbeitet und erheblich erweitert. Autoreninformation: Winfried Nöth, geb. 1944; Studium in Münster, Genf, Lissabon und Bochum; seit 1978 Professor für Anglistik, Linguistik und Semiotik an der Universität-GHS Kassel; seit 1994 ständiger Gastprofessor für Allgemeine Semiotik an der PUC Universität Sao Paulo; Bei J.B. Metzler ist erschienen: "Dynamik semiotischer Systeme". 1977. Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Inhaltsverzeichnis VII Einleitung XXXIX I. Geschichte der Semiotik 1 1. Geschichte der Semiotik als Begriff und als Wissenschaft 1 2. Antike 4 3. Mittelalter und Renaissance 9 4. Rationalismus und Empirismus 15 5. Aufklärung 22 6. Semiotik im 19. Jahrhundert 30 7. Semiotik im 20. Jh.: Tendenzen neben den Klassikern. 36 8. Strukturalismus, Poststrukturalismus und die Semiotik 45 9. Historiographie der Semiotik 56 II. Klassiker, Richtungen und Schulen der Semiotik im 20. Jahrhundert 59 1. Charles Sanders Peirce. 59 2. Ferdinand de Saussure 71 3. Louis Hjelmslev. 78 4. Charles W. Morris 88 5. Vom Russischen Formalismus zur Schule von Moskau und Tartu. 95 6. Prager Schule. 100 7. Roman Jakobson. 103 8. Roland Barthes 107 9. Greimas und das Projekt der narrativen Diskursgrammatik der Pariser Schule 112 10. Julia Kristeva. 120 11. Umberto Eco. 125 III. Zeichen und System 131 1. Zeichen: Zeichenträger, das Zeichenhafte und die nichtzeichenhafte Welt 131 2. Zeichenmodelle, Zeichenkonstituenten und Zeichenrelationen 136 3. Zeichen und Typologie der Zeichen 142 4. Realismus, Nominalismus und die Zeichen 145 5. Semantische Grundbegriffe 147 6. Bedeutung 152 7. Semantik und Semiotik 158 8. Repräsentation 162 9. Information. 169 10.Symbol 178 11. Index, Anzeichen, Symptom, Signal und natürliches Zeichen 185 12. Ikon und Ikonizität 193 13. Funktion 199 14.Struktur 204 15.System 208 16. Kode 216 IV. Semiose und ihre Dimension 227 1.Semiose 227 2. Kognition 230 3. Kommunikation 235 4. Physikosemiotik: Semiose in der materiellen Welt 248 5. Ökosemiotik 250 6. Biosemiotik 254 7. Zoosemiotik 260 8. Evolution der Semiose 273 9. Raum. 282 10. Zeit 287 V. Nonverbale Kommunikation 293 1. Nonverbale Kommunikation und Körpersprache 293 2. Gestik 298 3. Kinesik 305 4. Mimik und Gesichtsausdruck 308 5. Blickkommunikation 311 6. Taktile Kommunikation 313 7. Proxemik und Territorialverhalten 316 8. Chronemik 320 VI. Sprache und Sprachkodes 323 1. Sprache, Linguistik und Semiotik. 323 2. Semiotische Linguistik: Ansätze und Themen 327 3. Arbitrarität und Konvention 336 4. Metapher. 342 5. Schrift 349 6. Parasprache 365 7. Universalsprache 369 8. Gebärdensprache 379 9. Sprachsubstitute 386 VII. Textsemiotik 391 1. Textsemiotik 391 2. Rhetorik und Stilistik. 394 3. Erzählung 400 4 Mythos 410 5. Ideologie 413 6. Hermeneutik, Exegese und Interpretation 418 7. Theologie. 422 VIII. Ästhetik und Literatursemiotik 425 1. Ästhetik 425 2.Musik 433 3. Malerei 439 4. Architektur 444 5. Das Poetische und die Poezität. 449 6. Literatur 456 7. Theater 462 IX. Mediensemiotik. 467 1.Medien 467 2. Bild 471 3. Bild und Text 481 4. Landkarten 487 5. Comics 491 6. Photographie. 496 7.Film. 500 8. Werbung 508 X Kultursemiotik, Soziosemiotik und interdisziplinäre Erweiterungen 513 1. Kultur 513 2. Magie 515 3. Alltagsleben. 518 4. Gegenstände und Artefakte 526 5. Waren und Geld 529 6. Didaktik und Semiotik 533 7. Stichwörter zu weiteren interdisziplinären Bezügen der Semiotik 537 Bibliographie. 539 Personenregister 631 Sachregister. 653 Aus dem Vorwort: Pluralistische Zielsetzung Die Zielsetzung dieses Handbuchs ist eine pluralistische. Die hier versuchte Darstellung der Semiotik beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Richtung oder gar Schule der Semiotik wie man sie etwa bei Morris (1946: 359-368), Bense & Walther (1973) oder Greimas & Courtes (1979,1986) finden kann, die lexikalische Handreichungen zu ihren eigenen semiotischen Schriften verfaßt haben. Andererseits will dieses Handbuch aber auch nicht so pluralistisch sein, wie es jene enzyklopädischen Werke zur Semiotik notwendigerweise sind, an denen hunderte von Autoren zur gleichen Zeit gearbeitet haben. Die Möglichkeit, das Gesamtgebiet der Semiotik in einer aktuellen Synthese darzustellen, Differenzen herauszuarbeiten und Gemeinsamkeiten zwischen manchmal nur scheinbar divergierenden Tendenzen aufzuzeigen, ohne die verbleibenden Differenzen zu übersehen, sollte genutzt werden. Bei allen pluralistischen Vorsätzen konnte dieses Ziel nicht nach bloß deskriptiven Prinzipien verfolgt werden. In jedem Kapitel und jedem Abschnitt waren Auswahlentscheidungen zu treffen, und Auswahl bedeutet immer auch eine Bewertung des Ausgewählten. Wertmaßstab sollte allerdings nicht die bloße persönliche Präferenz des semiotischen Berichterstatters sein. Seine Leitlinie war vielmehr das Ziel, ein umfassendes Bild einer Wissenschaft zu skizzieren, die im weitesten Peirceschen Sinn alle Zeichenprozesse in Natur und Kultur untersucht. Ein solches Panorama der Semiotik darf nicht nur die explizite Semiotik berücksichtigen, jene Wissenschaft also, die sich selbst als eine Semiotik (oder auch als Semiologie) begreift, sondern es muß auch die implizite Semiotik mit einbeziehen, all jene Forschungen also, die mit Zeichenprozessen befaßt sind, ohne sich selbst explizit als >semiotisch< zu verstehen. Die Grenze zwischen dem implizit Semiotischen und dem nicht mehr Semiotischen ist allerdings besonders schwierig zu bestimmen, und daß bei so weit gesteckten Zielen auch angesichts der schnellen Weiterentwicklung der Semiotik selbst Lücken verblieben oder vielleicht auch Ungleichgewichte in der Darstellung der verschiedenen Tendenzen der impliziten und expliziten Semiotik aufgetreten sein könnten, mögen die Leserinnen und Leser dem Autor und dem Wunsch des Verlegers nachsehen, die Veröffentlichung dieses Handbuchs nicht länger aufzuschieben. Leseprobe VII.4 Mythos Mythen gibt es in allen Kulturen der Welt. Trotz eines fiktionalen und somit >unwahren< Inhalts thematisiert der Mythos eine tiefere Wahrheit der menschlichen Existenz. Die moderne Theorie des Mythos beginnt 1725 mit Vicos Nuova Scienza (s. 1.5.3). In der Mitte des 20. Jh.s wurde Levi-Strauss' strukturale Mythentheorie zum Paradigma für die Textsemiotik. Barthes entdeckte die Struktur des Mythos auch in der Alltagskultur. 1. Allgemeine Definition von Mythos Mythos (…), heißt bei den Griechen sowohl >Wort< und >Sprache< als auch >Erzählung der Götter<. Mit Wheelwright (1974: 538) kann Mythos heute als eine Geschichte definiert werden, »von der man annimmt, daß sie bestimmte elementare Aspekte der menschlichen und übermenschlichen Existenz zum Ausdruck bringt und somit implizit symbolisiert.« 1.1 Mythos als metaphorische Erzählung Als eine Erzählung, die einerseits einen fiktionalen Gehalt und somit keinen Wahrheitsgehalt hat, andererseits aber eine tieferliegende Wahrheit der menschlichen Existenz thematisiert, ist der Mythos mit der Metapher (s. VI.4) verwandt, denn der mythische Text muß wie die Metapher auf zwei Ebenen interpretiert werden (Jolles 1930; Greimas & Cour-tes 1979). Beispiele für Themen der Mythologie sind der Ursprung und das Ende der Menschheit und des Kosmos (Nöth 1932), die Entstehung der natürlichen Elemente (Erde, Feuer und Wasser sowie die Frage nach Zeit und Ewigkeit, Leben und Tod, Vergänglichkeit und Wiedergeburt. Die transzendentale Natur dieser Themen zeigt, daß Mythologie nicht nur ein Thema der Literatur, sondern mindestens ebenso eines der Religion und Theologie ist. 1.2 Mythos, Wissenschaft und Wahrheit Das, was die Mythen über die Natur der Welt, des Lebens und des Kosmos aussagen, steht oft in Widerspruch zu den Erkenntnissen der Wissenschaft und des rationalen Denkens. Die Griechen sehen deshalb auch einen Gegensatz zwischen Mythos als dem bloß fiktiven und Logos als dem rationalen Diskurs (Nestle 1942). Das Zeitalter des Rationalismus und der Aufklärung sah einen ähnlichen Gegensatz zwischen dem Mythos und der Realität überhaupt. Mythisch wurde zu einem Synonym von falsch. Während der Mythos nach dem mythischen Weltbild als >absolute Wahrheit< und >heilige Geschichte gegolten hatte, wurde er nun zum Gegensatz von Wissenschaft und Realität (Eliade 195?: 23-24). Die moderne Religions- und Kulturwissenschaft (z.B. Eliade), die Psychoanalyse (Freud, CG. Jung), die Philosophie der symbolischen Formen (E. Cassirer, S. Eanger), die Eiteraturkritik (N. Fryet und schließlich die strukturale Anthropologie (Levi-Strauss) haben jedoch viel zur Rehabilitation des Mythos beigetragen, der heute als konstante Dimension des menschlichen Geistes begriffen wird (vgl. Hübner 1985). 1.3 Zum Stand der Forschung Die Theorie des Mythos allgemein erörtern unier philosophisch-kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten Murray (ed. 1960), Kirk (1970), Dupre (1973), Bolle (1974), Burkert & Horstmsr.-(1984), Hübner (1985), Jamme (1991) und Briss (1994). Zur strukturellen und semiotischen Myther -analyse siehe Sebeok (ed. 1955), Leach (19tl, 1970), Eeach (ed. 1967), Maranda (ed. 19^ Calame (1982), Hendricks (1982), Liszka (198%| Koch (1991a) und Kim (1996). 2. Levi-Strauss' strukturale Analyse des Mythos Levi-Strauss hat in seiner strukturalen Mythena lyse ein Analyseverfahren entwickelt, das zum Pa digma für die Textsemiotik wurde (Greimas 197 117-34; Köngäs-Maranda & Maranda 1971; < ler 1975; Hawkes 1977). 2.1 Mythos als Zeichensystem Levi-Strauss (1958: 226-264) betrachtet Mythen a Botschaften, die das Produkt eines Kodes sind,« sen Strukturen denen der Sprache ähneln. Die M thoden des linguistischen Strukturalismus, wie ! mentierung, Klassifizierung und die Bestimm! von binären Oppositionen, sind deshalb auch Methoden der strukturalen Mythenforschung, seiner Untersuchung des Ödipusmythos begr: Levi-Strauss deshalb z.B. damit, den Text in elerr.-r tare propositionale Einheiten (Subjekt + Prädi* zu zerlegen, die den Inhalt des Textes zusamir.?' fassend wiedergeben. Alle semantisch verwanc:: Propositionen und deren Varianten klassifiz.: .-. Levi-Strauss als elementare Einheiten des Myi und definiert sie als die »großen konstitutiven heiten des Mythos« oder Mytheme (ebd.: 231-31 Eine Parallele zwischen diesem textstruktura. Verfahren und der Phonologie sieht Levi-Sio (ebd.) insofern, als Phoneme ebenso wie die Myi^i me sich aus all ihren Varianten konstituieren. In einem zweidimensionalen Notationsverfifc-l ren, welches Levi-Strauss mit einer Orchesterpartitur vergleicht (ebd.: 233), werden die Mytheme nun entsprechend ihrer syntagmatischen und paradig-- irischen Relationen registriert. Die horizontal dargestellte syntagmatische Achse des Mythos entspricht der narrativen Sequenz der mythischen Ereignisse. Die vertikal dargestellte paradigmatische Dimension registriert die Gleichheit der Mytheme, die in Sprache untereinander notiert sind. Ein Mythos, der z.B. die vier Mytheme 1,2,3,4 enthält, die im Text in der Abfolge 1,3,2,4,2,4, 3.4,1,2,1 vorkommen, wird dann durch die folgende Matrix in vier Spalten dargestellt: 1 3 2 4 2 4 3 4 1 2 1 Die Darstellung veranschaulicht die semantische Reduktion des Texts von einer Sequenz von elf Propositionen zu einer Sequenz von vier rekurrenten Mythemen, dargestellt in vier Spalten. Mit diesem Verfahren der Textreduktion gelangt Levi-Strauss zu einer Tiefenstruktur des Textes, die die verborgene Logik des Mythos aufzeigt. 2.2 Mythologische Logik Die Strukturmatrix der Mytheme in syntagmati-scher und paradigmatischer Anordnung erlaubt nun einen weiteren Schritt in die Analyse der textu-dlen Inhaltsstruktur. Nach Levi-Strauss (ebd.: 251) enthält nämlich jeder Mythos einen aus genau vier Mythemen bestehenden Kern, in denen sich eine mythologische Grundkonstellation zeigt, die sich durch die folgende Fomel darstellen läßt: Fx(a): Fy(b) = Fx(b): Fa-1(y) In dieser Formel repräsentieren a und b zwei Terme, die für im Mythos handelnde Agenten stehen, und x und y sind Funktionen, die für deren Handlungen stehen. Die Formel besagt nun, daß Term a durch seinen Gegensatz a1 ersetzt wird, und daß außerdem eine Inversion zwischen dem Funktionswert y und dem Termwert a stattfindet. Im Ödipusmythos bedeutet dies z.B., daß das durch Sphinx (a) begangene Töten (Fx) und die Rettung der Menscheit (Fy) durch Ödipus (b) im selben Verhältnis stehen wie der von Ödipus (b) begangene Mord (Fx) und die Rettung der Menschheit (y) durch die Tötung der Sphinx (Fa-i) (vgl. Köngäs-Maranda 8c Maranda 1971: 26-34). Allgemeiner: Fx : Fy repräsentiert den Konflikt zwischen dem Bösen und dem Guten. Er wird durch den Helden gelöst, der eine destruktive und insofern negative Handlung, nämlich die Vernichtung des Bösen vollbringt, welche sich dennoch ins Positive umkehrt und so zum Sieg durch Überwindung des Bösen führt. Somit »geht das mythische Denken aus von der Bewußtmachung bestimmter Gegensätze und führt hin zu ihrer allmählichen Angleichung. [...] Das Ziel des Mythos ist es, ein logisches Modell zur Auflösung eines Widerspruchs zu entwickeln« (Levi-Strauss 1958: 247, 253). - Zur weiterführenden Kritik der kanonischen Formel< von Levi-Strauss aus der Sicht der Logik und der Allgemeinen Semiotik siehe Marcus (1997a). 3. Mythisches Bewußtsein Mythos und Mythologie stehen auch im Mittelpunkt des Interesses der Semiotik der Schule von Moskau und Tartu (Ivanov 1978b). In dieser Tradition definieren z.B. Lotman & Uspenskij (1974: 5) das mythologische Denken als ein allgemeines Phänomen des menschlichen Bewußtseins. Die mythologische Welt besteht nach dieser Interpretation aus ganzheitlichen Phänomenen, die singulär, ohne semantische Merkmale und nicht hierarchisch strukturiert sind. In solch einer mythischen Welt sind die Zeichen wie die Eigennamen in der Sprache. Im Gegensatz zu Gattungsnamen haben Eigennamen bekanntlich keine semantischen Merkmale. Sie bezeichnen lediglich die Personen oder Orte unmittelbar, und auf diese Weise werden im Mythos (ähnlich wie in der Magie, s. X.2.3.2) die Dinge mit ihren Namen identifiziert (Lotman & Uspenskij 1974: 6-8). Somit erweist sich das mythologische Bewußtsein als asemiotisch: »Mythos und Name sind von Natur aus direkt miteinander verbunden [...]: Der Mythos ist ein persönlicher (namenhafter), und der Name ist ein mythologischer« (ebd.). Unter diesen Umständen entwickelte sich kulturgeschichtlich das mythologische Bewußtsein, in dem es »als Alternative zum semiotischen Denken begriffen wurde«, manchmal sogar als Verneinung von Zeichensystemen. 4. Mythen des Alltags In seinen Mythen des Alltags bestimmt Barthes (1957) kulturelle Phänomene als mythisch, die weder sprachlicher noch narrativer Art sind (s. II.8.2.2; Hervey 1982: 139-48; Lavers 1982: 113-27; Culler 1983: 33-41; Rylance 1994: 32-65; Kim 1996). 4.1 Mythos als sekundäres semiotisches System Nach Barthes (1957) ist Mythos ein »sekundäres semiotisches System«, das nach dem Prinzip der Konnotation strukturiert ist (s. II.8.2.1). Eine mythische Bedeutung überlagert auf »parasitäre Weise« die Denotation des Zeichens. Derartig mythische Zusatzbedeutungen finden sich in der Werbung (s. IX.8.2.2), in Filmen (vgl. Drummond 1984), im Geschäftsleben (vgl. Broms & Gahmberg 1981) oder sogar in der täglichen Eßkultur, etwa in den kulturellen Konnotationen der französischen Küche (Barthes 1957). 4.2 Von Mythoklasmus zum Semioklasmus Nach diesem Verständnis wird der Begriff des Mythos zum Instrument der semiotischen Kulturkritik (Barthes 1957: 141-43): Mythos erfüllt den Zweck einer »Naturalisierung« der Botschaften der Klasse der Bourgeoisie, indem diese faktischen Nachrichten (auf der denotativen Ebene) als Vehikel für verborgene (konnotative) ideologische Bedeutungen verwendet werden. Mythen berauben die Dinge ihrer Geschichte und vermeiden es, die Sachverhal-te zu hinterfragen, indem sie bestimmte Aussagen als universelle Sachverhalte tarnen. »Unter dem Einfluß der mythischen Umkehrung verwandeln sie die völlig zufälligen Grundlagen der Äußerung zur Norm, zum Allgemeingut, kurz: zur Doxie« (Barthes 1977: 165). Mythos ist mithin immer »eine gestohlene Sprache« (Barthes 1957: 115). Problematisch an dieser Mythentheorie ist allein die ihr zugrundeliegende Voraussetzung eines ideologisch >unschuldigen< primären Bedeutungssystems, das vom Mythos als sekundärem System bloß überlagert ist. Barthes selbst hat später die damit verbundene Annahme einer primären und ideologiefreien Grundbedeutung der Texte selbstkritisch als Illusion bezeichnet. In einem Aufsatz mit dem Untertitel »Mythologie heute« distanzierte er sich von seinem früheren Konzept eines »primären Bedeutungssystems« wie folgt: Die neue Semiologie - oder die neue Mythologie - kann und wird nicht länger in der Lage sein, den Signifikanten so leicht vom Signifikat, das Ideologische vom Phrasologischen zu trennen. [...] Eine mythologische Doxie ist geschaffen worden: [...] Entmythifizierung ist selbst zürn Diskurs, zur Stereotypie geworden. [...] Jetzt müssen nicht mehr die Mythen demaskiert werden. [...] Es ist das Zeichen selbst, das es zu erschüttern gilt. [...] In einer ersten Phase war die Zerstörung der ideologischen Signifikate das Ziel; in einer zweiten ist es die Zerstörung des Zeichens: Der »Mythoklasmus« wird durch einen »Semioklasmus« abgelöst. (Barthes 1977: 166-67) |
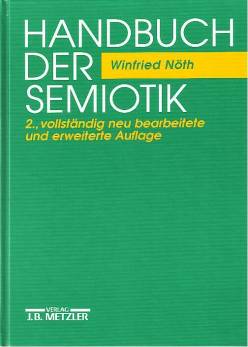
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen