|
|
|
Umschlagtext
Paul Celans Gedichte sind dem Verstummen abgerungen. Sie gehen an die Grenzen der Sprache, um den unbestatteten Toten der Shoah einen Erinnerungsort in der Dichtung zu geben. Gleichzeitig umkreisen sie den abwesenden Gott, der paradoxerweise als »Niemand« adressiert wird. Jan-Heiner Tück geht in seiner viel beachteten Celan-Studie behutsam den religiösen Spuren in Celans Lyrik nach und deutet sie als Anstoß für eine Theologie nach Auschwitz. Die erweiterte und durchgesehene Neuausgabe wurde von Eckhard Nordhofen um ein Geleitwort ergänzt.
Jan-Heiner Tück, geboren 1967, Professor am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Universität Wien; Schriftleiter der Internationalen Katholischen Zeitschrift Communio; Initiator der Wiener Poetikdozentur Literatur und Religion. Rezension
Die 3., erweiterte und durchgesehene Neuausgabe zu Paul Celans Dichtung in theologischer Perspektive wurde von Eckhard Nordhofen um ein Geleitwort ergänzt. Paul Celan (1920-1970) ist der bedeutendste jüdische deutschsprachige Lyriker des 20. Jahrhunderts. Der deutschsprachige Lyriker, dessen Eltern von den Nationalsozialisten ermordet wurden, Paul Celan (ursprünglich Paul Antschel) (*1920 in Czernowitz, Rumänien, heute Ukraine, in einer deutschsprachigen jüdischen Familie geboren; †1970 vermutlich Suizid in Paris) dürfte deutschen Gymnasiasten am ehesten über sein vielbeachtetes Gedicht "Todesfuge" ("Schwarze Milch der Frühe..." / "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau") bekannt sein, das den Mord an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten thematisiert. Anlässlich des 100. Geburtstags des Dichters legte Jan-Heiner Tück 2021 eine erweiterte Neuausgabe seiner Celan-Studie, erstmals 2000 erschienen, vor. Behutsam geht er den religiösen Spuren in den Gedichten nach und liest Celans Lyrik als Anstoß für eine Theologie nach Auschwitz. Im Zentrum steht Celans gebrochene Wieder-Aneignung religiöser Traditionen in seinem Gedichtzyklus "Die Niemandsrose" (1963).
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagworte: Soteriologie, Erlösung, Heil, Holocaust – Die Ermordung der europäischen Juden Zur Reihe: Poetikdozentur Literatur und Religion Gegenwartskunst und -literatur eröffnen Einblicke in andere Welten, registrieren Suchbewegungen und zeigen Erschütterungen an. Glück und Unglück, Verlusterfahrungen und Trostbedürfnisse werden im Kontext heutiger Lebenswelten durchgespielt. Lässt sich Gott in der Literatur finden? Wie nahe können sich Dichtung und Glaube kommen? Was kann aus einer Begegnung von Literaturwissenschaft und Theologie entstehen? Durch die Akzentuierung des Genres „Poetikdozentur“ auf das Feld von „Literatur und Religion“ – ein Novum im ganzen deutschsprachigen Raum – geht diese Reihe den genannten Fragen nach. In den Vorlesungen der Poetikdozentur gewähren renommierte Autorinnen und Autoren Einblicke in ihre Poetik, ihr literarisches Schaffen. Diese Einblicke aus erster Hand werden begleitet von wissenschaftlichen Beiträgen zur Poetik religiöser und literarischer Sprache. Inhaltsverzeichnis
Geleitwort von Eckard Nordhofen 7
Vorwort 11 Einleitung 14 I. Voraussetzungen 1. »Nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, ist barbarisch.« Deutschsprachige Dichtung nach 1945 33 2. »Ich habe nie eine Zeile geschrieben, die nicht mit meiner Existenz zu tun gehabt hätte.« Celans Leben und Werk 45 3. »Unumstößliches Zeugnis«. Celans dialogische Poetik 83 4. Eine »Anti-Bibel«? Celans Gedichtzyklus "Die Niemandsrose" (1963) 93 II. Deutungen 1. Es war Erde in ihnen. Totengedenken und Lobverweigerung 99 2. Psalm. Die Anrufung von »Niemand« als Echo des heiligen Namens 123 3. Zürich, Zum Storchen. Eine »Cor-Respondenz« mit Nelly Sachs 148 4. Benedicta. Eine jüdisch-christliche Begegnung im Zeichen des Teneberleuchters 173 5. In eins. Eine poetische Synopse von Daten, Orten und Losungsworten 197 6. Die Niemandsrose. Eine Suche nach Spuren des abwesenden Gottes 229 III. Provokationen »… ein Pflug, der die Zeit aufbricht« Dichtung – eine theologische Provokation 240 1. Wie von Gott, wie vom Leiden (nicht) sprechen 245 2. Beten nach der Shoah 264 3. Das »ewige Archiv« und die Wahrheit der Geschichte 275 4. Anstöße für eine Christologie nach Auschwitz 289 5. Das Unverzeihliche verzeihen? 306 6. Das Problem der Theodizee und die Hoffnung auf Vollendung 322 Dank 333 Literaturverzeichnis 339 Personenverzeichnis 357 Weitere Titel aus der Reihe Poetikdozentur Literatur und Religion |
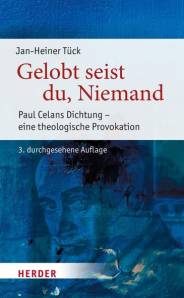
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen