|
|
|
Umschlagtext
Während utopische Romane zum Kanon der Literatur(-wissenschaft) gehören, steht utopische Lyrik selten im Fokus. Wie Björn Hayer zeigt, ist eine neue Lesart der poetischen Werke von Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke und Paul Celan, denen man bislang nicht unbedingt eine optimistische Sicht auf die Moderne bescheinigt hat, im Lichte der Zukunftsgerichtetheit lohnenswert: Zum einen werden darin politische und kulturelle Visionen ersichtlich, die vom Traum einer egalitären Gesellschaft bis hin zu einer die Grenze des Jenseits überschreitenden Erinnerungskultur reichen. Zum anderen fördert die Untersuchung sprachästhetische Entwürfe zutage, die unmittelbar an die Dynamik der Utopie als Denkprozess gekoppelt sind.
Rezension
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ oder „Was bleibet aber, stiften die Dichter“ zählen zu den bekanntesten Zitaten des Dichters Friedrich Hölderlin (1770-1843). Der Verfasser des lyrischen Briefromans „Hyperion oder der Eremit in Griechenland“, der Hymne „Patmos. Dem Landgrafen von Homburg“ oder von Gedichten wie „An die Natur“ und „Die Eichbäume“ gilt als einer der Hauptvertreter poetischer Utopien. Dazu können auch Rainer Maria Rilke (1875-1926) und Paul Celan (1920-1970) gezählt werden.
Dieses Behauptung vertritt Björn Hayer (*1987) überzeugend in seiner germanistischen Habilitationsschrift, die 2021 als Buch im transcript Verlag unter dem Titel „Utopielyrik. Möglichkeitsdimensionen im poetischen Werk. Friedrich Hölderlin – Rainer Maria Rilke – Paul Celan“ erschien. Der Germanist, Privatdozent an der Universität Koblenz-Landau und auch Autor gibt in seiner Monographie zunächst eine theoretische Bestimmung des Begriff des Utopischen unter Rekurs auf Ernst Blochs „Philosophie der Hoffnung“. Danach erfolgen drei luzide Werkanalysen, in denen Hayer Hölderlin als Dichter der politischen Utopie einer egalitären Gesellschaft, Rilke als Hoffnungsdichter und Celan als Lyriker der utopischen Spuren interpretiert. Allen drei Schriftstellern ist gemein, dass sie in ihren Werken Sprache als Medium des Utopischen begreifen. Außerdem gibt der Germanist zum Abschluss seiner Forschungsarbeit, die in einer der Habilitation angemessenen Fachsprache verfasst ist, einen Ausblick zu utopischen Tendenzen in der zeitgenössischen Lyrik. Als zentrale Charakteristika der Utopielyrik identifiziert Hayer drei, nämlich ihre Prozesshaftigkeit, ihre Antizipation neuen Daseins und ihre Offenheit bezüglich des Werdens. Deutsch-, Philosophie- und Ethiklehrkräfte erhalten durch die Monographie sehr gutes Fachwissen, um sich in ihrem Fachunterricht oder in einem fächerübergreifenden Projekt mit der utopischen Lyrik differenziert auseinandersetzen zu können. Für Lehrkräfte in Tübingen und Umgebung bietet es sich zudem an, dieses mit einer Exkursion zum Hölderlinturm zu verbinden. Fazit: Björn Hayer unterstreicht mit seinem Buch „Utopielyrik“ anhand von drei Meistern der Lyrik der Moderne eindrücklich die Aktualität utopischen Denkens. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Björn Hayer Utopielyrik Möglichkeitsdimensionen im poetischen Werk. Friedrich Hölderlin – Rainer Maria Rilke – Paul Celan Während utopische Romane zum Kanon der Literatur(-wissenschaft) gehören, steht utopische Lyrik selten im Fokus. Wie Björn Hayer zeigt, ist eine neue Lesart der poetischen Werke von Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke und Paul Celan, denen man bislang nicht unbedingt eine optimistische Sicht auf die Moderne bescheinigt hat, im Lichte der Zukunftsgerichtetheit lohnenswert: Zum einen werden darin politische und kulturelle Visionen ersichtlich, die vom Traum einer egalitären Gesellschaft bis hin zu einer die Grenze des Jenseits überschreitenden Erinnerungskultur reichen. Zum anderen fördert die Untersuchung sprachästhetische Entwürfe zutage, die unmittelbar an die Dynamik der Utopie als Denkprozess gekoppelt sind. Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 7
2. Bestimmungsversuche des Utopischen Vom Modell zur Methode 11 2.1 Die klassische Gesellschaftsutopie 11 2.2 Utopie als Bewusstsein und Prozess15 2.3 Subjekt, Objekt und Dialektik 22 2.4 Kunst als utopisches Medium 26 2.5 Utopie als Methode 31 2.6 Lyrik und Utopie. Vorüberlegungen zu einer Synergie 36 3. Zwischen Dichterasyl und egalitärer Gesellschaft Friedrich Hölderlins poetische Utopien 43 3.1 Im »freundliche[n] Asyl«: Hölderlins Dichterutopie 43 3.2 Eine Poetik der Gleichheit: Hölderlins Vorstellung einer herrschaftsfreien Gesellschaft 55 3.3 Zwischen Griechenland und moderner Ernüchterung: Hölderlins Sozialutopie als Zeitkritik 72 3.4 Die unabschließbare Poesie: Offenheit als Möglichkeitsraums 83 3.5 Das Pathos als Medium: Persuasio als Strategie des Utopischen 90 4. Performative Utopien Rainer Maria Rilkes Dichtung als Sprachbewegung 99 4.1 Utopien zwischen Dialog und Ansprache: Der alternative Ort im Du und im Ding 99 4.2 Motive des Utopischen: Engel, Rosen und Fantasiegestalten 111 4.3 Möglichkeitstopografien: Gärten und Inseln der Erneuerung 123 4.4 Die Zukunft folgt aus der Vergangenheit: Erinnerung im Zeichen der Utopie 129 4.5 Der utopische Kreateur: Rilkes Orpheus 133 4.6 Jenseits der gedeuteten Welt: Das Utopische zwischen Vagheit, Antinomien und Gleichnis in den Duineser Elegien 141 5. Das Leben im Tod finden Zur Poetik utopischer Spuren bei Paul Celan 165 5.1 Die Utopie zwischen Alterität und Verwandlung. Poetologische Grundzüge in Celans Reden 166 5.2 Anlagen unter Verschüttetem: Poetische Realisierungspotenziale 171 5.3 Tote unter Lebenden: Wahrung und Umkehr des Holocausts 179 5.4 Ich und Du: Dialogizität im Zeichen des Utopischen 189 5.5 Zuhause im Unbehausten: Sprache als performative Heimatutopie 205 6. Utopische Tendenzen Möglichkeitsdenken in der zeitgenössischen Lyrik 223 6.1 Das Jenseits von Traum und Poesie 223 6.2 Ursprungs- und Schöpfungsutopien 231 6.3 Die Entdeckung des U-topos 245 7. Zusammenfassung 259 8. Literaturverzeichnis 265 Danksagung 285 |
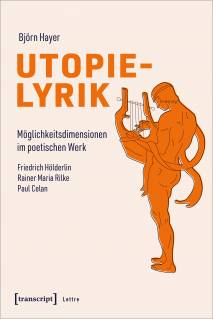
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen