|
|
|
Umschlagtext
Über die Autorin/ Über den Autor:
Dorothee Schulte-Peschel: Jahrgang 1954, Studium der Sonderpädagogik in Köln und danach berufstätig in der verbandlichen Jugendarbeit und als Sonderschullehrerin. Schwerpunkte der Arbeit sind z.Zt.: Förderansätze für schwer behinderte Schüler, Schulmanagement, berufsbegleitende Weiterbildung in Transaktionsanalysen, schulinterne Lehrerfortbildung. Ralf Tödter: Jahrgang 1956, Ausbildung als Sonderschullehrer und Diplompädagoge in Hamburg und Frankfurt/M. Schwerpunkte der Arbeit sind z.Zt.: Handlungs- und Schülerorientierter Unterricht, Management in Organisationen, Handlungstheorie, Fortbildung und Beratung. Beide arbeiten seit einigen Jahren zusammen - als Schulleiter und Konrektorin an der Martinus Schule, private Schule für Geistigbehinderte in Schwäbisch Gmünd; - bei Vorträgen, Schulungen, Beratung, Diagnostik und Förderung von Schülern mit schweren Behinderungen. Dieses Buch - wurde in erster Linie geschrieben für Lehrerinnen und Lehrer, die am Anfang ihrer Unterrichtstätigkeit mit geistig behinderten SchülerInnen stehen, sei es an der Sonderschule oder an der Regelschule; - bezieht schwer behinderte Schüler ein; - ist darüber hinaus für alle LehrerInnen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie plane ich Unterricht, der schülerorientiert und handlungsorientiert sein soll; - liefert einen Beitrag der Sonderschule zu einer Pädagogik für alle. Das Buch informiert über Unterrichtsformen und Förderansätze zur Entwicklung von Handlungsfähigkeit. Diese werden in einen Zusammenhang gestellt, der die Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der Schüler und Lehrer sowie die grundsätzliche Offenheit und Selbstbestimmtheit von Lernprozessen betont. Es werden konkrete Hilfen gegeben, wie die individuelle Lernausgangslage zur Grundlage der Unterrichtsplanung werden kann. Im Spannungsfeld zwischen den Zielen des Lehrers und den Interessen, Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schüler entstehen Einladungen zum Lernen. Rezension
Dieses Buch ist ein guter Ratgeber für alle, die ihre Schüler durch offene, handlungsorientierte Unterrichtsformen zu mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung führen möchten. In einem sehr ausführlichen Theorieteil wird zunächst das Menschenbild dargestellt, von dem die Autoren ausgehen. Anschließend wird sehr umfassend das grundlegende Konzept einer handlungsorientierten Didaktik dargestellt und vor allem die Begriffe 'Handlung', 'Handlungsplanung' und 'Handlungsfähigkeit' geklärt. Hierbei bemühen sich die Verfasser sehr um eine klar verständliche Ausdrucksweise, so dass die Aussagen auch denjenigen deutlich werden, die sich nicht auf dem neuesten Stand der sonderpädagogischen Diskussion um systemische Sichtweise und Kompetenzorientierung befinden.
Im zweiten Teil des Buches werden verschiedene Unterrichtsformen und Förderansätze beschrieben, die geeignet sind, die Handlungsfähigkeit auch von Schülern mit geistiger Behinderung zu fördern. Der dritte Teil schließlich befasst sich mit der Umsetzung in die Unterrichtspraxis und der Planung konkreter Unterrichtsvorhaben. Dabei helfen verschiedene Raster bei der Klärung der Lernausgangslage der jeweiligen Schüler. Auch die Beschreibung der Entwicklungsstufen in den verschiedenen elementaren Bereichen ist sehr hilfreich um den jeweiligen Ist-Stand und die "Stufe der nächsten Entwicklung" zu ermitteln. B. Lensch, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Dieses Buch informiert über Unterrichtsformen und Förderansätze zur Entwicklung von Handlungsfähigkeit. Diese werden in einen Zusammenhang gestellt, der die Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der Schüler und Lehrer sowie die grundsätzliche Offenheit und Selbstbestimmtheit von Lernprozessen betont. Es werden konkrete Hilfen gegeben, wie die individuelle Lernausgangslage zur Grundlage der Unterrichtsplanung werden kann. Die Autoren wenden sich an LehrerInnen, die geistig behinderte Schüler unterrichten, sei es an der Sonderschule oder an der Regelschule, und die nach Unterrichtsformen suchen, die schüler- und handlungsorientiert sind – auch und gerade mit schwer behinderten Schülern und solchen mit besonderem Verhalten. „Das Buch kann jedem, der mit geistig Behinderten arbeitet, ob als Lehrer, Erzieher oder Therapeut, als informative und lesenswerte Anregung empfohlen werden.“ Deutsche Lehrerzeitung Inhaltsverzeichnis
Vorwort (9)
Einführung (11) TEIL I (19) 1. Handlung als Verbindung zwischen Mensch und Welt (21) 1.1 Strukturelemente und Phasen einer Handlung (22) 1.1.1 Handlungsorientierung: Grundlegendes Konzept und Ausgangspunkt (23) 1.1.2 Handlungsorientierung bei Menschen mit schweren Behinderungen - Handlungsorientierung unter der Lupe (25) 1.1.3 Handlungsplanung und Handlungskontrolle (28) 1.1.4 Handlungsausführung (30) 1.1.5 Zusammenfassung und Übersicht (31) 1.2 Handlung und kognitive Entwicklung nach J. Piaget (32) 1.3 Handlung und Gleichgewicht der Beziehungen 1.3.1 Beziehungen zwischen Personen (38) 1.3.2 Beziehungen zu den Dingen (42) 1.4 Handeln und Lernen (43) 1.4.1 Interiorisation und Exteriorisation im Rahmen von Lernprozessen (47) 1.5 Einschränkung der Handlungsfähigkeit (48) 1.6 Leseempfehlungen (50) 2. Handlungsorientierte Didaktik - das grundlegende Konzept (51) TEIL II (57) 3. Unterrichtsformen zur Entwicklung der Handlungsfähigkeit (59) 3.1 Handlungs- und Schülerorientierter Unterricht (61) 3.1.1 Der Einsatz von Modellen im Unterricht (J. Lompscher) (65) 3.1.2 Lernen in Stufen (P. Galperin) (68) 3.1.3 Aufbau funktioneller Systeme (I. Mann) (72) 3.1.4 Schülerorientierter Unterricht (H. Meyer) (75) 3.1.5 Stellenwert von Handlungs- und Schülerorientiertem Unterricht innerhalb unseres Gesamtkonzepts (81) 3.1.6 Voraussetzungen für Handlungs- und Schülerorientierten Unterricht (83) 3.1.7 Leseempfehlungen (84) 3.2 Freie Arbeit (84) 3.2.1 Theoretische Grundlagen (84) 3.2.2 Das ist uns wichtig - Anwendung, Einordnung und Bewertung (88) 3.2.2.1 Lernvoraussetzungen zur Freien Arbeit erheben (89) 3.2.2.2 Freie Arbeit konkret beginnen (91) 3.2.2.3 Ablauf einer Unterrichts'stunde' Freie Arbeit an der Martinus-Schule (94) 3.2.2.4 Freie Arbeit mit 'problematischen' Schülern - ein Erfahrungsbericht (95) 3.2.2.5 Freie Arbeit entwickelt Handlungsfähigkeit, weil... (97) 3.2.3 Leseempfehlungen (99) 3.3 Projektunterricht (99) 3.3.1 Theoretische Grundlagen (100) 3.3.1.1 Projekte im Unterricht (102) 3.3.1.2 Der Handlungskomplex 'Projekt' (102) 3.3.2 Das ist uns wichtig - Anwendung, Einordnung und Bewertung (103) 3.3.2.1 Projektkriterien - woran erkennt man ein Projekt? (104) 3.3.2.2 Projektunterricht mit allen? (107) 3.3.2.3 Projektverlauf unter der Lupe (109) 3.3.2.4 Projektwoche an der Schule für Geistigbehinderte (113) 3.3.2.5 Stärken und Grenzen des Projektunterrichts (114) 3.3.3 Leseempfehlungen (114) 4. Förderansätze zur Entwicklung der Handlungsfähigkeit (117) 4.1 Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (Hartmann/Rohmann) (123) 4.1.1 Theoretische Grundlagen (123) 4.1.2 Das ist uns wichtig - Anwendung, Einordnung und Bewertung (127) 4.1.3 Leseempfehlungen (132) 4.2 Basale Stimulation (A. Fröhlich) (132) 4.2.1 Theoretische Grundlagen (132) 4.2.2 Das ist uns wichtig - Anwendung, Einordnung und Bewertung (136) 4.2.3 Leseempfehlungen (139) 4.3 Sensorische Integrationsbehandlung (J. Ayres) (140) 4.3.1 Theoretische Grundlagen (142) 4.3.1.1 Integration unterschiedlicher Wahrnehmungsmodalitäten (143) 4.3.1.2 Die Grundwahrnehmungssysteme (144) 4.3.1.3 Integration verschiedener Strukturen des Zentralnervensystems (148) 4.3.2 Das ist uns wichtig - Anwendung, Einordnung und Bewertung (154) 4.3.2.1 Wahrnehmungsstrukturen im Ungleichgewicht (154) 4.3.2.2 Herstellung des Gleichgewichts - Therapie (157) 4.3.2.3 SI und Handlungsfähigkeit (158) 4.3.3 Leseempfehlungen (161) 4.4 Basale Kommunikation (W. Mall) (161) 4.4.1 Theoretische Grundlagen (161) 4.4.2 Das ist uns wichtig - Anwendung, Einordnung und Bewertung (164) 4.4.3 Leseempfehlungen (167) 4.5 Körperzentrierte Interaktion (Rohmann/Hartmann) (167) 4.5.1 Theoretische Grundlagen (167) 4.5.2 Das ist uns wichtig - Anwendung, Einordnung und Bewertung (170) 4.5.3 Leseempfehlungen (174) 5. Therapie und Unterricht (175) 5.1 Anforderungen an Therapien, die in ein Konzept handlungsorientierter Didaktik integriert werden können (176) 5.2 Integration von Förderansätzen und Unterrichtsformen (179) 5.3 Leseempfehlungen (182) TEIL III (183) 6. Unterricht: Planung und Reflexion (185) 6.1 Der Rote Faden (187) 6.1.1 Erläuterungen und Beispiele (190) 6.2 Jahresplanung, Tages- und Wochenstruktur (196) 6.3 Planung von Unterrichtsvorhaben (197) 6.4 Bericht, Zeugnis (199) 6.5 Leseempfehlungen (200) 7. Bausteine zur Beurteilung kognitiver Entwicklung (201) Literatur (211) |
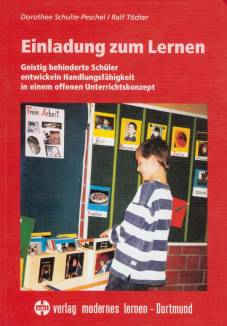
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen