|
|
|
Umschlagtext
Wer begleitet mich auf meinem Lebensweg? Junge Menschen, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufwachsen, erleben häufig einen Wechsel ihrer Bezugspersonen. Um den Folgen dieser Bindungsabbrüche entgegen zu wirken, gibt es die ehrenamtliche Wegbegleitung. Sie ergänzt das professionelle stationäre Setting, indem sie ein unbezahltes, dauerhaftes und exklusives Beziehungsangebot macht, das auch für CareleaverInnen und im Erwachsenenalter bestehen bleiben soll. Das Konzept der Wegbegleitung wird in diesem Buch von ExpertInnen mit kritischer Brille in Bezug auf Hindernisse und Stolpersteine beleuchtet. Es werden wichtige Grundlagen und theoretische Ansätze diskutiert und Impulse zur konzeptionellen Umsetzung sowie zur strukturierten und strukturellen Initiierung der Wegbegleitung dargestellt.
Julius Daven, Köln, ist ehrenamtlicher Wegbegleiter und Vormund für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und freier Autor. Er engagiert sich seit Jahren in den Sozialen Hilfen. Prof. Dr. phil. Andreas Schrenk, Marxzell im Schwarzwald, ist Dipl.-Sozialpädagoge mit über 25 Jahren Erfahrung in Leitungstätigkeiten und der Jugendhilfepraxis. Er ist Experte für SGB VIII- und SGB IX-konforme Schutzkonzepte und Führungskräfteentwicklung. Rezension
Es ist nichts Neues, dass Übergänge aus sozialpädagogischen Settings in das Erwachsensein sowie auch Übergänge innerhalb sozialpädagogischer Settings für die betroffenen jungen Menschen (CareleaverInnen) häufig sehr belastende Einschnitte darstellen und nicht selten krisenhafte Verläufe nehmen. Junge Menschen, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufwachsen, erleben häufig einen Wechsel ihrer Bezugspersonen. Um den Folgen dieser Bindungsabbrüche entgegen zu wirken, gibt es die ehrenamtliche Wegbegleitung. Sie ergänzt das professionelle stationäre Setting. Wenn man ehrenamtliche Wegbegleitung als informelle oder organische Hilfeform bezeichnet, soll damit nicht professionelle sozialpädagogische Arbeit abgewertet oder als verzichtbar erklärt werden Vielmehr bedeutet es die Erweiterung professioneller Portfolios. Dieses Buch zeigt auf, wie das Beziehungsangebot ehrenamtlicher Wegbegleitung jungen Menschen durch ihr individuelles, dauerhaftes und exklusives Beziehungsangebot Halt, Stabilität und Orientierung vermitteln kann.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Zielgruppe: pädagogische und psychologische Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, SozialarbeiterInnen Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen 11
Vorwort 12 Einleitung 14 Teil I Grundlagen und theoretische Ansätze 18 1 Resilienz und Wegbegleitung 19 Von Christoph Steinebach und Ursula Steinebach 1 1 Resilienz als Kompass auf dem Weg 20 Orientierung – Wegmarken im Lebenslauf 20 Sichtweisen – Entwicklung gestalten lernen 21 Co-Resilienz – sich gegenseitig stärken 22 1 2 Wegbegleitung als Resilienzförderung 24 Positive Beziehungen 25 Gute Gespräche 26 Fortlaufende Reflexion 26 1 3 Resilienzkompetenz für die Wegbegleitung 27 Kompetenzbildung 28 Vorbereitung im Training 29 Begleitung durch Supervision 29 1 4 Fazit 30 2 Bindungstheoretische Grundlagen und Bezüge zur Wegbegleitung 31 Von Josefin Martin 2 1 Die Bindung 32 2 2 Die Bindungstypen 33 2 3 Die psychosoziale Belastung von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen 36 2 4 Korrigierende Bindungserfahrungen 37 2 5 Anforderungen an die qualifizierte Wegbegleitung 37 2 6 Fazit 39 3 Ehrenamtliche Wegbegleitung traumapädagogisch betrachtet 41 Von Ralph Kirscht 3 1 Traumatische Erfahrungen und mögliche Folgen 41 3 2 Traumatisierende Beziehungs- und Bindungserfahrungen aus traumapädagogischer Sicht 44 3 3 Korrigierende Beziehungs- und Bindungserfahrungen aus traumapädagogischer Sicht 46 3 4 Ehrenamtliche Wegbegleitung als korrigierende Beziehungs- und Bindungserfahrungen 48 3 5 Besondere Anforderungen an die ehrenamtlichen WegbegleiterInnen 50 3 6 Fazit 50 4 Die ehrenamtliche Wegbegleitung im Kontext der internationalen Kinderrechte 52 Von Volker Augustyniak 4 1 Unterstützungssysteme in Deutschland 52 4 2 Kinderrechte und ehrenamtliche Wegbegleitung 55 Berücksichtigung des Kindeswillens (Art 12 UN-KRK) 57 Recht auf Bildung (Art 28 UN-KRK) 58 Das Recht auf Spiel und Freizeit (Art 31 UN-KRK) 60 4 3 Fazit 61 5 Partizipation und Empowerment in der Wegbegleitung 62 Von Andrea Warnke und Vaida Lindemann 5 1 Was meint Empowerment? 63 5 2 Was meint Partizipation? 64 5 3 Rechtliche Rahmung 67 Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 68 5 4 Empowerment und Partizipation in der Praxis der Wegbegleitung 68 5 5 Fazit 71 6 Heimerziehung und Wegbegleitung mit Blick auf die Konstruktion sozialer Realität 72 Von Andreas Schrenk 6 1 Wirkung von Heimerziehung 72 6 2 Wegbegleitung und Mindset 75 6 3 Wegbegleitung und Selbstwirksamkeit 77 6 4 Resilienz als Ziel 78 6 5 Konstruktion sozialer Realität 79 6 6 Fazit 80 7 Ehrenamtliches Engagement und Soziale Arbeit Zwischen Substitution und Synthese 81 Von Aaron Schulze 7 1 Keine Substitution von Fachkräften durch Ehrenamtliche 81 7 2 Ein politischer Blick auf die ehrenamtliche Tätigkeit 82 7 3 Wegbegleitung als Ressourcenquelle 83 7 4 Social Bridging 84 7 5 Hintergründe für ein Engagement und die Bedeutung für die Wegbegleitung 85 7 6 Fazit 89 Teil II Umsetzung und Initiierung 91 8 Schutzkonzepte im Kontext ehrenamtlicher Wegbegleitung in Wohngruppen der Heimerziehung 92 Von Gregor Hensen 8 1 Was ist ein Schutzkonzept? 92 8 2 Zusammenspiel von Professionellen und Ehrenamtlichen im Hilfesetting 95 8 3 Was sollte ein Schutzkonzept für die Wegbegleitung berücksichtigen? 97 8 4 Fazit 102 9 Settingkonstruktion und Fallverstehen mit Blick auf ehrenamtliche WegbegleiterInnen 104 Von Mathias Schwabe 9 1 Chancen und Risiken des Settingelements ehrenamtliche Wegbegleitung 104 Settingelemente in stationären Wohngruppen 104 Ehrenamtliche Wegbegleitung als Settingelement 106 Settingfragen bei ehrenamtlicher Wegbegleitung 107 9 2 Fallverstehen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Wegbegleitung 109 Die Rolle des Kindes 109 Die Rolle der ehrenamtlichen WegbegleiterInnen 112 Erwartungen im Hilfe-System 113 9 3 Fazit 113 10 Bedeutung unbezahlter Beziehungen in der Kinder- und Jugendhilfe 115 Von Menno Baumann 10 1 Das System der Kinder- und Jugendhilfe 115 10 2 Paragraphen als Beziehungskontext? 116 10 3 „Schnauze voll vom bezahlten Gemocht-Werden“ 118 10 4 Kontexte, in denen „professionell“ manchmal nicht reicht 120 10 5 Fazit 121 11 Leaving Care: Die Rolle der Wegbegleitung beim Übergang in die Selbständigkeit 124 Von Roswitha Maria Burri 11 1 Rückblick auf meine Phase Leaving Care 124 „Danach war alles anders“: Die Übergangsphase 124 Sonstige Bezugspersonen außerhalb des Heims 125 11 2 Wegfall des Sicherheitsnetzes 125 11 3 Beziehungen und Bindungen bei CarleaverInnen 128 Unbefristete Beziehungen 128 Herausforderungen in der Phase Leaving Care 130 WegbegleiterInnen als Vertrauenspersonen 132 Partizipation als Voraussetzung, ein Unterstützungsbedürfnis zu äußern 133 11 4 Fazit 133 Das System der Kinder- und Jugendhilfe: Was sich verändern muss 133 Das Potenzial der ehrenamtlichen Wegbegleitung 135 12 Herausforderungen der Wegbegleitung aus Sicht der Begleitenden 136 Von Julius Daven 12 1 Ergänzung des sozialen Umfelds außerhalb der Wohngruppe 136 12 2 Herausforderungen der Wegbegleitung 137 Lernphase, Beziehungsaufbau und potenzielle Ablehnung 137 Fachliche Begleitung der WegbegleiterInnen 139 Partizipation der WegbegleiterInnen 140 Hohe Verantwortung und Selbstverpflichtung 141 12 3 Falsche Erwartungen an die Wegbegleitung 143 12 4 Gemeinsam getragenes Schutzkonzept 144 12 5 Rechte der WegbegleiterInnen 145 12 6 Fazit 145 13 Standards der Wegbegleitung 147 Von Julius Daven und Andreas Schrenk 13 1 Bedarfseinschätzung 148 13 2 Anforderungs- und Aufgabenprofil 149 13 3 Gewinnung von WegbegleiterInnen 152 13 4 Begleitung, fachliche Unterstützung und Qualifizierung 152 13 5 Anerkennung und Wertschätzung 153 13 6 Qualitätssicherung 154 13 7 Fazit 156 14 Supervision von Ehrenamtlichen während der Wegbegleitung 157 Von Anke Höhne 14 1 Formen von Supervision 158 Ablauf einer Supervision 158 Zeitlicher Umfang 159 Formen von Supervision 159 Online-Supervision 163 14 2 Supervision für WegbegleiterInnen 163 14 3 Themen in der Supervision 165 Auffälliges Verhalten bei dem Wegbegleiter zuhause 165 Überforderung des Wegbegleiters 166 Nähe und Distanz 167 Weitere Themen 167 14 4 Fazit 168 15 Digitalität: Neue Wege in der Interaktion 169 Von Alicia Sailer 15 1 Qualitätssicherung 169 15 2 Prozessgestaltung der Wegbegleitung 171 15 3 Digitale Informations- und Kommunikationstechnologien 172 15 4 Bedeutung der Digitalisierung in der Sozialwirtschaft 173 15 5 Nutzung digitaler Technologien in Prozessen der Wegbegleitung 175 15 6 Fazit 179 Literatur 181 Die Autorinnen und Autoren 195 Sachregister 197 |
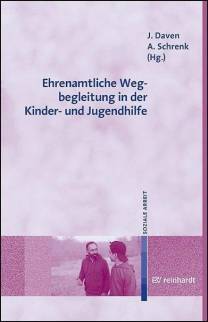
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen