|
|
|
Umschlagtext
Annegret Eckhardt-Henn
Studium der Humanmedizin in Marburg, nach ärztlicher Weiterbildung in den Fächern Pathologie und Chirurgie Facharztausbildung an der Psychiatrischen und Neurologischen Universitätsklinik in Marburg. Seit 1991 tätig an der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Mainz. Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Oberärztin der Konsil- und Liaisonambulanz und Poliklinik; Ausbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und Psychoanalytische Ausbildung (DPV) am Sigmund Freud Institut Frankfurt und Frankfurter Psychoanalytischen Institut; Ausbildung in analytischer Paar- und Familientherapie in Gießen. Sven Olaf Hoffmann Studium der Humanmedizin in Hamburg, Heidelberg und Paris; Studium der Psychologie in Berlin. Psychoanalytische Ausbildung am Karl Abraham Institut in Berlin. Psychiatrische Ausbildung an der Psychiatrischen Klinik der FU Berlin; 1973-1982 Oberarzt an der Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin der Universität Freiburg. Seit 1982 Direktor der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Mainz. Mitbegründer und Sprecher (1992-1999) des Arbeitskreises OPD; von 1998-2003 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie nach dem Psychotherapeutengesetz. Rezension
In diesem Sammelband stellen 27 Autoren, darunter bekannte Experten wie Peter Fiedler, Ulrich Sachsse und Manfred Spitzer in 31 Kapiteln auf 480 Seiten (mit Anhang) den aktuellen Wissensstand zum Thema dissoziative Bewusstseinsstörungen dar.
Zielsetzung des Buches ist es hierbei, vor dem Hintergrund zum Teil heftiger Kontroversen und Anschuldigungen, wie sie unter anderem im Zusammenhang mit der False-Memory-Debatte zu verzeichnen sind, zu einer Begriffsklärung und einer sachlichen Darstellung auf rein wissenschaftlicher Basis beizutragen, unter Berücksichtigung neuster Erkenntnisse und Befunde aus Klinik und Forschung. Dem Schattauer-Verlag ist es dabei wieder einmal gelungen, mit Sven Olaf Hoffmann einen renommierten Wissenschaftler als Herausgeber zu gewinnen (neben Annegret Eckhardt-Henn), der über eine jahrzehntelange Publikationserfahrung verfügt und als Garant für sachliche und verlässliche Informationen gilt. Die Darstellung ist umfassend und enthält neben den Grundlagen (Teil A) und klinischen Perspektiven (Krankheitsbilder, Teil B) auch Ausführungen zur Traumatisierung (Teil C) sowie Diagnostik (Teil D) und therapeutische Ansätze (Teil E). Wie die Verwendung des Plurals im Titel bereits andeutet, liegt bei den dissoziativen Bewusstseinsstörungen kein einheitliches sondern eine Vielzahl von Krankheitsbildern vor, wie z.B. Amnesien, Stupor, Identitätsstörungen sowie Depersonalisations- und Derealisationsphänomene neben so außergewöhnlichen Phänomenen wie Besessenheitszuständen, die allgemein wohl eher mit Religion als Klinik in Verbindung gebracht werden. Die Darstellung umfasst hierbei klinisches Bild, Diagnose und Ätiopathogenese sowie die Abgrenzung zu anderen Störungen, wie z.B. der Borderlinestörung, wobei es aber auch erhebliche Überschneidungen geben kann, bzw. die einzelnen Störungen zusammen auftreten können. Die Bedeutung von traumatischen Erlebnissen, insbesondere in der frühen Kindheit, wird hierbei ausführlich berücksichtigt. Für Lehrer dürften die Ausführungen im Teil A zur Informations- und Reizverarbeitung sowie kognitionspsychologischen Aspekten von besonderem Interesse sein und für die Frage von Lernstörungen eine besondere Relevanz haben. Die therapeutischen Anätze berücksichtigen neben psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Konzepten auch die psychopharmakologische Therapie und sind somit für ein breites Fachpublikum von Interesse. Erstmals wird hierbei dem deutschsprachigen Fachpublikum das phasenorientierte Modell der niederländischen Gruppe um Onno van der Hart vorgestellt, die eine eigene Theorie zu den dissoziativen Störungen entwickelt hat, mit der sich auch die unterschiedlichen Ausmaße der Beeinträchtigungen plausibel erklären lassen. Die Ausführungen sind auch sprachlich auf einem anspruchsvollen Niveau geschrieben. Das Kapitel von Hans-Peter Kapfhammer (Kapitel 2) dürfte aufgrund seiner fachwissenschaftlichen Ausführungen zur Neurochemie und Molekularbiologie für Nichtmediziner eine besondere Anforderung darstellen. Die Kenntnis psychologischer Fachtermini wird vorausgesetzt. Für Lehrer mit einer universitären und praktischen Ausbildung im Bereich Psychologie und Pädagogik sind die Ausführungen jedoch verständlich. Am Ende eines jeden Kapitels befindet sich ein Literaturverzeichnis mit den wichtigsten Titeln zum Thema, wobei zahlreiche Publikationen, wie zu erwarten, aus dem anglo-amerikanischen Raum stammen. Fazit: Aktuelle wissenschaftliche Darstellung des Themas dissoziative Bewusstseinsstörungen, die unterschiedliche Perspektiven und Ansätze integriert. Björn Hillen, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Der Begriff der „Dissoziativen Bewusstseinsstörungen" ist in der Psychiatriegeschichte über 100 Jahre alt - und bleibt trotzdem zugleich weithin diffus oder unbekannt. In der Klinik nicht alltäglich und dennoch hochrelevant, ist er in den Grundkonzepten teilweise erhellend, aber auch oft unklar und widersprüchlich. Das Anliegen dieses Buches ist es, eine valide Übersicht zum gegenwärtigen Stand von Theorie, Klinik und Therapie der Dissoziativen Bewusstseinsstörungen zu geben. Neben theoretischen Hintergründen (z.B. Begriffsgeschichte, Dissoziation und Epilepsie, kognitionsbiologische Aspekte) werden die verschiedenen Störungsbilder, wie Amnesien, Depersonalisation, dissoziative Anfälle, Fugue, Trance-Zustände und Dissoziative Identitätsstörung („Multiple Persönlichkeit"), ausührlich dargestellt. Ätiologische Modelle - von der Neurobiologie bis zur Psychodynamik - und Fragen der Diagnostik und Klassifikation werden aufgeführt. Aktuelle Therapieansätze und ein integratives Verändnis, z.T. in neuen Modellen entwickelt, sind den Herausgebern dabei besonders wichtig. 26 namhafte Autoren bürgen für eine aktuelle und umfassende Abhandlung des gesamten Spektrums der Dissoziativen Bewusstseinsstörungen. Aus dem Inhalt Begriffsgeschichte (z.B. Neurobiologie von Hypnose, Dissoziation und Konversion, Somatoforme Dissoziation, historische Aspekte und Entwurf eines integrativen Modells) Klinische Perspektiven (z.B. Dissoziative Amnesie, Stupor, Fugue; Besessenheits- und Trancezustände, das Ganser-Syndrom, die Dissoziative Identitätsstörung) Dissoziative Störungen als Folge schwerer Traumatisierung (z.B. empirische Befunde zur Trauma-Pathogenese, Dissoziation und Posttraumatische Belastungsstörung) Diagnostik und Differenzialdiagnostik (z.B. Probleme der aktuellen Klassifikation, Psychometrische Diagnostik, das Strukturierte Klinische Interview für Dissoziative Störungen, SKID-D) Therapeutische Ansätze (z.B. der psychodynamische Behandlungsansatz, kognitive Verhaltenstherapie, EMDR, psychopharmakologische Therapie) Inhaltsverzeichnis
A Begriffsgeschichte 1
1 Die Dissoziation: eine Standortbestimmung 3 S. O. Hoffmann, A. Eckhardt-Henn 2 Dissoziation und Gedächtnis als Ergebnisse neurobiologisch beschreibbarer Prozesse 9 H.-P. Kapfhammer 2.1 Einleitung 9 2.2 Multiple Gedächtnissysteme in ihrer neuroanatomischen Repräsentation 10 2.3 Neurochemische und molekularbiologische Grundlagen des Gedächtnisses 14 2.4 Zusammenfassung 33 3 Neurobiologie von Hypnose, Dissoziation und Konversion 37 M. Spitzer, C. Schönfeldt-Lecuona 3.1 Einleitung 37 3.2 Phänomene, Krankheitsbilder und Kriterien 38 3.3 Pathophysiologie: erste Ansätze 39 3.4 Neurobiologie der Hypnose: weitere Studien 41 3.5 Vom Komplex zur Inhibition 42 3.6 Zusammenfassung 43 4 Erinnern, Vergessen und Dissoziation neuro- und kognitionspsychologische Perspektiven 46 P. Fiedler 4.1 Einleitung 46 4.2 Gedächtnis und Erinnerung 46 4.3 Dissoziative Störungen 48 4.4 Erinnerung und alltägliches Vergessen 53 4.5 Intendiertes Vergessen 55 4.6 Einige therapeutische Konsequenzen 57 5 Dissoziation, Traum, Reassoziation 60 W. Leuschner 5.1 Der Traum ist kein Dissoziationsphänomen 60 5.2 Dissoziation und Traumbildung 61 5.3 Experimentell sichtbar gemachte Dissoziation 62 5.4 Reassoziierung 5.5 Endogene oder kohäsive Reassoziierungsfaktoren 5.6 Exogene Reassoziierungsfaktoren 67 5.7 Zustandabhängigkeit und Wirkungsbereich des Dissoziierungs-Reassoziierungs-Vorgangs 68 5.8 Belege und Folgerungen 70 6 Dissoziative Mechanismen und Persönlichkeitsentwicklung 74 F. Resch, R. Brunner 6.1 Einleitung 74 6.2 Entwicklungspsychopathologisches Modell des dissoziativen Symptomkomplexes 75 6.3 Entwicklungspsychopathologisches Modell der Selbstregulation 76 6.4 Traumabezogene Persönlichkeitsveränderung 77 6.5 Dissoziation bei Kindern und Jugendlichen 79 6.6 Neurobiologische Aspekte traumabezogener psychiatrischer Störungen 81 6.7 Zentrale Befunde der Entwicklungstraumatologie 81 6.8 Neurobiologische Aspekte von Stress und Gedächtnisfunktionen 83 6.9 Emotionsgedächtnis und inter-personelle Beziehungen 86 6.10 Schlussfolgerungen 88 7 Somatoforme Dissoziation 94 E. R. S. Nijenhuis 7.1 Somatoforme Dissoziation 94 7.2 Eine Klassifikation dissoziativer Symptome 96 7.3 Janets Theorie der Dissoziation 97 7.4 Die „anscheinend normale Persönlichkeit“ (ANP) und die „emotionale Persönlichkeit“ (EP) 98 7.5 Der Fragebogen zur somatoformen Dissoziation (SDQ) 99 7.6 Somatoforme und psychoforme Dissoziation 100 7.7 Somatoforme Dissoziation in verschiedenen niederländischen und belgischen diagnostischen Populationen 100 7.8 Besteht eine Kulturabhängigkeit der somatoformen Dissoziation? 101 7.9 Ist die somatoforme Dissoziation ein eigenständiges Konstrukt? 101 7.10 Ist die somatoforme Dissoziation ein Ergebnis von Suggestion? 102 7.11 Die somatoforme Dissoziation als Screening-Variable für dissoziative Störungen nach dem DSM-IV 103 7.12 Korreliert die somatoforme Störung mit dem berichteten Trauma? 104 7.13 Somatoforme Dissoziation und animalische Abwehrreaktionen 105 7.14 Gibt die Assoziation von somatoformer Dissoziation mit dissoziativen Störungen und Trauma auch für nichtpsychiatrische Populationen? 107 7.15 Diskussion 108 8 Konversion, Dissoziation und Somatisierung: historische Aspekte und Entwurf eines integrativen Modells 114 S. O. Hoffmann, A. Eckhardt-Henn, C. E. Scheidt 8.1 Dissoziation und Hysterie 114 8.2 Die phänomenologische Überschneidung des Hysteriekonzepts mit dem der Dissoziation 116 8.3 Die Dissoziation und der „hysterische Modus“ 117 8.4 Dissoziation und Konversion 118 8.5 Das Konzept der Somatisierung 121 8.6 Dissoziative Störung, Dissoziative Identitätsstörung, Histrionische Persönlichkeitsstörung, Borderline- Persönlichkeitsstörung und chronische Posttraumatische Belastungsstörung – ein Topf oder viele Störungen? 122 8.7 Konvergierende Modellvorstellungen zu den Konzepten von Dissoziation, Konversion und Somatisierung 125 B Klinische Perspektive 131 9 Die Dissoziative Amnesie 133 A.Hoffmann 9.1 Einleitung 133 9.2 Klassifikation 133 9.3 Klinisches Erscheinungsbild 134 8.4 Empirische Ergebnisse zur Häufigkeit 136 8.5 Häufig verwendete klinische Begriffe 137 9.6 Diagnostik 138 9.7 Verlauf und Prognose 139 9.8 Epidemiologie 139 9.9 Ätiopathogenese 139 9.10 Behandlung 140 9.11 Zusammenfassung 10 Die Dissoziative Fugue 144 S. O. Hoffmann 10.1 Historischer Hintergrund 144 10.2 Einleitung 144 10.3 Klinisches Bild und wichtige Beschreibungsdimensionen 145 10.4 Verlauf und Prognose 147 10.5 Epidemiologie 147 10.6 Ätiopathogenese 147 10.7 Behandlungsansätze 151 11 Der Dissoziative Stupor 153 C. Spitzer 11.1 Einleitung 153 11.2 Klinisches Bild und diagnostische Kriterien 153 11.3 Klassifikation und Differentialdiagnosen 155 11.4 Differentialdiagnose 157 11.5 Epidemiologie, Verlauf und Prognose 157 11.6 Ätiopathogenese 158 11.7 Behandlung 159 12 Besessenheits- und Trancezustände 161 G. Dammann 12.1 Einleitung 161 12.2 Klinisches Bild und diagnostische Kriterien 162 12.3 Diagnostische Prozesse und Untergruppen von Besessenheit 162 12.4 Klassifikation 163 12.5 Differentialdiagnosen 165 12.6 Ein Fallbeispiel 166 12.7 Epidemiologie, Verlauf und Prognose 168 12.8 Ätiopathogenese 169 12.9 Sozialpsychologische Erklärungen 169 12.10 Neurophysiologische Erklärungen und Epilepsien 170 12.11 Besessenheit im Zusammenhang mit Intoxikationen und Psychosen 171 12.12 Psychodynamische Erklärungen 171 12.13 Religiöse Erklärungen 172 12.14 Biopsychosoziales Vulnerabilitätsmodell der Besessenheit 172 12.15 Behandlung 172 13 Dissoziative Anfälle 175 A. Eckhardt-Henn, C. Spitzer 13.1 Einleitung 175 13.2 Klinisches Bild und diagnostische Kriterien 175 13.3 Klassifikation 178 13.4 Differentialdiagnose 179 13.5 Epidemiologie, Verlauf und Prognose 182 13.6 Ätiopathogenese 184 13.7 Behandlung 184 14 Das Ganser-Syndrom 188 G. Dammann 14.1 Einleitung 188 14.2 Klinisches Bild und diagnostische Kriterien 188 14.3 Diagnostische Prozesse 189 14.4 Klinische Diagnostik 189 14.5 Klassifikation 190 14.6 Differentialdiagnosen 190 14.7 Epidemiologie 191 14.8 Verlauf und Prognose 191 14.9 Ätiopathogenese 191 14.10 Behandlung 192 15 Die Dissoziative Identitätsstörung 195 U. Gast 15.1 Einleitung 195 15.2 Der aktuelle Diskurs 196 15.3 Geschichtlicher Rückblick 198 15.4 Entwicklung der Definitionskriterien 202 15.5 Atiologie 205 15.6 Prävalenz Dissoziativer Identitätsstörungen 209 15.7 Die Phänomenologie der dissoziierten Selbst-Zustände 210 15.8 Komorbidität und Differentialdiagnose 216 15.9 Zusammenfassung 218 16 Depersonalisation und Drealisation 226 A. Eckhardt-Henn, S. O. Hoffmann 16.1 Einleitung: Begriffsgeschichte 226 16.2 Klinisches Bild und diagnostische Kriterien 226 16.3 Epidemiologie, Verlauf und Prognose 229 16.4 Differentialdiagnose und Komorbidität 230 16.5 Ätiopathogenese 234 16.6 Psychoanalytische Theorien zum Verständnis der Depersonalisation 238 16.7 Therapie 244 17 Dissoziative Bewußtseinsstörungen im Kindes- und Jugendalter 249 R.Brunner, F. Resch 17.1 Einleitung 249 17.2 Definition 249 17.3 Prävalenz und Erhebungsinstrumente 250 17.4 Jugendalter 251 17.5 Kindesalter 252 17.6 Kategoriale Erhebungen 253 17.7 Klinische Phänomenologie dissoziativer Bewusstseinsstörungen des Kindes- und Jugendalters 254 17.8 Ätiopathogenese 256 17.9 Trauma und Dissoziation 257 17.10 Neurobiologie dissoziativer Störungen 258 17.11 Neurobiologie dissoziativer Bewusstseinsstörungen 259 17.12 Verlauf, Prognose und Komorbidität 260 C Dissoziative Störungen als spezifische Folge schwerer Traumatisierung 263 18 Die Trauma-Pathogenese dissoziativer Bewußtseinsstörungen: empirische Befunde 265 A. Eckhardt-Henn, S. O. Hoffmann 18.1 Dissoziation als Traumafolge 265 18.2 Prospektive Studien 267 18.3 Peritraumatische Dissoziation 268 18.4 Dissoziative Identitätsstörung 269 18.5 Resümee des Kenntnisstandes zur Rolle der peritraumatischen Dissoziation 270 18.6 Probleme der Forschung 270 19 Dissoziation als spezifische Abwehrfunktion schwerer traumatischer Erlebnisse - eine psychoanalytische Perspektive 276 A. Eckhardt-Henn 19.1 Einleitung 276 19.2 Störungen der Affektregulation 281 19.3 Entwicklungs- und selbstpsychologische Perspektiven 282 19.4 Die Zerstörung der Wirklichkeit: das Trauma in der Objektbeziehung 282 19.5 Dissoziation und Bindungsstörungen 285 19.6 Traumatische Introjektion – Trauma in der Objektbeziehung 288 19.7 Mentalisierungsfähigkeit 289 19.8 Spezifische Übertragung-Gegenübertragungskonstellationen 291 20 Dissoziation und Posttraumatische Belastungsstörung 295 A. Hoffmann 20.1 Einleitung 295 20.2 Exkurs zur diagnostischen Klassifikation 296 20.3 Die peritraumatische Dissoziation als Prädiktor einer PTBS 298 20.4 Die Störung der zentralen Informationsverarbeitung bei der PTBS 300 20.5 Zusammenfassung 301 D Diagnostik und Differenzialdiagnostik 305 21 Problem der aktuellen Klassifikation dissoziativer Störungen 307 S. O. Hoffmann, A. Eckhardt-Henn 21.1 Einleitung 307 21.2 Die Kritik an der aktuellen Operationalisierung der dissoziativen Störungen 308 22 Psychometrische Diagnostik dissoziativer Symptome und Störungen 311 C. Spitzer 22.1 Einleitung 311 22.2 Fremdbeurteilungsverfahren 311 22.3 Selbstbeurteilungsinstrumente 313 22.4 Methodische Probleme bei der Erfassung der dissoziativen Psychopathologie 316 22.5 Fazit und Ausblick 318 23 Das Strukturierte Klinische Interview für Dissoziative Störungen (SKID-D) 321 U. Gast, F. Rodewald 23.1 Einleitung 321 23.2 Besonderheiten bei der Diagnosestellung 321 23.3 Aufbau des SKID-D 322 23.4 Die Auswertung des Interviews 322 23.5 Wann ist das SKID-D indiziert? 323 23.6 Einsatzbereiche des SKID-D 323 23.7 Durchführung und Anwendung des SKID-D 324 24 Zur differenzialdiagnostischen und -therapeutischen Bedeutung diskursiver Stile bei dissoziativen versus epileptischen Patienten- ein klinisch-linguistischer Ansatz 328 M. Schöndienst 328 24.1 Einleitung 328 24.2 Risiken des Verwechselns und Möglichkeiten der Unterscheidung epileptischer und dissoziativer Anfälle 329 24.3 Besonderheiten des Beschreibens psychopathologischer Veränderungen durch Epilepsie- bzw. Dissoziation-Patienten 335 24.4Aspekte hirnfunktioneller Substrate epileptischer bzw. dissoziativer Störungen 337 24.5 Konstellationsmuster epileptischer Störungen mit dissoziativen Störungen 338 24.6 Abschließende therapeutische Überlegungen 339 Anhang: Transkriptionskonventionen 341 25 Dissoziative Identitätsstörung – eigene nosologische Entität oder Variante der Borderline-Störung? 343 B. Dulz, U. Sachsse 25.1 Einleitung 343 25.2 Dissoziative Reaktionen als Teil der Borderline-Persönlichkeitsstörung 344 25.3 Die Dissoziative Identitätsstörung als eigenständige Entität 345 25.4 DSM und ICD 347 25.5 Dissoziation und/oder Spaltung 348 25.6 Zur Therapie 348 25.7 Schlissbemerkung 351 E Therapeutische Ansätze 335 26 Phasenorientierte Behandlung komplexer dissoziativer Störungen: Die Bewältigung traumabezogener Phobien 357 K. Steele, O. van der Hart, E. R. S. Nijenhuis 26.1 Vorbemerkung 357 26.2 Die Die Theorie der strukturellen Dissoziation 359 26.3 Ursprünge der strukturellen Dissoziation 359 26.4 Die Aufrechterhaltung der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit 364 26.5 Aktuelle diagnostische Kategorien 367 26.6 Prognose und Behandlungsverlauf 369 26.7 Die phasenorientierte Behandlung der strukturellen Dissoziation 370 26.8 Behandlungsprinzipien während der phasenorientierten Therapie 371 26.9 Behandlungsphase 1: Stabilisierung und Symptomreduktion 372 26.10 Phase 2: die Behandlung der traumatischen Erinnerungen 381 26.11 Phase 3: Persönlichkeitsintegration und Rehabilitation 387 26.12 Zusammenfassung 391 27 Der psychodynamische Ansatz zur Behandlung komplexer dissoziativer Störungen 395 U. Gast 27.1 Einleitung 395 27.2 Die Behandlungsrichtlinien der ISSD im Überblick 396 27.3 Der Rahmen für psychodynamische Psychotherapie – und seine Grenzen 400 27.4 Der psychodynamische Ansatz – und seine Erweiterung 401 27.5 Phasenorientiertes Vorgehen 403 27.6 Allgemein gültige psychodynamische Techniken 411 27.7 Störungsspezifische Techniken 411 27.8 Grenzen der psychodynamischen Techniken 418 27.9 Notfallsituationen 418 27.10 Zusammenfassung und Ausblick 420 28 Konzepte und Möglichkeiten der kognitiven Verhaltenstherapie bei Dissoziation und dissoziativen Störungen 423 U. Schweiger, V. Sipos, K. G. Kahl, F. Hohagen 28.1 Dissoziative Störungen und kognitive Verhaltenstherapie 423 28.2 Theoretische Ansatzpunkte der kognitiven Verhaltenstherapie bei dissoziativen Störungen 423 28.3 Erkennung dissoziativer Phänomene in der Therapie 425 28.4 Therapeutisches Vorgehen der kognitiven Verhaltenstherapie bei dissoziativen Symptomen und Störungen 426 28.5 Studien zu Effekten verhaltenstherapeutischer Therapieverfahren aud dissoziative Symptome 434 28.6 Zusammenfassung 434 29 EMDR - ein Verfahren zur Behandlung dissoziativer Störungen in der Folge schwerer Traumatisierungen 436 M. Sack, F. Lamprecht 29.1 Einleitung 436 29.2 Allgemeine Therapieprinzipien des EMDR 437 29.3 Besonderheiten bei der EMDR-Behandlung von Patienten mit dissoziativen Störungen 439 29.4 Fallbeispiele 441 29.5 Risiken und Gefahren 443 29.6 Fazit 445 30 Die psychopharmakologische Therapie dissoziativer Bewußtseinsstörungen 447 A. Eckhardt-Henn 30.1 Einleitung 447 30.2 Opiat-Antagonisten (Naltrexon) 447 30.3 Atypische Neuroleptika 448 30.4 Antidepressiva 449 31 Aktuelle Kontroversen: die False-Memory-Debatte 453 A. Eckhardt-Henn, S. O. Hoffmann 31.1 Einleitung 453 31.2 Normales Vergessen uns Persistenz von Erinnerungen 456 31.3 Implizites und explizites Gedächtnis 457 31.4 Infantile Amnesie und Dissoziative Amnesie 459 31.5 Suggestibilität 461 31.6 Historische versus Narrative Wahrheit: psychoanalytische Perspektiven 464 31.7 Abschließende Bemerkung 466 |
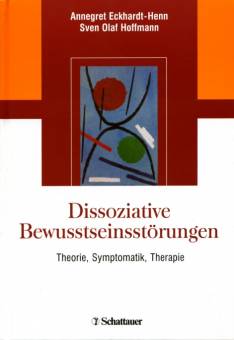
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen