|
|
|
Umschlagtext
Der Bauernkrieg bildet neben der Reformation die Schwelle zur Neuzeit. Anders als die Reformatoren aber können seine Protagonisten ihre teilweise modern klingenden Forderungen nicht durchsetzen. Die Erhebung der Bauern wird blutig niedergeschlagen.
Der Bauernkrieg wurde immer auch ideologisch interpretiert - schon zeitgenössisch war er, so Thomas Kaufmann, vor allem ein Medienereignis. Durch umfassende Quellenstudien entlarvt Kaufmann ideologische Verzerrungen und präsentiert eine fesselnde Neuinterpretation dieses bedeutenden Ereignisses. Mit Leidenschaft und Expertise öffnet er den Leserinnen und Lesern einen völlig neuen Blick auf den Bauernkrieg. Eine Analyse, die nicht nur Vergangenes beleuchtet, sondern auch unsere Sichtweise auf die Gegenwart und Zukunft neu formt. Prof. Dr. Dr. theol. h.c. Dr. phil. h.c. Thomas Kaufmann, geb. 1962, Inhaber des Lehrstuhls für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen. 2020 erhielt er den Leibniz-Preis. Rezension
Im Jahr 2025 jährt sich der 500. Jahrestag des Deutschen Bauernkriegs, diesem fundamentalen Ereignis der deutschen Geschichte, - das erklärt eine Reihe neuer Publikationen wie dieser, die den Bauernkrieg wesentlich als Medienereignis begreift: Der Bauernkrieg wurde immer auch ideologisch interpretiert - schon zeitgenössisch war er, so Thomas Kaufmann, vor allem ein Medienereignis. Bauernaufstände oder Bauernkriege fanden vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in Europa häufig statt. Im deutschen Sprachraum ist aber der sogenannte Deutsche Bauernkrieg mit verschiedenen Aufständen im Jahr 1525 gemeint, gefördert durch die in den 1520er Jahren einsetzende Reformationsbewegung. Als Deutscher Bauernkrieg (oder Revolution des gemeinen Mannes) wird die Gesamtheit der Aufstände von Bauern, Städtern und Bergleuten bezeichnet, die 1524 aus ökonomischen und religiösen Gründen in weiten Teilen Thüringens, Sachsens und im süddeutschen Raum ausbrachen: ein Geschehen, das zur gleichen Zeit fast das gesamte Reich südlich einer Linie vom Pfälzer Wald im Westen über den Odenwald, den Spessart und die Rhön bis hinauf nach Thüringen und bis hinunter nach Salzburg und Tirol inklusive des italienischsprachigen Hochstifts Trient erfasste. Die Aufstände wurden blutig niedergeschlagen.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Eine fulminante Neuinterpretation des Bauernkriegs "Wer sich für das heutige Deutschland interessiert, wird Kaufmanns Buch lesen müssen." Lyndal Roper Pressestimmen: "Thomas Kaufmann legt eine exzellente Darstellung der Geschehnisse des Bauernkriegs vor." Markus Friedrich, FAS - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 12.10.2024 "Die ambivalenten, konfessionell ausgerichteten und letztlich politisch-ideologisch gefärbten Urteile über den Bauernkrieg werden von Kaufmann anhand publizistischer Zeugnisse bis in die jüngere Vergangenheit untersucht." Marion Damaschke, Neues Deutschland, 08.10.2024 Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen, Siglen und Zitierweise 9
Einleitende Hinweise 15 Kapitel 1: Lange Schatten — Zur Geschichte der Deutung und Erforschung des Bauernkrieges 23 Zeitgenössische Deutungen — Luthers Sicht des Bauernkrieges 23 ,Altgläubige` Perspektiven auf den Bauernkrieg 28 Luther, Müntzer und der Bauernkrieg in der Sicht der Parteigänger Luthers 32 Deutungen des Bauernkriegs im konfessionellen Zeitalter 35 Neue Deutungsperspektiven auf den Bauernkrieg in Pietismus und Aufklärung 41 Bauernkriegshistoriographie als Geschichtspolitik — das 19. Jahrhundert 46 Forschungstendenzen im 20. Jahrhundert 50 Kapitel 2: „Bauernkriege" vor dem Bauernkrieg? — Bewegte Bauernbilder in unruhigen Zeiten 55 Zeichen der Zeit 56 Erwartungen für das Jahr 1524 62 Gesellschaftsentwürfe 71 Bauernbilder in literarischen Texten 84 Der „Karsthans" und seine Avatare 97 Bauernbilder in der Druckgraphik 109 Das publizistische Echo der vorreformatorischen bäuerlichen Aufstände 125 Bilanzierende Überlegungen 134 Kapitel 3: Die Publizistik des Bauernkrieges — der Bauernkrieg in der Publizistik 137 Bauernaufstände und Bauernkrieg 137 Bäuerliche Kommunikationskultur und Bauernkrieg 141 Die „Zwölf Artikel" als publizistisches Phänomen 146 Eine stadtbürgerliche Adaption der „Zwölf Artikel": das Beispiel Frankfurt/M. 159 „Handlung und Artikel" — die sogenannte „Memminger Bundesordnung", ein Schritt zur Tat 162 Der Widerspruch der Wittenberger Reformatoren gegen die „Zwölf Artikel" und die „Memminger Bundesordnung" 172 Anonyme Agitation im Geist der Revolte: Die Flugschrift „An die Versammlung gemayner Pawerschafft" 183 Publizistische Deeskalationen — Modelle gewaltfreien Konfliktaustrags 192 Wider den Wittenberger Bauernschlächter — Eine publizistische Kampagne 200 Der publizistische Feldzug der Wittenberger gegen ihre Kritiker und die literarische Vernichtung Thomas Müntzers 215 Die Konsolidierung der lutherischen politischen Ethik infolge des Bauernkriegs 229 Die Erfindung und Wertung des „Bauernkrieges" im Lied 235 Bilanzierende Überlegungen 245 Kapitel 4: Verarbeitungen des Bauernkriegs — Impressionen und Perspektiven 249 Das ,Ereignis` Bauernkrieg — eine historische Zäsur? 249 Der schreckliche, der verborgene Gott — die radikale Theologie von Luthers Schrift „De servo arbitrio" (Vom unfreien Willen) 253 Ordnung stiften nach Wittenberger Art 260 Klandestine Resistenzen — Bauernkriegsveteranen der „radikalen Reformation" 268 „Von der newen wandlung eynes christlichen Lebens" — Nachkriegshoffnungen 282 Neue Bauernbilder in der druckgraphischen Kunst — einige Impressionen 291 Heldendämmerung — Abschied von sinnstiftenden Narrativen 318 Dank 327 Anhang 329 Anmerkungen 329 Quellen- und Literaturverzeichnis 505 Abbildungsnachweis 527 Register 531 |
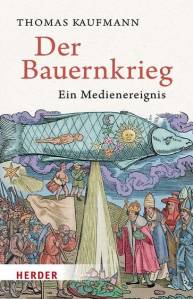
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen