|
|
|
Umschlagtext
Die letzte handbuchartige Darstellung der Epoche erschien 1931 in einer damals bereits überarbeiteten Gestalt. Ernst Koch verfolgt nun einen Ansatz, der das in den letzten zwei Jahrzehnten diskutierte Modell der "Konfessionalisierung" aufnimmt: die durchgreifende Umgestaltung der Gesellschaft, bezogen auf das Territorium, maßgeblich getragen von religiösen Kräften, die sich als Konfessionen verstanden und formierten.
Die Darstellung beschränkt sich nicht auf die deutsche Kirchengeschichte, sondern bezieht andere Teile Europas und die Expansion des römisch-katholischen Christentums nach Übersee in die Nachzeichnung des Konfessionalisierungsprozesses ein. Danach wendet sie sich dem Alten Reich zu. Ein eigenes Kapitel befaßt sich mit den der Konfessionalisierung gegenläufigen Tendenzen und einem Ausblick auf die Folgezeit. Ernst Koch, Jahrgang 1930, habilitierter Kirchenhistoriker und emeritierter Pfarrer, war unter anderem Dozent für Kirchengeschichte und Philosophie am Theologischen Seminar (später Kirchliche Hochschule) Leipzig. Rezension
Nach dem „Augsburger Religionsfrieden“ 1555 prägen sich nach der vollzogenen Reformation die Konfessionen aus, grenzen sich voneinander ab und bekämpfen, ja bekriegen sich. Wir sprechen vom konfessionellen Zeitalter oder auch von der Gegenreformation. In dieser Epoche formt sich Europa konfessionell aus, die katholische Kirche hat sich selbst reformiert (Konzil von Trient) und nimmt den Kampf mit dem Protestantismus auf (Jesuiten). Der Protestantismus differenziert sich aus und erhält mit dem Calvinismus neben dem Luthertum eine bedeutsame Ausformung, die auch jenseits der Grenzen Europas von elementarem Einfluß sein wird. Der 30-jährige Krieg 1618-1648 läutet letztlich das Ende des konfessionellen Zeitalters ein. In diese ungemein spannende und prägende Epoche europäischer Geschichte führt dieser Band kompetent, gut lesbar und gut ausgestattet mit Zeittafel, Personenregister und differenziertem Literaturverzeichnis gelungen ein. Die Aufmachung der noch zu DDR-Zeiten entstandenen Reihe unterscheidet sich auch formal nicht mehr von westdeutschen Verlagen.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 11
Quellen- und Literaturverzeichnis 12 Einführung und Orientierung 48 Kapitel 1: Die Konfessionalisierung des römischen Katholizismus 50 A. Spanien als religiöses Zentrum des 16. und 17. Jahrhunderts 50 1. Der Aufstieg Spaniens im 16. Jahrhundert 50 2. König Philipp II. und die Kirche 51 3. Kirchliches Leben und Frömmigkeit 53 3.1. Neuaufbrüche der Frömmigkeit 53 3.2. Die spanische Inquisition als Instrument nationaler Kirchlichkeit 54 3.3. Das Theater im Dienst der Propagierung kirchlicher Lehre 57 3.4. Neue Orden 58 3.5. Spanische Mystik 59 4. Theologie 62 4.1. Erneuerung der Theologie 62 4.2. Methodologische Neuorientierung 62 4.3. Die Auseinandersetzungen um die Gnadenlehre 64 4.4. Grundfragen theologischer Ethik 65 5. Bilanz: Spaniens Bedeutung für die Kirche der frühen Neuzeit 66 B. Das Papsttum 68 1. Die Herausforderungen der Epoche 68 2. Pius V. 69 3. Gregor XIII. 71 4. Sixtus V. 72 5. Clemens VIII. 74 6. Paul V. 74 7. Gregor XV. 76 8. Urban VIII. 76 C.Die Rückkehr Polens zur römisch-katholischen Kirche 77 1. Die Struktur der polnischen Gesellschaft und die Reformation 77 2. Die Verschiebung der Kräfteverhältnisse nach 1560 78 3. Maßnahmen zur Rückgewinnung Polens für die römisch-katholische Kirche 79 4. Frömmigkeit, Theologie und kirchliches Leben 81 D. Reform und Gegenreformation im Reich bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts 82 1. Die Rezeption der Beschlüsse des Konzils von Trient und ihre Probleme 82 1.1.Voraussetzungen 82 1.2. Bemühungen der Kurie um die Durchführung der tridentinischen Reform im Reich 83 1.3. Maßnahmen zur Verbesserung der Priesterausbildung 84 2. Tragende politische Kräfte und Muster der Gegenreformation 86 2.1. Einheit von Familien-, Landes-, Reichs- und Religionspolitik: Bayern 86 2.2. Religionspolitik im Rahmen von Territorial- und Reichspolitik: Julius Echter von Mespelbrunn und das Hochstift Würzburg 90 3. Reform und Gegenreformation in Innerösterreich und den habsburgischen Erblanden 92 4. Ergebnisse und Probleme 95 E. Kirchliches Leben, Frömmigkeit und Theologie 98 1. Folgen der Reform für die Gestalt der Meßfeier und des liturgischen Lebens 98 2. Bemühungen um die Katechese 101 3. Jesuitentheater 102 4. Neue Aspekte überkommener Frömmigkeit 103 4.1. Marianische Frömmigkeit 103 4.2. Passionsfrömmigkeit und Eucharistie 104 4.3. Bußfrömmigkeit 105 4.4. Reliquienverehrung und Wallfahrten 106 5. Reform und Neugestaltung des Ordenslebens 108 6. Bruderschaften und Kongregationen 110 7. Neue Heilige 111 8. Erfolge und Mißerfolge 113 Kapitel 2: Der Protestantismus in Westeuropa, Skandinavien, Ost- und Südosteuropa 115 A. Die Eidgenossenschaft 115 1. Die Situation des Protestantismus im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts 115 2. Ausprägungen reformierter Theologie zwischen 1560 und 1675 117 2.1. Basel 117 2.2. Genf 119 2.3. Zürich 121 2.4. Bern 121 2.5. Politische Ethik 122 2.6. Föderaltheologie 123 2.7. Die Helvetische Konsensusformel von 1675 124 3. Frömmigkeit und kirchliches Leben 126 3.1. Auseinandersetzungen mit überkommener Frömmigkeit 126 3.2. Gottesdienstliches Leben 127 3.3. Geistliche Dramen und ihre Kritik 129 3.4. Die Sonderrolle Basels 129 3.5. Kirchenzucht 130 B.Frankreich 132 1. Der französische Protestantismus um 1560 132 2. Die Religionskriege zwischen 1559 und 1598 133 3. Das Edikt von Nantes 1598 137 4. Hugenottische Frömmigkeit und Theologie 138 5. Der Zusammenstoß mit dem erstarkten römischen Katholizismus Frankreichs 141 C. Die Niederlande 145 1. Die Situation um 1560 und die ersten Konflikte mit der spanischen Herrschaft 145 2. Die Protestanten im Widerstand und Aufstand 148 3. Frömmigkeit und Theologie 150 3.1. Der politisch-gesellschaftliche Rahmen 150 3.2. Calvinismus und Arminianismus 152 3.3. Die Dordrechter Nationalsynode 1618/19 153 3.4. Kirchliches Leben 154 3.5. Dissentierende Gruppen 156 D.England, Schottland und Irland 158 1. England und der Weg der Kirche von England unter Königin Elisabeth I. 158 2. Der Puritanismus 161 2.1. Wurzeln und Ziele 161 2.2. Konflikte mit dem Staatskirchentum und Formierung der Bewegung 162 3. Die presbyterianische Bewegung 163 4. Die Durchführung der Reformation in Schottland 164 5. Die Radikalisierung des Konflikts zwischen Staatskirche und Puritanismus in England 166 6. Die kirchlich-religiöse Entwicklung in England nach 1603 168 6.1. Die Lage beim Regierungsantritt Jakobs I. 168 6.2. Die Polarisierung zwischen königlicher Kirchenpolitik und puritanischer Bewegung 170 6.3. Revolution und Bürgerkrieg 173 6.4. Der religiöse Independentismus und die Ära Oliver Cromwells 175 7. Die Wiederherstellung des Königtums und ihre Auswirkungen auf die Kirche 179 8. Die Gefährdung der Ergebnisse der englischen Reformation unter Jakob II. und die Revolution von 1688 180 9. Die englischen Revolutionen und ihre Bedeutung für die Christenheit 182 10. Der Sonderweg Irlands 183 E.Skandinavien 184 1. König, Kirche und Obrigkeit in Schweden bis zum Regierungsantritt Gustav Adolfs 184 2. Die Kirche und das Königtum Schwedens nach 1611 189 2.1. Der reichspolitische Rahmen und Königin Christina 189 2.2. Bischöfliche Kirchenleitung 189 2.3. Kirchliches Leben 190 2.4. Theologie 192 3. Dänemark, Norwegen 193 F. Osteuropa, Südosteuropa, Österreich 197 1. Die innere Entwicklung des Protestantismus in Polen 197 2. Der politische Weg Ungarns bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts 199 3. Die Konfessionen in Siebenbürgen zwischen 1560 und 1650 200 4. Kirchliches Leben, Theologie und Frömmigkeit im protestantischen Ungarn 202 5. Der Unitarismus 204 6. Der Protestantismus in Innerösterreich und den habsburgischen Erblanden 207 Kapitel 3: Die Kirchen der Reformation in Deutschland 211 A. Die Situation um 1560 211 B. Der Einigungsprozeß unter den Anhängern der Wittenberger Reformation 213 1. Die Ausgangssituation 213 2. Der Neuansatz zur Einigung um 1570 und seine Folgen 214 3. Die Ausschaltung des Philippismus in Kursachsen 214 4. Die Konkordienformel von 1577 215 5. Das Konkordienbuch von 1580 216 6. Widersprüche gegen den Einigungsprozeß 217 C. Lutherische gelehrte Theologie 218 1. Die Universitäten und die Theologie 218 2. Philosophische Grundlagen 222 3. Das Selbstverständnis von Theologie 224 4. Theologisches Studium 226 5. Wegphasen 228 6. Thematische Schwerpunkte 229 6.1. Die Auseinandersetzungen im Vorfeld der Konkordienformel 229 6.2. Abendmahl und Christologie 231 6.3. Erwählung 235 6.4. Probleme des Spiritualismus 236 6.5. Rechtfertigung und unio mystica 238 D.Frömmigkeit und kirchliches Leben im Luthertum 240 1. Kirchenordnung und Verfassung 240 2. Der Gottesdienst 242 2.1. Der Kirchenraum 242 2.2. Gottesdienstpraxis 244 3. Amtsethos 246 4. Buße, Beichte und Kirchenzucht 247 5. Umgang mit Sterben und Tod 250 6. Leben angesichts des nahenden Weltendes 251 7. Passionsfrömmigkeit 253 8. Sakramentsfrömmigkeit 254 9. Bücher als Medien 255 10. Individualisierung und Sensualisierung 257 11. Johann Arndt und das „Wahre Christentum" 258 E. Die reformierten Territorien und die sogenannte „Zweite Reformation" 259 1. Übersicht 259 2. Konfessionsbildende Vorgänge in einzelnen Territorien 261 2.1. Kurpfalz 261 2.2. Hessen-Kassel 263 2.3. Kurbrandenburg 266 2.4. Ein gescheiterter Versuch: Kursachsen 269 2.5. Rückblick 271 F. Reformierte Theologie und Frömmigkeit 273 1. Die sogenannte deutschreformierte Theologie und ihre Zentren 273 2. Konfessionelle Akzente 276 2.1. Sakramentslehre und Christologie 276 2.2. Prädestination 278 2.3. Föderaltheologie 279 2.4. Politische Ethik 281 3. Innerreformierte Spannungen 282 3.1. Rechtfertigung und Ethik 282 3.2. Die Konzeption der Kirchenzucht 283 3.3. Abendmahl 285 4. Reformierte Bekenntnisschriften 286 4.1. Der Heidelberger Katechismus 286 4.2. Die Confessio Fidei des Kurfürsten Johann Sigismund 287 5. Flüchtlingsgemeinden 288 6. Die Synode von Emden 1571 290 7. Der gottesdienstlich-rituelle Bereich und die Katechese 291 7.1. Kirchenräume 291 7.2. Eiturgische Vollzüge 293 7.3. Gesang und Musik 294 7.4. Zeiten für Gottesdienst und Katechese 295 8. Die Praxis der Presbyterien 296 9. Disziplinierung des Eebens 299 10. Zukunftserwartungen und Eschatologie 300 G.Irenik und konfessionelle Identität 301 1. Reformierte Konfession und Irenik 301 2. Georg Calixt und der Synkretismus 304 H. Zwischenkonfessionelle Beziehungen und Mischkonfessionalität 306 1. Kulturelle Berührungen und juristische Probleme 306 2. Theologische und geistliche Aspekte 309 3. Ostfriesland als Sonderfall 312 I. Christen und Juden 313 1. Situation und Rahmenbedingungen 313 2. Christliche Hebraistik und Judenmission 315 K.Mission 317 Kapitel 4: Der Dreißigjährige Krieg 320 A.Das Vorfeld 320 B. Ausbruch und verlaufsgeschichtliche Wendepunkte 322 C.Theologische Positionen und Deutungen 325 D.Der Friedensschluß 328 1. Die Regelungen von 1648 328 2. Theologische Stellungnahmen 331 3. Die Friedensfeste 332 Kapitel 5: Ausblick 333 A.Folgen des Dreißigjährigen Krieges 333 B. Veränderungen in Philosophie und Religiosität 334 1. Neue Ansätze in der Philosophie 334 2. Veränderungen in der religiösen Wahrnehmung 335 C. Programme für eine Reform der Welt 336 1. Johann Valentin Andreae 336 2. Johann Amos Comenius 337 D. Anzeichen und Wurzeln konfessioneller Indifferenz 339 1. Die Wiederkehr platonischer Philosophie und ihre Folgen 339 2. Spiritualistische Traditionen 340 3. Alchemie 342 4. Umrisse einer alternativen Religiosität 343 Zeittafel 346 Personenregister 349 Weitere Titel aus der Reihe Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen |
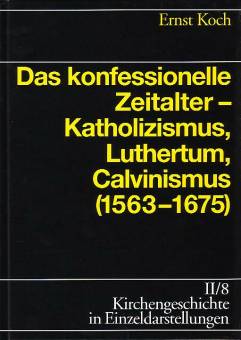
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen