|
|
|
Umschlagtext
Charismatische Bewegungen in der katholischen Kirche
Das Buch beschäftigt sich mit charismatisch-evangelikalen Christen, die sich der katholischen Kirche zugehörig fühlen. Sie organisieren sich locker in Bewegungen und Initiativen, die wachsen und vor allem junge Menschen anziehen. Bischöfe und kirchliche Verantwortliche bauen zunehmend auf diese neuen Bewegungen, während einige FachtheologInnen davor warnen. Hier zeichnet sich eine Polarisierung ab, die niemandem hilft. Um sie zu überwinden, greift der Autor auf die Anfänge der evangelikalen, pfingstlichen und charismatischen Bewegungen zurück und führt ein sorgsames Gespräch mit dem »Mission Manifest« und dem kritischen Band »Einfach nur Jesus?« Er gibt Proben einer mystagogischen Theologie, die tiefer in das beglückende und zugleich erschütternde Geheimnis Gottes hineinführt. Er zeigt, dass ein theologisch gebildeter Verstand dafür nicht Hindernis, sondern unentbehrliche Hilfe ist. Ein Buch für charismatisch-evangelikale Katholiken und für jene, die sich mit diesem neuen Trend schwertun. Willibald Sandler, geb. 1962, Dr. theol., ao.-Prof. für Dogmatik am Institut für Systematische Theologie der Universität Innsbruck. Arbeitsschwerpunkte: dramatische Theologie, Soteriologie, Theologie der charismatischen und pentekostalen Strömungen. Rezension
Geistliche Aufbruchsbewegungen und akademische Theologie sind im deutschsprachigen Raum noch immer weitgehend von gegenseitigem Ignorieren geprägt. Hier steuert das vorliegende Buch gegen. Theologie als ein Dienst an der Verkündigung des Evangeliums in den Zeichen der Zeit ist ebenso den Kriterien der vernünftigen Begründung wie jener Unterscheidung der Geister verpflichtet, die auch den vorrationalen Bedingungen des menschlichen Lebens und Seins nachzuspüren sucht. Vernunft ohne spirituelle Wahrnehmung ist leer, spirituelle Erfahrung ohne Vernunft aber wird letzten Endes immer um sich selbst kreisen. Die vorliegende Arbeit von Willibald Sandler könnte zu einer Brücke werden, die ein wechselseitiges Verstehen und Lernen ermöglicht zwischen akademischer Theologie und der charismatischen und pentekostalen Bewegung im Christentum. Die vorliegende Arbeit ist auch ein Beitrag zu einer innerchristlichen Ökumene – quer zu den alten Konfessionstraditionen.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Geleitwort von Dr. Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg 5
Geleitwort von Univ.-Prof. Mag. Dr. Roman Siebenrock, Universität Innsbruck 7 Abkürzungen 22 Teil I: Herausforderung CEK: Charismatisch, evangelikal und katholisch 23 1. Das Mission Manifest (2018): ein CEK-Hotspot 25 1.1 Eine ökumenische Präsentation 25 1.2 Kontroverse Reaktionen auf das Mission Manifest 28 1.3 Ein schwindelerregendes Arsenal an Kritik 28 2. Evangelikaler Katholizismus? 31 2.1 Die Moderne bekehren: Evangelikaler Katholizismus I (nach John Allen) 31 2.2 Freundschaft mit Christus oder Gegenkultur? Evangelikaler Katholizismus II (nach George Weigel) 33 3. Anliegen und Plan für das Buch 35 3.1 Was ist evangelikal, pfingstlich, charismatisch? – In exemplarisch-geschichtlicher Perspektive 35 Fortlaufend hineingewoben: Reflexionskapitel zur theologischen Unterscheidung – mit einer biblisch orientierten „Theologie des Kairos“ 36 3.2 Teil II: Evangelikal … 37 3.3 Teil III. Charismatisch … 39 3.4 Teil IV. … und Katholisch 40 3.5 Teil V. Charismatisch-evangelikal-katholisch im Mission Manifest: Thesen, Kritik und Unterscheidung 41 3.6 Für wen das Buch geschrieben ist und wie man es lesen kann 42 Teil II: Evangelikal 43 4. Was ist eigentlich Evangelikal? Annäherungen an ein unübersichtliches Phänomen 43 4.1 „Evangelikal“: Evangeliumsgemäß oder freikirchlich? 43 4.2 „Quadrilateral“: Vier inhaltliche Seiten der evangelikalen Bewegung 44 4.3 Evangelikale Identität: positiv bezogen oder negativ abgrenzend? 46 4.4 Evangelikal bedeutet „Erwecklich“ 47 4.5 Positiv bezogen oder negativ abgrenzend? Die Gefahr einer subtilen Pervertierung 48 5. Leben aus der Erfahrung von Rechtfertigung: Pietismus und die Herrnhuter Brüdergemeine 51 5.1 Reformation als Ausgangspunkt 51 5.2 Pietismus als protestantische Erneuerungsbewegung 52 5.3 Ein beispielgebender pietistischer Bekehrungsbericht: August Hermann Francke 52 5.4 Kristallisation von Erweckung: Ludwig von Zinzendorf und die Herrnhuter Brüderbewegung 54 Die Entstehung von Herrnhut 54 Durchbruch und eine kleine Erweckung – auch unter Kindern 55 Auswirkungen der Erweckung 56 5.5 Pietistisches Sündenverständnis, Sünde der Welt und der Kairos ihrer Durchbrechung 57 Kindererweckungen? 57 Das Ungenügen eines bloß moralischen Sündenverständnisses 58 Erkenntnis einer tief verborgenen „Sünde der Welt“ im eigenen Inneren 58 Katholische Erbsündenlehre als ‚Gegengift‘ gegen Moralismus 60 Der Kairos eines himmlischen Gleichgewichts als Befreiung zum Tun des Guten 60 6. Heiligung mit erwärmtem Herzen: John Wesley und die Anfänge des Methodismus 62 6.1 Wesleys frühes Ringen um Heiligung: Kampf und Krise 62 6.2 Zu einfach um wahr zu sein? Erfahrung von Heilsgewissheit „in einem Augenblick“ 63 6.3 „Ich fühlte mein Herz seltsam erwärmt“: Wesleys Aldersgate-Erfahrung und ihre Auswirkungen 64 6.4 Wesleys Lehre von einer vollständigen Heiligung 65 6.5 Übertriebener christlicher Perfektionismus bei Wesley? 66 6.6 Der Unterschied von Wesleys Methodismus zu den Calvinisten und Puritanern 67 7. Puritanische Erneuerung: Jonathan Edwards und die Erste Große Erweckung 68 7.1 Puritanische Erneuerung 68 7.2 Erweckungsfieber: die Erste Große Erweckung (Neuengland 1734–1744) 70 7.3 „Ein Empfinden der Herrlichkeit Gottes“: Die Bekehrungserfahrung von Jonathan Edwards 71 7.4 Edwards’ berühmt-berüchtigte Erweckungspredigt: „Sünder in den Händen eines zornigen Gottes“ 72 7.5 „Jetzt ist noch die Zeit …“. Gerichtspredigt als Warnung vor dem versäumten Kairos 73 Katholisch: näher beim Arminianismus als beim Calvinismus? 77 7.6 Einen Kairos ansagen. Das gefährliche Instrument einer prophetischen Gerichtspredigt 77 7.7 Kontroversen, Exzesse und theologische Unterscheidung (Jonathan Edwards) 79 7.8 Falsche Bekehrung? Wesley gegen Edwards’ Unterscheidungslehre 82 8. Erweckungstechniken und christlicher Perfektionismus: Von der Zweiten Großen Erweckung zur Heiligungsbewegung 83 8.1 Bekehrung und soziales Engagement: Charles Finneys Erweckungsmethoden 83 8.2 Heiligungsbewegung und Perfektionismus der Heiligung 84 8.3 Unterscheidungen zum christlichen Perfektionismus und zu Erweckungstechniken 86 Der „kürzere Weg zur Heiligung“ verspricht zu viel 86 Gefahren der Lehre von einer vollständigen Heiligung 86 Christlicher Perfektionismus und die Überschätzung von Techniken zur Erweckung 88 8.4 Von der Heiligungs- zur Heilungsbewegung 89 8.5 Rückschlag: Heilsaktivismus und soziale Krise 89 9. Endzeitliche Erwartungen und evangelikaler Fundamentalismus 90 9.1 Die Bedeutung von endzeitlichen Erwartungen für die evangelikale Bewegung 90 Millenarismus 91 Postmillenarismus 91 Prämillenarismus 91 9.2 Eine Wissenschaft des Übernatürlichen? Evangelikaler Fundamentalismus in Rivalität mit dem neuen wissenschaftlichen Denken 93 9.3 Dispensationalismus: Ein rationalistisches System der Bibelauslegung und apokalyptischen Zukunftsdeutung 96 9.4 Eschatologische Naherwartung und Kairos-Erfahrung 97 Die Evangelikale Naherwartung entspricht Jesu Mahnung, jederzeit wachsam zu sein, besser, aber nicht genug 97 Eine Wachsamkeit, die sich auf den nächsten Kairos bezieht 98 Wachsam für Kairos-Ereignisse und Zeichen der Zeit, die vielen zugleich gelten 99 Teil III Charismatisch 101 10. Was ist eigentlich „Charismatisch“? – Biblisches Verständnis 101 10.1 Im Grunde ist jeder Christ charismatisch 101 10.2 Ein weites Verständnis von Charismen 102 10.3 Das „demokratisierte“ Charisma der Prophetie 103 10.4 „Wort der Erkenntnis“ als außerordentliches Charisma 104 10.5 Außerordentliche Charismen und das Problem mit manchen „Charismatikern“ 106 10.6 Unterscheidung der Geister 107 Ein Charisma für alle Christen 107 Kriterien für eine Unterscheidung der Geister 108 10.7 Charismen: Gnadengaben zum Aufbau der Kirche 111 10.8 Das Charisma des Sprachengebets 111 11. Topeka und Azusa Street: Die Anfänge der Pfingstbewegung in den USA 113 11.1 Drei sehr unterschiedliche Erzählungen 113 11.2 Erste Perspektive: Eine reizvolle Gründungserzählung 114 11.3 Zweite Perspektive: Eine ziemlich fragwürdige Geschichte – Der Anfang der Pfingstbewegung in Topeka (1901) 115 11.4 Dritte Perspektive: Wie Gott auf krummen Zeilen gerade schreibt – Topeka und die Azusa-Street-Erweckung in Los Angeles (1906–1909) 117 11.5 Wachstum und Spaltung der Pfingstbewegung 120 11.6 Das problematische Heilungsverständnis der „Vollendetes-Werk-Pfingstler“ 121 11.7 Heilung durch Glauben: eine Frage des Erlösungsverständnisses 122 11.8 Die Eigenart der Geisttaufe im Zusammenhang mit Bekehrung und Heiligung 124 Die Bedeutung des Heiligen Geistes im Zusammenhang von Jesu erlösender Selbsthingabe am Kreuz 125 Das Sakrament der Taufe als eine Bitte um Erlösung im Namen Jesu, der sichere Erhörung zugesagt ist 126 Glaubende Annahme Christi und seiner Erlösung als „erstes Werk der Gnade“ 126 Heiligung als eigene Erfahrung (zweites Werk der Gnade) oder als Teil des ersten Werks der Gnade? 126 Was ist das Unterscheidende der pfingstlichen Erfahrung, im Heiligen Geist getauft zu werden? 128 12. Anfang und Katastrophe der Pfingstbewegung in Deutschland 130 12.1 Ein pfingstlicher Aufbruch entgleist: Kassel 1907 130 12.2 Evangelikale Verteufelung der Pfingstbewegung: Die Berliner Erklärung (1909) 131 12.3 Was war schiefgelaufen? 133 13. „Zweite Welle des Heiligen Geistes“: Pfingstliche Erneuerung in den historischen Kirchen 135 13.1 Pfingstlicher Neuaufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg 136 13.2 Einige Zeugnisse 137 13.3 Die Eigenart dieser charismatischen Erfahrungen 140 13.4 Dramatik des geistlichen Wachstums: John Sherrills „Sie sprachen in anderen Zungen“ 141 13.5 Zungenrede: ein Sprachenwunder? 144 13.6 Charismatisch und Sozial: Übernatürliches Mitleid als Geistesgabe 147 13.7 Geisttaufe für Suchtkranke in Jugendgangs: David Wilkersons „Das Kreuz und die Messerhelden“ 148 14. Im freien Spiel der Kräfte: Neocharismatische Bewegungen 152 14.1 Dritte Welle des Heiligen Geistes: Evangelikale lernen von Pfingstlern 152 Eine neue evangelikale Strategie in der säkularisierten „westlichen Welt“ 153 „Abschied vom aufgeklärten Christentum“, aber immer noch im Bann eines „aufgeklärten“ Rationalismus und Empirismus 154 Begrenzte Übernahme von Pfingstlich-Charismatischem durch Evangelikale 155 14.2 Power-Evangelisierung mit John Wimber 156 Vorbereitung auf Umwegen 156 Eine Erweckung als Durchbruch 157 Vollmächtige Evangelisation (Power-Evangelism) 158 14.3 „Dritte Welle“ und neocharismatische Bewegungen 158 14.4 Frühe Wurzeln der neocharismatischen Bewegungen: Die Spätregenbewegung (1950er Jahre) 159 Eine Erweckung unter Studenten 159 Triumphalistisches Kirchenverständnis 160 Triumphalistische Naherwartung 161 Restaurationismus: Überbietende Wiederherstellung der Urkirche 161 Die Bewegung wird als häretisch zurückgewiesen 162 Triumphalistische Umpolung einer pessimistischen Eschatologie 162 14.5 Die Prophetenbewegung (1989–1992) 163 Paul Cain und John Wimber 163 Unterscheidung der Geister in Bezug auf Prophetien: ein folgenschwerer Fehler 164 14.6 Das internationale Gebetshaus in Kansas City (Mike Bickle) 165 Die Attraktivität von Mike Bickles Gebetshausmodell 166 Drei Ansätze zur Beurteilung der Gebetshausbewegung aus Kansas 166 14.7 Der Toronto-Segen (1994) 168 Die Soaking-Bewegung 169 Erfrischung, Erneuerung und Erweckung 169 14.8 Geistliche Kriegführung 171 14.9 Wort-des-Glaubens-Bewegung und Wohlstandsevangelium 172 14.10 Den Himmel auf die Erde herabholen? (Bill Johnson) 173 „Über-verwirklichte“ Eschatologie? 173 Welcher „Appetit“ ist gottgegeben? – Eine Frage der Unterscheidung der Geister 175 Der Kurzschluss der Wort-des-Glaubens-Lehre 177 Teil IV … und katholisch 179 15. Was ist eigentlich „Katholisch“? 179 15.1 „Allumfassend“: „Katholisch“ ist kein Abgrenzungsbegriff 179 Eine Wirklichkeit, die es nicht nötig hat, sich entgegenzusetzen (Henri de Lubac) 179 Inklusives Verständnis von „Katholisch“ im Zweiten Vatikanischen Konzil 180 15.2 Die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche 181 Apostolische Kirche? 181 Das apostolische Papstamt: Handlungsfähigkeit, Entscheidungsmacht und doch offen für Erneuerung 182 Heilige Kirche?? 182 16. „Sakramental“ als Wesenmerkmal der katholischen Kirche 183 16.1 Sakramente: heilige Zeichen für das anbrechende Gottesreich 183 16.2 Kirche ist wesentlich sakramental 184 16.3 Pervertierte Sakramentalität 185 16.4 Evangelikal, charismatisch und sakramental 187 Sakramente als Bitten im Namen Jesu, für die er sichere Erhörung versprochen hat 188 17. Die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche 189 17.1 Anfangsereignis: Duquesne-Wochenende 1967 189 17.2 Höhepunkt von Wachstum und Ökumene der katholischen charismatischen Erneuerung: Kansas City 1977 192 17.3 Die Integration der Charismatischen Erneuerung in die katholische Kirche 194 17.4 Ziel der Charismatischen Erneuerung: Selbstauflösung in die katholische Kirche hinein? 195 17.5 Charismatische Erneuerung: eine Erneuerungsbewegung neben anderen oder die Erneuerung des Heiligen Geistes für die katholische Kirche? 198 18. Neocharismatisch und katholisch 201 18.1 Geistliche Kriegführung, die Jesus-Marsch-Bewegung und der „Runde Tisch Österreich“ 201 18.2 Die John-Wimber-Kongresse und die Auseinandersetzung mit der Propheten-Bewegung 203 18.3 Wimbers Power-Evangelisierung, der Toronto-Segen und die Alpha-Kurs-Bewegung 206 18.4 Eine differenzierte Sicht auf die Prophetenbewegung 208 19. Charismatisch-evangelikal-katholische Bewegungen hinter dem Mission Manifest. Zwei Beispiele 210 19.1 Das Gebetshaus Augsburg 210 19.2 Die Loretto-Gemeinschaft 212 19.3 Loretto-Gemeinschaft und Gebetshaus Augsburg 214 19.4 Eine Frage der Eschatologie 214 19.5 Schechina: Den Kairos für Erweckung nutzen 216 Teil V: Das Mission Manifest – Thesen, Kritik und Unterscheidung 219 20. Eine prophetische Ansage: Erster Blick auf das Manifest 219 20.1 Helden für die Rettung der Kirche? 219 20.2 Eine prophetische Ansage 220 20.3 „Gebot der Stunde“ (Papst Franziskus): Ein kirchlicher Kairos für Mission 221 21. Entscheidung für Christus (These 1) – aber in vielen, auch unauffälligen Formen 223 21.1 Entscheidungschristentum? 223 21.2 Die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren 224 21.3 Plädoyer für eine evangelistische Behutsamkeit 226 22. Mission First! (These 2) – aber ohne „Ungeduld mit Gott“ 230 22.1 Keine Welteroberung! Die demütige Vollmacht, in der christliche Mission gegründet 230 22.2 Eine Macht, die nicht zwingt, sondern freisetzt 233 22.3 Die Bedeutung des Heiligen Geistes für die Mission 234 22.4 Die Geduld Gottes und unsere Ungeduld 235 22.5 Jederzeit freudig und überzeugend auf alle zugehen? 237 22.6 Prophetische Ungeduld 238 23. Die christliche Hoffnung teilen (These 3) – aber nicht als Alleinstellungsmerkmal gegenüber einer hoffnungslosen Welt 239 23.1 Ein messerscharfes Argument für erfolgreiche christliche Mission? 239 23.2 Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit in der Welt? 240 23.3 Was machen MissionarInnen, wenn sie einem zufriedenen Nichtchristen begegnen? 241 23.4 Warnung vor dem Lückenbüßergott (Dietrich Bonhoeffer) 243 23.5 Ansatz aus der Fülle – nicht (nur) aus dem Mangel 244 23.6 Gegensatzdenken: ein zentraler Kritikpunkt am Mission Manifest 246 23.7 Kritik mit gefärbter Brille 248 23.8 Vertiefung: Die „soziologische Brille“ der Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann 249 24. Auf alle zugehen (These 4) – durch Verkündigung und Dienst am Mitmenschen 251 24.1 „Alle ansprechen“ 251 24.2 … Auch Muslime? 252 24.3 Keinen Unterschied machen? 253 24.4 Übernatürliches Mitleid als Bewegung durch den Heiligen Geist 254 24.5 Mission und Caritas 256 25. Kraftvoll beten für eine starke Mission (These 5) – aber nicht nur, um Gott mit Bitten zu bewegen 259 25.1 Beten ist weit mehr als bloß Bittgebet 259 25.2 Was bedeutet „kraftvoll beten“? 260 25.3 Wie Gott unverzüglich unsere Bitten erhört: Die biblische Grundlage und ihr chronologisches Missverständnis 261 25.4 Der Kairos einer (wunderbaren) Gebetserhörung 262 „Vorschattung“ der endzeitlichen Ankunft Christi 262 Den Kairos einer Gebetserhörung nutzen 262 25.5 Die radikale Kritik an außerordentlichen Gebetserhörungen durch eine heutige Freiheits-Theologie: 263 25.6 Die Problematik einer „einseitigen“ („monoperspektischen“) Theologie 266 25.7 Der dritte Weg einer „mehrperspektivischen Theologie“ 267 Zum Beispiel: Einseitiges oder „mehrseitiges“ Verständnis von Gottes Offenbarung 267 Nicht erhörte Gebete und Theodizee in einer mehrperspektivischen Theologie 270 26. Von Evangelikalen lernen (These 6) – aber Vorsicht vor den Fallen eines pragmatischen Verständnisses von Pastoral und Mission 270 26.1 Die vier „Soli“: Konzentration auf die Mitte des christlichen Glaubens 271 26.2 Pragmatik – die praktische Stärke der Evangelikalen 272 26.3 Falsche Pragmatik: Biblische Warnsignale 272 Das goldene Kalb: Die falsche Pragmatik von Aaron 273 Die falsche Pragmatik von König Saul 275 Die falsche Pragmatik des Petrus und andere Versuchungen Jesu 275 26.4 Lässt sich Erweckung machen? Ambivalente Pragmatik in der Geschichte der Evangelikalen 276 26.5 Fatale Marktorientierung? Kritik an einem „amerikanisierten Katholizismus“ (Thomas Schärtl) 277 26.6 Kritische Solidarität als Unterscheidungskriterium für evangelikale Pragmatik und die Wahrheitsfrage 281 27. Die Inhalte des Glaubens neu entdecken (These 7) – durch Kerygma und Theologie 283 27.1 Glaubensinhalte: konzentriert, aber nicht bedeutungslos 284 27.2 Konzentration und Expansion des Glaubens nach der Bekehrung des Paulus 286 27.3 Phasen im Glaubensleben berücksichtigen! 287 27.4 Kerygma und Theologie 288 27.5 Die Einheit von Gottes Offenbarung und die Vielgestaltigkeit, in der wir sie im Glauben aufnehmen 292 27.6 Vorgegebene Glaubensinhalte und eigene Glaubensverantwortung (zum Kommentar von Bernhard Meuser) 294 28. Missionieren, nicht indoktrinieren (These 8) – Eine begrüßenswerte Selbstverpflichtung 296 29. Bekehrung von der Weltlichkeit der Welt zur Freude des Evangeliums (These 10) – mit besonderer Vorsicht vor „geistlicher Weltlichkeit“ 298 29.1 Eine polarisierende Aussage, die man richtig verstehen muss 298 29.2 Die größere Gefahr einer geistlichen Weltlichkeit 300 29.3 Sich selbst bekehren von einer individualistischen Traurigkeit zur Freude des Evangeliums (Papst Franziskus) 302 29.4 Das rechte Verhältnis von Entweltlichung und Weltoffenheit 304 Teil VI Einige Ergebnisse und Folgerungen 305 30. Evangelikal, pfingstlich und charismatisch: Potenziale und Gefahren 305 30.1 Einfach nur Jesus! 305 30.2 Evangelikale Bekehrungserfahrung und charismatische Geist-Erfahrung sind voneinander untrennbar 309 30.3 Die gemeinsame Eigenart von evangelikalen und charismatischen Erfahrungen: Anfang und Vollendung 310 30.4 Kairos: Die volle Breite möglicher Gnadenerfahrungen 312 30.5 Eine große Gefahr für Erneuerungsbewegungen: zu meinen, es wäre immer „Kairos“ 313 30.6 Gefährdungen einer „Power-Charismatik“: Wunder sind möglich, aber nicht verfügbar 314 31. Erneuerungsbewegungen und Kirche brauchen einander 315 31.1 Die Erneuerungsbewegungen brauchen die Strukturen der Kirchen, um sie zu beleben – selbst wenn diese als „tot“ erscheinen 316 31.2 … Und die Kirchen brauchen Erneuerung – nicht zuletzt durch den Dienst von Erneuerungsbewegungen 317 31.3 Das fatale Gesetz der Versteinerung: Resistenz gegenüber Gottes Wort in den Kirchen 318 31.4 Die Provokation des Zeugnisses erneuerter Christen 322 31.5 Sakrament und Salbung 322 31.6 Gotteserfahrung in Sakrament und Salbung: Gegenwart und Verborgenheit 324 32. Der Dienst der Theologie 326 32.1 Eine Theologie, die der Kirche und den Erneuerungsbewegungen dient, muss eine hörende Theologie sein 326 32.2 Theologie und Mystik: eine zerstörerische Kombination? 329 32.3 Der dreifache Weg der Gottesrede – existenziell und heilsgeschichtlich gegründet 329 32.4 Eine Theologie, die den Erneuerungsbewegungen dienen kann 333 Persönliches Nachwort 336 Anhang 341 Glossar 341 Literatur 346 Personenregister 355 Schlagwortregister 356 |
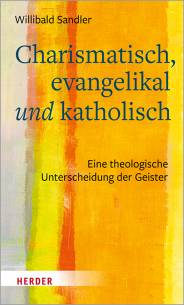
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen