|
|
|
Umschlagtext
Rauschhafte Drastik und filigrane Perfektion im Leben wie in der Kunst: eine neue Biografie von Benvenuto Cellini, Schöpfer des »Perseus« und der »Saliera«, von einem der intimsten Kenner der Renaissance.
„Benvenuto wird als Mensch die Menschen beschäftigen bis ans Ende der Tage. Er ist ein Mensch, der alles kann, alles wagt und sein Maß in sich selber trägt. Ob wir es gerne hören oder nicht, es lebt in dieser Gestalt ein ganz kenntliches Urbild des modernen Menschen.“ Jacob Burckhardt Rezension
Der Mensch sei sein „eigener Töpfer und Bildhauer“, er könne zu den Tieren entarten oder zu den Göttlichen emporsteigen. Dieses schrieb Giovanni Pico della Mirandola in seiner für den philosophischen Weltkongress 1487 geplanten Eröffnungsrede „Über die Würde des Menschen“. Seine Definition des Menschen steht für das Programm der Renaissance. Sie bewirkte von Italien ausgehend eine Geistes- und Kulturrevolution in Europa und leitete den Übergang zur Neuzeit ein. Mit dieser Epoche verbindet man berühmte Namen, wie zum Beispiel die der Schriftsteller Francesco Petrarca und Giovanni Boccaccio, die der Universalgenies Leon Battista Alberti und Leonardo da Vinci, die der Maler Michelangelo und Raffael, den des Kunsthistorikers Giorgio Vasari oder die von Philosophen wie dem Neuplatoniker Marsilio Ficino, dem Humanisten Erasmus von Rotterdam, dem Begründer neuzeitlichen politischen Denkens Niccolo Machiavelli oder auch der ersten Berufsschriftstellerin Christine de Pizan.
Als „uomo universale“ gilt auch der Bildhauer, Goldschmied und Münzmacher Benvenuto Cellini (1500-1571). Bekanntheit erlangte er durch seine Skulpturen wie „Herkules und Carus“(1525-1534), „Nymphe von Fontainebleau“(ca. 1543), „Perseus mit dem Haupt der Medusa“(1545-1554), „Ganymed“(ca. 1548-1550), „Apoll und Hyazinth“(vor 1557), sein Tafelgerät „Saliera“(1543), seine „Büste von Bindo Altoviti“(1549) oder seine Medaillen für Papst Clemens VII. (1534). Die Würde des Menschen zu bewahren bildete nicht das Programm des italienischen Künstlers. In seiner Lebensbeschreibung „La Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini Fiorentino scritta per lui medesimo in Firenze“, verfasst zwischen 1558 und 1566, bekennt sich Cellini zu drei Morden. Auch Frauen gegenüber übte er, der seine Affekte nicht kontrollieren konnte, Gewalt aus. Den Künstler charakterisierte der Basler Kunsthistoriker Jacob Burckhardt als „das Urbild des modernen Menschen“. Differenziert beleuchtet wird das Leben und das Œuvre des gewalttätigen Vertreters der Renaissance in der Monographie „Cellini. Ein Leben im Furor“, erschient im Verlag Klaus Wagenbach. Verfasst wurde sie von dem Kunsthistoriker Andreas Beyer (*1957), Professor für Kunstgeschichte an der Universität Basel, langjähriger Mitherausgeber der „Zeitschrift für Kunstgeschichte“ und ehemaliger Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte. In seinem Buch zeigt der Wissenschaftler differenziert Zusammenhänge zwischen dem abgrundtiefen Verfehlungen Cellinis und seinen künstlerischen Arbeiten auf. So demonstriert Beyer beispielsweise überzeugend, wie der Künstler seine eigenen Gewalttaten in seinem skulpturalen Hauptwerk „Perseus mit dem Haupt der Medusa“, zu finden auf der Piazza della Signora in Florenz, zum Ausdruck bringt. Die Ausführungen des Kunsthistorikers zeichnen sich durch gute Lesbarkeit aus. Lehrkräfte des Faches Bildende Kunst werden durch das vorliegende Werk motiviert, sich in ihrem Fachunterricht problemorientiert mit den Skulpturen in der italienischen Renaissance auseinanderzusetzen. Außerdem bietet es sich, mit Schüler:innen über das Verhältnis von Gewalt und Kunst zu reflektieren. Fazit: Andreas Beyers Biografie „Cellini“ leistet einen wichtigen Beitrag zur differenzierten Betrachtung der Kunst in der Renaissance. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Rauschhafte Drastik und filigrane Perfektion im Leben wie in der Kunst: eine neue Biografie von Benvenuto Cellini, Schöpfer des »Perseus« und der »Saliera«, von einem der intimsten Kenner der Renaissance. Die Kunstgeschichte zeigte sich vom Leben des Benvenuto Cellini, dem überragenden Skulpteur der Renaissance, gleichermaßen fasziniert wie abgestoßen: Er war Mörder, Dieb, gewalttätiger Liebhaber aller Geschlechter, sowohl Diener als auch Herausforderer von Päpsten und Fürsten, ingeniöser Künstler. In genau diesen Rollen schildert er sich in seinem legendären Lebensbericht, der »Vita«, deren besonders verstörende Stellen in späteren Ausgaben und Übersetzungen oft ausgelassen oder abgeschwächt wurden. Sicherheitshalber hat man sein Buch zur Fiktion oder zu purer Selbststilisierung erklärt. Andreas Beyer zeigt in seiner unverschämten Neuvorstellung des Lebens und Werks Cellinis entlang der »Vita«, dass die inkriminierten Passagen über das Leibliche, Geschlechtliche und sinnliche Transgressionen nicht nur verteufelt hohen Unterhaltungswert besitzen, sondern vor allem Authentizität beanspruchen dürfen. Erst dadurch wird das Profil des daseinssüchtigen Menschen Cellini wahrhaftig sichtbar: ein Künstler, der das Leben in all seinen Möglichkeiten und Facetten mit aller Gewalt an sich riss und dabei sämtliche Grenzen der Existenz sprengte. Inhaltsverzeichnis
DIE EMANZIPATION ZUM KÜNSTLER
Florenz 1500-1519 PERSÖNLICHKEITSBILDUNG 31 Rom 1519-1540 SELBSTERHÖHUNG 107 Paris 1540-1545 VOLLENDUNG UND VERGESSEN 137 Florenz 1545-1571 Editionsgeschichte der Vita 191 Chronologie 195 Dank 201 Anmerkungen 203 Bibliographie 213 Bildnachweise 221 |
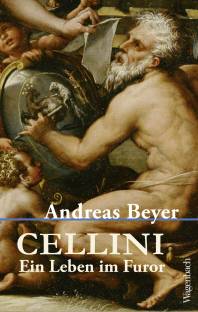
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen