|
|
|
Umschlagtext
In allen OECD-Mitgliedstaaten suchen die Regierungen nach politischen Ansätzen und Maßnahmen, um das Bildungswesen effektiver zu gestalten, während sie sich gleichzeitig um zusätzliche Ressourcen für die steigende Bildungsnachfrage bemühen.
Die Ausgabe des Jahres 2008 von Bildung auf einen Blick - OECD-Indikatoren ermöglicht jedem Land, sein eigenes Bildungssystem im Vergleich zu anderen Ländern zu betrachten. Sie bietet ein umfangreiches aktuelles Spektrum an Indikatoren zur Leistungsfähigkeit der einzelnen Bildungssysteme, die auf dem Konsens der Fachwelt beruhen, wie der gegenwärtige Stand der Bildung im internationalen Vergleich zu bewerten ist. Die Indikatoren untersuchen, wer an Bildung teilnimmt, was für Bildung ausgegeben wird, wie die einzelnen Bildungssysteme funktionieren und welche Ergebnisse erzielt werden. Die verschiedenen Indikatoren zu den Ergebnissen von Bildungssystemen reichen von Vergleichen von Schülerleistungen in wichtigen Fächern bis zu den Auswirkungen von Bildung auf das Einkommen und die Beschäftigungsmöglichkeiten von Erwachsenen. Zu den in dieser Ausgabe neu hinzugekommenen Aspekten gehören: • Ein Blick auf die Studienanfängerquoten im Tertiärbereich, nach Fächergruppen untergliedert • Daten zu den Leistungen 15-Jähriger in Naturwissenschaften • Eine Analyse des sozioökonomischen Hintergrunds von 15-Jährigen und der Einschätzung der besuchten Schule durch ihre Eltern • Daten darüber, in welchem Ausmaß der sozioökonomische Hintergrund von Eltern die Aufnahme eines Studiums im Tertiärbereich beeinflusst • Daten zu den Erträgen aus Bildung • Informationen zur finanziellen Steuerung von Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs • Eine Analyse der Effizienz des Ressourceneinsatzes • Daten zu den Auswirkungen von Evaluationen und Leistungsmessungen in Bildungssystemen • Ein Vergleich der Entscheidungsebenen in den Bildungssystemen der einzelnen Länder. Die den Tabellen und Abbildungen dieser Ausgabe zu Grunde liegenden Excel-Tabellen können über die in der Veröffentlichung angegebenen Statünks eingesehen werden. Die Tabellen und Abbildungen selbst sowie die gesamte OECD-Online-Bildungsdatenbank sind über die Website der OECD unter www.oecd.org/edu/eag2008 frei zugänglich. Weitere Veröffentlichungen: Education Policy Analysis Der vollständige englische Text dieser Veröffentlichung ist verfügbar unter: www.sourceoecd.org/education/9789264046283 Kunden mit Online-Zugang zu allen OECD-Büchern sollten folgenden Link benutzen: www.sourceoecd.org/9789264046283 SourceOECD ist die OECD-Online-Bibliothek für Bücher, Zeitschriften und statistische Datenbanken. Für weitere Informationen bezüglich dieses Dienstes sowie eines kostenlosen Testzugangs wenden Sie sich bitte an Ihre Informations- und Dokumentationsstelle oder schreiben Sie uns an SourceOECD@oecd.org. Rezension
Hier die wesentlichen Ergebnisse der OECD-Indikatoren, die Bildungsniveaus und Bedingungen für Bildung aller OECD-Länder untereinander vergleichen. Die Indikatoren erfassen die am Bildungswesen Beteiligten, die für Bildung und Ausbildung aufgewendeten Mittel sowie Operationsweisen und Ergebnisse der Bildungssysteme.
Bildung auf einen Blick ist das jährlich erscheinende Kompendium der OECD mit international vergleichbaren Bildungsstatistiken. In der Ausgabe 2008 wird die kontinuierliche Ausweitung des Bildungssektors untersucht, die dazu führte, dass heute 57% aller jungen Menschen ein Studium aufnehmen. Internationale Vergleiche können den Bildungssystemen bei der Bewältigung der mit dieser Ausweitung verbundenen Herausforderungen helfen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, ihre Leistung im Licht dessen zu sehen, was in anderen Ländern in der Bildungspolitik geschieht. Deutschland verliert bei der Ausbildung von Hochqualifizierten international weiter an Boden. Einkommensvorteile für Akademiker nehmen weiter zu, der Übergang ins Berufsleben für junge Menschen wird zunehmend schwierig. Der Anteil der Studienanfänger wie auch der Graduierten je Jahrgang ist in den meisten OECD-Ländern in den vergangen Jahren schneller gewachsen als in Deutschland - und das von einem deutlich höheren Niveau. Dies geht aus der diesjährigen Ausgabe der Studie "Bildung auf einen Blick" hervor, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung" (OECD) in Berlin vorgestellt hat. So ist der Anteil der Hoch- und Fachhochschulabsolventen je Jahrgang in Deutschland von 2000 bis 2006 von 18 auf 21 Prozent gestiegen. Im OECD-Schnitt wuchs der Graduiertenanteil je Jahrgang im gleichen Zeitraum dagegen von 28 auf 37 Prozent. Die Entwicklung der Studienanfängerzahlen lässt erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch verstärkt. Im OECD-Mittel hat sich der Anteil der Studienanfänger an Hoch- und Fachhochschulen von 2003 bis 2006 von 53 auf 56 Prozent eines Jahrgangs erhöht, in Deutschland stagniert er dagegen zwischen 35 und 37 Prozent. Bei den Postgraduierten (Promotion oder vergleichbar) nimmt Deutschland 2006 mit einem Anteil von 2,3 Prozent je Jahrgang nach Portugal und der Schweiz in der OECD weiter eine Spitzenstellung ein. Allerdings ist auch hier der Anteil gegenüber dem Vorjahr entgegen dem OECD-Trend leicht gesunken. Der Anteil der Studienabbrecher an Hoch- und Fachhochschulen liegt mit 23 Prozent deutlich unter dem OECD-Schnitt von 31 Prozent. Nur in Frankreich, Belgien (Flandern), Dänemark und Japan ist die Abbrecherquote geringer. Obwohl in kaum einem anderen OECD-Land ein größerer Anteil der Studierenden einen Abschluss in naturwissenschaftlich-technischen Fächern erwirbt, sind aufgrund der insgesamt geringen Absolventenquote in Deutschland Hochqualifizierte in diesem Fächern unter den jungen Erwerbstätigen deutlich unterrepräsentiert. So kommen 2006 im OECD-Schnitt auf 100.000 Erwerbstätige im Alter von 25 bis 34 Jahre 1649 Hochqualifizierte mit naturwissenschaftlich-technischem Studium. In Deutschland sind es dagegen nur 1423 je 100.000 Erwerbstätige. Hochqualifizierte konnten in Deutschland auch 2006 ihren Einkommensvorsprung gegenüber Erwerbstätigen mit Berufsausbildung ausbauen, was ebenfalls dafür spricht, dass der Bedarf durch die Absolventenzahlen nicht gedeckt wird. So verdienten Arbeitnehmer mit einer tertiären Ausbildung (akademischer und höherer beruflicher Abschluss) im Jahr 2006 im Schnitt 64 Prozent mehr als Arbeitnehmer mit Berufsausbildung. Im Jahr 2000 belief sich der durchschnittliche Einkommensvorteil dagegen nur auf 43 Prozent. Zudem erzielt mit 27,1 Prozent ein deutlich größerer Anteil der Hoch- und Fachhochschulabsolventen in Deutschland Spitzengehälter (mehr als das Doppelte des Median-Einkommens) als im OECD-Schnitt (26,1 Prozent, 25 Länder). Stellten Frauen im Jahr 2000 zum ersten Mal die Hälfte der Studierenden, sind sie nun mit einem Anteil von 55 Prozent an den Studienanfängern in der tertiären Ausbildung sogar leicht stärker vertreten als im OECD-Schnitt (54 Prozent). Bei den Ingenieurswissenschaften liegt der Frauenanteil mit 16 Prozent deutlich unter dem OECD-Schnitt von 22 Prozent. Dafür sind Frauen in Deutschland unter den Anfängern in Mathematik und Informatik mit 35 Prozent gegenüber 24 Prozent im OECD-Schnitt deutlich überrepräsentiert. Auch in gesundheits- und geisteswissenschaftlichen Fächern ist, wie in den meisten anderen OECD-Ländern, der Frauenanteil besonders hoch. Neben Arbeitsmarktfaktoren, wie einer hohen Teilzeitquote bei Frauen, dürfte dies einer der Gründe sein, warum Männer mit tertiärer Ausbildung nach wie vor deutlich mehr verdienen als Frauen mit gleicher formaler Qualifikation. „Es kommt jetzt darauf an, dass Frauen auch bei den Chancen auf dem Arbeitsmarkt mit den Männern gleichziehen können“, so Ischinger. Gleichzeitig warnte die OECD-Expertin davor, allein dadurch einem sich abzeichnenden Fachkräftemangel abhelfen zu wollen, indem man Frauen zur Wahl eines anderen Studienfachs bewege. Dies könne nur durch eine höheren Studierendenquote insgesamt gelingen. In Deutschland verfügen 84 Prozent der 25 bis 34-Jährigen mindestens über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur und damit deutlich mehr als im OECD-Schnitt (78 Prozent). Gleichzeitig ist unter den 15 bis 19-Jährigen mit 4,2 Prozent der Anteil der „Inaktiven“ (weder in Ausbildung noch erwerbstätig) vergleichsweise gering (6,3 Prozent EU-19). In dieser Zahl spiegelt sich das Bemühen der vergangen Jahre, möglichst für alle Jugendlichen für eine Ausbildung zu sorgen. Dennoch scheint die einst durch das Duale System garantierte schnelle und reibungslose Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt nicht mehr ohne weiteres gegeben. So ist in der Altersgruppe 25 bis 29 Jahre der Anteil der "inaktiven" jungen Menschen in den vergangen Jahren deutlich gestiegen und liegt mittlerweile über dem EU-Schnitt (EU-19). So waren 2006 in Deutschland 20 Prozent der 25 bis 29 Jährigen weder in Ausbildung noch erwerbstätig, 1999 waren es dagegen nur 18,1 Prozent. Im EU-Schnitt ist der Anteil der "inaktiven" 25 bis 29-Jährigen im gleichen Zeitraum dagegen von 20 auf 17,5 Prozent gesunken. Im Jahr 2005 haben die OECD-Länder 6,1 Prozent ihrer kumulierten Wirtschaftsleistung für die Finanzierung ihrer Bildungsinstitutionen ausgegeben. In Deutschland lag dieser Wert bei 5,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Vergleicht man die Ausgaben pro Schüler in den verschiedenen Bildungsabschnitten, dann zeigt sich, dass in Deutschland die Ausgaben im Primarbereich unter dem OECD-Schnitt liegen, im Tertiärbereich und, bedingt durch das Duale System, im Sekundarbereich hingegen über dem OECD-Schnitt. In der nichttertiären Bildung (Schule und Duales System) sind die Ausgaben pro Schüler in Deutschland zwischen 2000 und 2005 um zwei Prozent leicht gestiegen. Abgesehen von Belgien, wo die Ausgaben pro Schüler in diesem Zeitraum schrumpften, war dies der geringste Anstieg innerhalb der OECD und er kam nur deshalb zustande, weil die Ausgaben langsamer zurückgingen als die Schülerzahlen. In der tertiären Bildung sind die Ausgaben zwischen 2000 und 2005 um 6 Prozent gestiegen, konnten aber mit den gestiegenen Studierendenzahlen nicht mithalten, so dass die Ausgaben pro Studierenden im gleichen Zeitraum um zwei Prozent gesunken sind. Innerhalb der OECD sind im gleichen Zeitraum nur in Belgien, Ungarn, den Niederlanden und Schweden die Ausgaben pro Student gesunken. Allerdings mussten diese Länder mit Ausnahme von Belgien einen weit größeren Anstieg bei den Studierendenzahlen bewältigen. Anders als in den meisten anderen OECD-Ländern sind die Bildungsausgaben in Deutschland in den vergangenen Jahren langsamer gewachsen als die öffentlichen Ausgaben insgesamt. Stieg im OECD-Mittel zwischen 2000 und 2005 der Anteil der Bildungsausgaben von 12,8 auf 13,2 Prozent der Gesamtausgaben der öffentlichen Hand, ist er in Deutschland von 9,9 auf 9,7 Prozent gesunken. Nur in Japan und Italien ist der Anteil der Bildungsausgaben an den öffentlichen Ausgaben geringer. Insgesamt haben sich in der OECD zwei Strategien als erfolgreich erwiesen, um den Anteil der Hochqualifizierten zu erhöhen. So haben die nordischen Länder in großem Umfang öffentliche Mittel in die tertiäre Ausbildung investiert und zwar sowohl in die Bildungsinstitutionen wie auch in die direkte finanzielle Förderung der Studierenden. Auf der anderen Seite haben Länder wie Australien, Großbritannien, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland oder die Vereinigten Staaten die tertiäre Ausbildung ausgeweitet, indem sie die Kosten in Form von Studiengebühren den Studierenden und ihren Familien aufgeladen haben. Gleichzeitig wurde Studierenden mit weniger privilegiertem Hintergrund das Studium über Kredite oder Stipendien ermöglicht. In vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland wurden dagegen die notwenigen Mittel weder durch öffentliche Investitionen noch durch kostendeckende Studiengebühren bereitgestellt. Deutschland ist weiterhin eines der wichtigsten Zielländer für internationale Studierende. 8,9 Prozent aller 2006 von der OECD registrierten Auslandsstudenten studieren in Deutschland. Nach den USA (20 Prozent) und Großbritannien (11,3 Prozent) ist das der dritte Platz innerhalb der OECD. Auch bezogen auf die Gesamtstudentenzahl liegt der Anteil der ausländischen Studierenden mit 12,7 Prozent über dem OECD-Schnitt von 8,5 Prozent. Allerdings hat sich zwischen 2000 und 2006 in den OECD-Ländern die Zahl der ausländischen Studierenden mehr als verdoppelt, während sie in Deutschland im gleichen Zeitraum nur um 40 Prozent gestiegen ist. Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
OECD-Bildungsstudie 2008 untersucht die Ergebnisse bildungspolitischer Entscheidungen Die Daten der OECD-Bildungsstudie 2008 zeigen deutliche Bemühungen, die Investitionen in Bildung zu steigern. Ob jedoch in allen OECD-Ländern die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, für die demografischen und strukturellen Veränderungen der letzten 10 Jahre ausreichend sind, ist fraglich. Die Kennzahlen des aktuellen Berichts zeigen, dass besonders im Tertiärbereich die Teilnehmerzahlen als Folge der Wissensgesellschaft und ihrer Anforderungen sowie der zunehmenden Bildungsbeteiligung steigen. Auf der anderen Seite gibt es besonders bei Bildungseinrichtungen im Tertiärbereich finanzielle Probleme, die die Qualität der angebotenen Studiengänge gefährden können. Die OECD-Studie Bildung auf einen Blick 2008 hat sich zum Ziel gesetzt, besonders die bildungspolitischen Entscheidungen, die verschiedene Länder in diesem Bereich gefällt haben, zu untersuchen und stellt diese Ergebnisse vor. Zu den Daten, die in dieser Ausgabe zusätzlich ausgewertet werden, gehören u.a.: Studienanfängerquoten, nach Fächergruppen untergliedert Daten zu den Leistungen 15-Jähriger in Naturwissenschaften Analyse des sozioökonomischen Hintergrunds von 15-Jährigen und der Einschätzung der besuchten Schule durch ihre Eltern Daten zu den Erträgen aus Bildung Informationen zur finanziellen Steuerung von Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs Eine Analyse der Effizienz des Ressourceneinsatzes Daten zu den Auswirkungen von Evaluationen und Leistungsmessungen in Bildungssystemen Vergleich der Entscheidungsebenen in den Bildungssystemen der einzelnen Länder. Bildung auf einen Blick 2008 – OECD-Indikatoren enthält die umfassendste Sammlung statistischer Daten aus dem Bildungsbereich im internationalen Vergleich. Die Indikatoren erfassen die am Bildungswesen Beteiligten, die für Bildung und Ausbildung aufgewendeten Mittel sowie Operationsweisen und Ergebnisse der Bildungssysteme. Durch die Indikatoren werden die Bildungsniveaus und Bedingungen für Bildung aller OECD-Länder untereinander vergleichbar. Vom Vergleich von Schülerleistungen in Schlüsselfächern über den Zusammenhang zwischen Abschlüssen und Einkommen bis hin zu den Arbeitsbedingungen für Pädagogen enthält der Band eine umfassende und aktuelle Sammlung statistischer Daten aus dem Bildungsbereich im internationalen Vergleich. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen der Studie ist im Internet auf der Homepage der OECD, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie der Kultusministerkonferenz abrufbar. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 3
Editorial 13 Einleitung 19 Hinweise für den Leser 23 Kapitel A: Bildungsergebnisse und Bildungserträge 27 Indikator A1: Über welche Bildungsabschlüsse verfügen Erwachsene? 29 Tabelle A1.1a Bildungsstand: Erwachsenenbevölkerung (2006) 45 Tabelle A1.2a Bevölkerung mit mindestens einem Abschluss im Sekundarbereich II (in %) (2006) 46 Tabelle A1.3a Bevölkerung mit einem Abschluss im Tertiärbereich (2006) 47 Tabelle A1.4 Fächergruppen (2004) 48 Tabelle A1.5 Verhältnis der 25- bis 34-Jährigen mit einem ISCED-5A-Abschluss und der 30- bis 39-Jährigen mit einem ISCED-6-Abschluss zu den 55- bis 64-Jährigen mit einem ISCED-5A/6-Abschluss, nach Fächergruppe (2004) 49 Tabelle A1.6 Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in verschiedenen Berufen (ISCO) (1998, 2006) 50 Tabelle A1.7 Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in verschiedenen Berufen nach Ausrichtung des tertiären Studiengangs (2006) 52 Indikator A2: Wie viele Schüler erlangen einen Abschluss im Sekundarbereich und nehmen ein Studium im Tertiärbereich auf? 55 Tabelle A2.1 Abschlussquoten im Sekundarbereich II (2006) 70 Tabelle A2.2 Entwicklung der Abschlussquoten im Sekundarbereich II (1995 – 2006)71 Tabelle A2.3 Abschlussquoten im postsekundaren, nicht tertiären Bereich (2006) 72 Tabelle A2.4 Studienanfängerquoten im Tertiärbereich und Altersverteilung der Studienanfänger (2006)73 Tabelle A2.5 Entwicklung der Studienanfängerquoten im Tertiärbereich (1995 – 2006)74 Tabelle A2.6 Verteilung der Studienanfänger im Tertiärbereich und Anteil der Frauen (in %), nach Fächergruppe (2006) 75 Indikator A3: Wie viele Studierende im Tertiärbereich schließen ihr Studium erfolgreich ab? 77 Tabelle A3.1 Abschlussquoten im Tertiärbereich (2006) 93 Tabelle A3.2 Entwicklung der Abschlussquoten im Tertiärbereich (1995 – 2006)94 Tabelle A3.3 Abschlussquoten in den verschiedenen Tertiärbereichen und Anteil der internationalen und ausländischen Studierenden an der Gesamtzahl der tertiären Absolventen (2006) 95 Tabelle A3.4a Anteil der Absolventen des Tertiärbereichs A und weiterführender forschungsorientierter Studiengänge (in %), nach Fächergruppe (2000, 2006) 96 Tabelle A3.5a Anteil der von Frauen erworbenen Abschlüsse im Tertiärbereich A und in weiterführenden forschungsorientierten Studiengängen (in %), nach Fächergruppe (2000, 2006) 97 Tabelle A3.6 Absolventen in naturwissenschaftlich ausgerichteten Studiengängen, nach Geschlecht (2006) 98 Indikator A4: Wie hoch sind die Erfolgsquoten im Tertiärbereich und wie hoch ist der Anteil der Studienabbrecher? 99 Tabelle A4.1 Erfolgsquoten im Tertiärbereich (2005) 106 Tabelle A4.2 Erfolgsquoten im Tertiärbereich A, nach Vollzeit-/Teilzeitstudium 107 Indikator A5: Was leisten 15-jährige Schüler in naturwissenschaftlichen Fächern?109 Tabelle A5.1 Mittelwert, Varianz und geschlechtsspezifi sche Unterschiede bei den Schülerleistungen auf der PISA-Gesamtskala Naturwissenschaften (2006) 123 Tabelle A5.2 Anteil der Schüler (in %) auf den einzelnen Kompetenzstufen der PISAGesamtskala Naturwissenschaften (2006) 125 Tabelle A5.3 Mittelwert, Varianz und geschlechtsspezifi sche Unterschiede bei den Schülerleistungen auf den verschiedenen naturwissenschaftlichen Kompetenzskalen von PISA 2006 126 Indikator A6: Wie schätzen Eltern die Schule und das naturwissenschaftliche Lernen ihres Kindes ein? 129 Tab. A6.1 Elternangaben zur früheren naturwissenschaftlichen Lektüre ihres Kindes und Schülerleistungen auf der PISA-Gesamtskala Naturwissenschaften (2006) 137 Tab. A6.2a Ansicht der Eltern über das Leistungsniveau an der Schule ihres Kindes und sozioökonomischer Hintergrund (PISA 2006) 138 Tab. A6.2b Ansicht der Eltern über die Disziplin an der Schule ihres Kindes und sozio ökonomischer Hintergrund (PISA 2006) 139 Tab. A6.2c Ansicht der Eltern zur Frage, ob die Schule bei der Ausbildung der Schüler gute Arbeit leistet, und sozioökonomischer Hintergrund (PISA 2006) 140 Tab. A6.3a Einschätzung der Eltern hinsichtlich der Kompetenz und des Engagements der Lehrer ihres Kindes (PISA 2006)141 Tab. A6.3b Einschätzung der Eltern hinsichtlich der Unterrichtsinhalte und Lehrmethoden in der Schule ihres Kindes (PISA 2006) 142 Tab. A6.3c Einschätzung der Eltern hinsichtlich der Frage, ob die Fortschritte ihres Kindes an der Schule sorgfältig überwacht werden (PISA 2006) 143 Tab. A6.3d Einschätzung der Eltern hinsichtlich der Frage, ob die Schule regelmäßig nützliche Informationen über die Lernfortschritte ihres Kindes zur Verfügung stellt (PISA 2006)144 Indikator A7: Beeinflusst der sozioökonomische Status der Eltern die Entscheidung von Schülern für oder gegen ein Hochschulstudium? 145 Indikator A8: Wie beeinflusst die Bildungsteilnahme den Beschäftigungsstatus? 153 Tabelle A8.1a Beschäftigungsquoten und Bildungsstand, nach Geschlecht (2006) 163 Tabelle A8.2a Erwerbslosenquoten und Bildungsstand, nach Geschlecht (2006) 165 Tabelle A8.3a Entwicklung der Beschäftigungsquoten nach Bildungsstand (1997 – 2006) 167 Tabelle A8.4 Entwicklung der Beschäftigungsquoten 55- bis 64-Jähriger, nach Bildungsstand (1997 – 2006)169 Tabelle A8.5a Entwicklung der Erwerbslosenquoten nach Bildungsstand (1997 – 2006) 171 Indikator A9: Welchen wirtschaftlichen Nutzen hat Bildung?173 Tabelle A9.1a Relative Einkommen der Bevölkerung mit Erwerbseinkommen (2006 bzw. jüngstes verfügbares Jahr) 185 Tabelle A9.1b Geschlechtsspezifi sche Unterschiede in den Gehältern (2006 bzw. jüngstes verfügbares Jahr)187 Tabelle A9.2a Entwicklung der relativen Einkommen: Erwachsenenbevölkerung (1997 – 2006) 188 Tabelle A9.3 Entwicklung der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern (1997 – 2006) 189 Tabelle A9.4a Verteilung der 25- bis 64-Jährigen nach Einkommensniveau und Bildungsstand (2006 bzw. jüngstes verfügbares Jahr) 191 Indikator A10: Welche Anreize bestehen für eine Investition in Bildung? 195 Tabelle A10.1 Individuelle Ertragsrate für eine Person, die einen Abschluss im Sekundarbereich II oder dem postsekundaren, nicht tertiären Bereich (ISCED 3/4) erwirbt (2004) 212 Tabelle A10.2 Individuelle Ertragsrate für eine Person, die einen Abschluss im Tertiärbereich (ISCED 5/6) erwirbt (2004) 212 Tabelle A10.3 Individuelle Ertragsrate für eine Person, die einen Abschluss im Sekundarbereich II im Alter von 40 Jahren erwirbt (2004) 213 Tabelle A10.4 Individuelle Ertragsrate für eine Person, die einen Abschluss im Tertiärbereich im Alter von 40 Jahren erwirbt (2004) 213 Tabelle A10.5 Staatliche Ertragsrate für eine Person, die einen Abschluss im Tertiärbereich im Rahmen der Erstausbildung erwirbt (2004) 214 Tabelle A10.6 Staatliche Ertragsrate für eine Person, die einen Abschluss im Tertiärbereich im Alter von 40 Jahren erwirbt (2004) 214 Kapitel B Die in Bildung investierten Finanz- und Humanressourcen 215 Indikator B1: Wie hoch sind die Ausgaben pro Schüler/Studierenden? 219 Tabelle B1.1a Jährliche Ausgaben für Bildungseinrichtungen pro Schüler/Studierenden für alle Leistungsbereiche (2005) 237 Tabelle B1.1b Jährliche Ausgaben pro Schüler/Studierenden für eigentliche Bildungsdienstleistungen, zusätzliche Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung (2005) 238 Tabelle B1.2 Anteil der Ausgaben für Bildungseinrichtungen (in %) im Vergleich zur Zahl der Schüler/Studierenden pro Bildungsbereich (2005) 239 Tabelle B1.3a Kumulierte Ausgaben für Bildungseinrichtungen pro Schüler für alle Leistungsbereiche während der regulären Ausbildungsdauer im Primarund Sekundarbereich (2005) 240 Tabelle B1.3b Kumulierte Ausgaben für Bildungseinrichtungen pro Studierenden für alle Leistungsbereiche während der durchschnittlichen Dauer tertiärer Studiengänge (2005) 241 Tabelle B1.4 Jährliche Ausgaben für Bildungseinrichtungen pro Schüler/Studierenden für alle Leistungsbereiche im Verhältnis zum BIP pro Kopf (2005) 242 Tabelle B1.5 Veränderung der Ausgaben für Bildungseinrichtungen für alle Leistungsbereiche pro Schüler/Studierenden aufgrund verschiedener Faktoren, nach Bildungsbereich (1995, 2000, 2005) 243 Indikator B2: Welcher Teil des Volkseinkommens wird für Bildung ausgegeben? 245 Tabelle B2.1 Ausgaben für Bildungseinrichtungen als Prozentsatz des BIP, nach Bildungs bereich (1990, 1995, 2005)257 Tabelle B2.2 Ausgaben für Bildungseinrichtungen als Prozentsatz des BIP, nach Bildungs bereich (2005) 258 Tabelle B2.3 Veränderung der Ausgaben für Bildungseinrichtungen sowie Veränderung des BIP (1995, 2000, 2005) 259 Tabelle B2.4 Ausgaben für Bildungseinrichtungen als Prozentsatz des BIP, nach Herkunft der Mittel und Bildungsbereich (2005) 260 Indikator B3: Wie groß ist der Anteil der öffentlichen und der privaten Ausgaben für Bildungseinrichtungen? 261 Tabelle B3.1 Relative Anteile öffentlicher und privater Ausgaben für Bildungseinrichtungen aller Bildungsbereiche (2000, 2005)271 Tabelle B3.2a Relative Anteile öffentlicher und privater Ausgaben für Bildungseinrichtungen (in %), nach Bildungsbereich (2000, 2005)272 Tabelle B3.2b Relative Anteile öffentlicher und privater Ausgaben für Bildungseinrichtungen (in %), Tertiärbereich (2000, 2005)273 Tabelle B3.3 Entwicklung der relativen Anteile öffentlicher Ausgaben für Bildungseinrichtungen und Index der Veränderung zwischen 1995 und 2005 (2000 = 100), für den Tertiärbereich (1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)274 Indikator B4: Wie hoch sind die öffentlichen Gesamtausgaben für Bildung?275 Tabelle B4.1 Öffentliche Gesamtausgaben für Bildung (1995, 2000, 2005) 282 Tabelle B4.2 Verteilung der öffentlichen Gesamtausgaben für Bildung (2005) 283 Indikator B5: Wie hoch sind die Studiengebühren und was erhalten die Studierenden an öffentlichen Zuschüssen?285 Tabelle B5.1a Geschätzte durchschnittliche jährliche Studiengebühren für inländische Studierende an öffentlichen Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs A (Studienjahr 2004/05) 304 Tabelle B5.1b Geschätzte durchschnittliche jährliche Studiengebühren für inländische Studierende an öffentlichen Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs B (Studienjahr 2004/05) 306 Tabelle B5.1c Verteilung der Finanzhilfen an Studierende im Vergleich zur Höhe der Studiengebühren an Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs A (Studienjahr 2004/05) 308 Tabelle B5.1d Finanzielle Steuerung von Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs (Studienjahr 2004/05) 309 Tabelle B5.1e Finanzielle Unterstützung durch öffentliche Darlehen für Studierende im Tertiärbereich A (Studienjahr 2004/05) 313 Tabelle B5.2 Öffentliche Subventionen an private Haushalte und andere private Einheiten als Prozentsatz der öffentlichen Gesamtausgaben für Bildung und des BIP, Tertiärbereich (2005) 315 Indikator B6: Für welche Ressourcen und Leistungen werden Finanzmittel im Bereich der Bildung ausgegeben? 317 Tabelle B6.1 Ausgaben für Bildungseinrichtungen nach Ausgabenkategorien als Prozentsatz des BIP (2005) 326 Tabelle B6.2a Ausgaben für Bildungseinrichtungen nach Ausgabenkategorien im Primar- und Sekundarbereich (2005) 327 Tabelle B6.2b Ausgaben für Bildungseinrichtungen nach Ausgabenkategorien und Bildungsbereich (2005)328 Indikator B7: Wie effizient ist der Ressourceneinsatz im Bildungswesen? 329 Tabelle B7.1 Wirtschaftliche und soziale Indikatoren und ihre Korrelation mit Leistungen im Bereich Naturwissenschaften (2005, 2006) 343 Tabelle B7.2 Beitrag verschiedener Faktoren zu den Gehaltskosten pro Schüler im Sekundarbereich II (2004) 344 Tabelle B7.3 Korrelationen zwischen Ausgaben pro Schüler als Prozentsatz des BIP pro Kopf und 10 erklärenden Variablen, für den Sekundarbereich II (2005, 25 OECD-Länder) 346 Kapitel C Bildungszugang, Bildungsbeteiligung und Bildungsverlauf 347 Indikator C1: Wie verbreitet sind berufsbildende Bildungsgänge? 349 Tabelle C1.1 Struktur der Bildungsteilnahme im Sekundarbereich II (2006) 359 Tabelle C1.2 Anteil der Absolventen von berufsvorbereitenden/berufsbildenden Bildungsgängen des Sekundarbereichs II und des postsekundaren, nicht tertiären Bereichs (in %), nach Fächergruppe (2006) 360 Tabelle C1.3 Jährliche Ausgaben für Bildungseinrichtungen pro Schüler für alle Leistungsbereiche, nach Ausrichtung der Bildungsgänge (2005) 362 Tabelle C1.4 Leistungen 15-jähriger Schüler auf der PISA-Gesamtskala Naturwissenschaften, nach Ausrichtung der Bildungsgänge (2006) 363 Indikator C2: Wer nimmt an Bildung teil? 365 Tabelle C2.1 Bildungsbeteiligung, nach Alter (2006) 373 Tabelle C2.2 Entwicklung der Bildungsbeteiligung (1995 – 2006)374 Tabelle C2.3 Übergangscharakteristika bei 15- bis 20-Jährigen, nach Bildungsbereich (2006) 375 Tabelle C2.4 Verteilung der Schüler im Primar- und Sekundarbereich, nach Art der Bildungseinrichtung bzw. Vollzeit- oder Teilzeitteilnahme (2006) 376 Tabelle C2.5 Verteilung der Studierenden im Tertiärbereich, nach Art der Bildungseinrichtung bzw. Vollzeit- oder Teilzeitstudium (2006) 377 Indikator C3: Wer studiert im Ausland und wo? 379 Tabelle C3.1 Die Mobilität Studierender und ausländische Studierende im Tertiärbereich (2000, 2006) 401 Tabelle C3.2 Verteilung internationaler und ausländischer Studierender im Tertiärbereich nach Herkunftsland (2006) 402 Tabelle C3.3 Studierende, die in einem Land studieren, dessen Staatsbürger sie nicht sind, nach Zielland (2006) 404 Tabelle C3.4 Verteilung internationaler und ausländischer Studierender im Tertiärbereich (2006) 406 Tabelle C3.5 Verteilung internationaler und ausländischer Studierender im Tertiärbereich, nach Fächergruppe (2006) 407 Tabelle C3.6 Entwicklung der Zahl ausländischer Studierender, die außerhalb ihres Herkunftslands eingeschrieben sind (2000–2006) 408 Indikator C4: Wie erfolgreich bewältigen junge Menschen den Übergang vom (Aus-)Bildungssystem zum Erwerbsleben? 409 Tabelle C4.1a Zu erwartende Jahre in Ausbildung und nicht in Ausbildung für 15- bis 29-Jährige (2006) 421 Tabelle C4.1b Entwicklung der zu erwartenden Jahre in Ausbildung und nicht in Ausbildung für 15- bis 29-Jährige (1998 – 2006) 423 Tabelle C4.2a Anteil junger Menschen (in %), die sich in Ausbildung bzw. nicht in Ausbildung befi nden (2006) 425 Tabelle C4.3 Anteil der Population (in %), der sich nicht in Ausbildung befi ndet und erwerbslos ist (2006)427 Tabelle C4.4a Entwicklung des Anteils junger Menschen (in %), die sich in Ausbildung bzw. nicht in Ausbildung befi nden (1995, 1998 – 2006) 429 Indikator C5: Nehmen Erwachsene an beruflich veranlasster Fort- und Weiterbildung teil? 433 Tabelle C5.1a Teilnahmequote und zu erwartende Teilnahmestunden an nicht formaler, berufsbezogener Fort- und Weiterbildung, nach Bildungsstand (2003) 443 Tabelle C5.1b Zu erwartende Teilnahmestunden an nicht formaler, berufsbezogener Fort- und Weiterbildung, nach Bildungsstand (2003) 445 Kapitel D Das Lernumfeld und die Organisation von Schulen 447 Indikator D1: Wie viel Zeit verbringen Schüler im Klassenzimmer? 449 Tabelle D1.1 Pfl ichtunterrichtszeit und vorgesehene Unterrichtszeit an öffentlichen Bildungseinrichtungen (2006) 458 Tabelle D1.2a Unterrichtszeit pro Fach als Prozentsatz der insgesamt vorgesehenen Pfl ichtunterrichtszeit für 9- bis 11-Jährige (2006) 459 Tabelle D1.2b Unterrichtszeit pro Fach als Prozentsatz der insgesamt vorgesehenen Pfl ichtunterrichtszeit für 12- bis 14-Jährige (2006) 460 Indikator D2: Wie ist das zahlenmäßige Schüler-Lehrkräfte-Verhältnis und wie groß sind die Klassen im Durchschnitt? 461 Tabelle D2.1 Durchschnittliche Klassengröße, nach Art der Bildungseinrichtung und Bildungsbereich (2006)474 Tabelle D2.2 Zahlenmäßiges Lernende-Lehrende-Verhältnis in Bildungseinrichtungen (2006) 475 Tabelle D2.3 Zahlenmäßiges Schüler-Lehrkräfte-Verhältnis nach Art der Bildungseinrichtung (2006) 476 Indikator D3: Wie hoch sind die Lehrergehälter? 477 Tabelle D3.1 Lehrergehälter (2006) 491 Tabelle D3.2 Veränderung der Lehrergehälter (1996 und 2006) 493 Tabelle D3.3a Entscheidungen über Zahlungen an Lehrer an öffentlichen Bildungseinrichtungen (2006) 494 Indikator D4: Wie viel Zeit unterrichten Lehrer?497 Tabelle D4.1 Aufteilung der Arbeitszeit von Lehrern (2006) 506 Indikator D5: Wie werden Evaluationen und Leistungsmessungen in den Bildungssystemen eingesetzt? 507 Tabelle D5.1 Landesweite Prüfungen in allgemeinbildenden Bildungsgängen (Sekundarbereich I, 2006) 516 Tabelle D5.2 Regelmäßige landesweite Schülerleistungsmessungen in allgemeinbildenden Bildungsgängen (Sekundarbereich I, 2006) 517 Tabelle D5.3 Mögliche Auswirkungen landesweiter Prüfungen (Sekundarbereich I, 2006) 518 Tabelle D5.4 Mögliche Auswirkungen regelmäßiger landesweiter Schülerleistungsmessungen (Sekundarbereich I, 2006) 519 Tabelle D5.5 Mögliche Auswirkungen von Schulevaluationen durch Aufsichtsbehörden (Sekundarbereich I, 2006) 520 Tabelle D5.6 Mögliche Auswirkungen von Selbstevaluationen der Schulen (Sekundarbereich I, 2006) 521 Indikator D6: Auf welchen Ebenen werden im Bildungssystem welche Entscheidungen getroffen? 523 Tabelle D6.1 Anteil der bildungspolitischen Entscheidungen in Bezug auf öffentliche Bildungseinrichtungen im Sekundarbereich I, die auf den einzelnen Entscheidungsebenen getroffen werden (in %) (2007) 531 Tabelle D6.2a Anteil der auf der jeweiligen Entscheidungsebene getroffenen Entscheidungen in Bezug auf öffentliche Bildungseinrichtungen im Sekundarbereich I, nach Entscheidungsbereich (in %) (2007) 532 Tabelle D6.2b Anteil der auf der jeweiligen Entscheidungsebene getroffenen Entscheidungen in Bezug auf öffentliche Bildungseinrichtungen im Sekundarbereich I, nach Entscheidungsbereich (in %) (2007) 533 Tabelle D6.3 Anteil der auf Schulebene getroffenen Entscheidungen in Bezug auf öffentliche Bildungseinrichtungen im Sekundarbereich I, nach Grad der Entscheidungsautonomie (in %) (2007)534 Tabelle D6.4a Anteil der auf Schulebene getroffenen Entscheidungen in Bezug auf öffentliche Bildungseinrichtungen im Sekundarbereich I, nach Grad der Entscheidungsautonomie und Entscheidungsbereich (in %) (2007)535 Tabelle D6.4b Anteil der auf Schulebene getroffenen Entscheidungen in Bezug auf öffentliche Bildungseinrichtungen im Sekundarbereich I, nach Grad der Entscheidungsautonomie und Entscheidungsbereich (in %) (2007)536 Tabelle D6.5 Verwaltungsebene, auf der verschiedene Arten von Entscheidungen in Bezug auf den Lehrplan für öffentliche Bildungseinrichtungen des Sekundarbereichs I getroffen werden (2007) 537 Tabelle D6.6 Anteil der bildungspolitischen Entscheidungen in Bezug auf öffentliche Bildungseinrichtungen im Sekundarbereich I, die auf den einzelnen Ebenen getroffen werden (in %) (2007, 2003 und Unterschied zwischen 2007 und 2003) 539 Anhang 1 Merkmale der Bildungssysteme 541 Tabelle X1.1a Typisches Abschlussalter im Sekundarbereich II (2006) 542 Tabelle X1.1b Typisches Abschlussalter im postsekundaren, nicht tertiären Bereich (2006) 543 Tabelle X1.1c Typisches Abschlussalter im Tertiärbereich (2006) 544 Tabelle X1.2a Für die Berechnung der Indikatoren verwendete Haushalts- und Schuljahre, OECD-Länder545 Tabelle X1.2b Für die Berechnung der Indikatoren verwendete Haushalts- und Schuljahre, Partnerländer 546 Tabelle X1.3 Abschlussanforderungen für Bildungsgänge im Sekundarbereich II 547 Anhang 2 Statistische Bezugsdaten 549 Tabelle X2.1 Überblick über das wirtschaftliche Umfeld anhand grundlegender Kennzahlen (Referenzzeitraum: Kalenderjahr 2005, zu konstanten Preisen von 2005) 550 Tabelle X2.2 Grundlegende statistische Bezugsdaten (Referenzzeitraum: Kalenderjahr 2005, zu konstanten Preisen von 2005)551 Tabelle X2.3a Statistische Bezugsdaten zur Berechnung der Lehrergehälter, nach Bildungs bereich (1996, 2006) 552 Tabelle X2.3b Statistische Bezugsdaten zur Berechnung der Lehrergehälter (1996, 2006) 554 Tabelle X2.3c Lehrergehälter (2006) 555 Anhang 3 Quellen, Methoden und technische Hinweise 557 Literatur 559 Mitwirkende an dieser Publikation 561 Weiterführende OECD-Publikationen 565 |
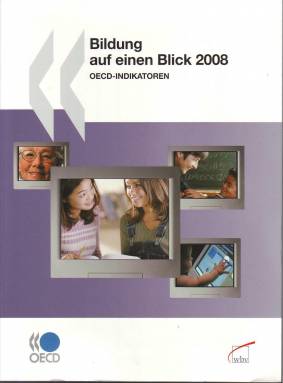
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen