|
|
|
Umschlagtext
Um Menschen ein würdevolles Sterben zu ermöglichen, sollten ihre Wünsche und Bedürfnisse sensible Aufmerksamkeit finden. Wie kann das gelingen - in Klinik und Altenheim, in Hospiz und zu Hause?
In diesem Band bündeln Autorinnen und Autoren verschiedener Fachrichtungen und Tätigkeitsfelder aus den Bereichen Palliativmedizin, Hospizarbeit und Sterbebegleitung ihr Wissen und ihre Erfahrung. Entstanden ist ein Lern- und Lesebuch für alle, die Sterbende begleiten und mit ihnen gemeinsam das Leben im Übergang gestalten und zu einem guten Ende bringen wollen. Mit einem Geleitwort von Monika Müller und Beiträgen von Cornelia Jakob-Krieger, Marianne Kloke, Ernst Richard Petzold, Klaus Strasser und Michael Zenz. Rezension
Die Verdrängung des Todes und die Verlagerung des Sterbens in besondere Einrichtungen und Institutionen führen zu einem wachsenden Bedürfnis nach Orientierung über die Art und Weise, Sterbende auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Die Sterbephase als Teil des Lebens nimmt einen immer bedeutenderen Raum ein. Zugleich ist die Gesellschaft immer noch einem Jugendwahn verfallen, der Sterben und Tod weitgehend ignoriert und tabuisiert. Dieses Handbuch gibt in 9 Kapiteln (vgl. Inhaltsverzeichnis) Anregungen für eine gute Sterbebegleitung - sowohl für Laien wie für Profis. Das Buch versammelt Wissen und Erfahrungen von Autor/innen aus verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen und beruflichen Tätigkeitsfeldern. Sie alle beziehen sich auf Sterbebegleitung, Hospizarbeit oder Palliativmedizin.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die letzte Lebensphase würdevoll und sensibel gestalten Um würdevoll sterben zu können, sollten die Wünsche und Bedürfnisse des sterbenden Menschen sensible Aufmerksamkeit finden. Wie kann das gelingen – in Klinik und Altenheim, in Hospiz und zu Hause? In diesem Band bündeln Autorinnen und Autoren verschiedener Fachrichtungen und Tätigkeitsfelder aus den Bereichen Palliativmedizin, Hospizarbeit und Sterbebegleitung ihr Wissen und ihre Erfahrung. Entstanden ist ein Lern- und Lesebuch für alle, die Sterbende begleiten und mit ihnen gemeinsam das Leben im Übergang würdevoll gestalten und zu einem guten Ende bringen wollen. Professor Dr. Klaus Strasser, 1980 - 2005 Leitender Arzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen, ist seit mehr als 20 Jahre in der Hospizarbeit engagiert; seit 2008 Vorstand Hospizarbeit Essen e.V. Diplom-Soziologe Klaus Körber, langjährige Forschungs- und Lehrtätigkeit v.a. zu Fragen von Bildung, Arbeit und bürgerschaftlichem Engagement; zusammen mit seiner verstorbenen Frau Karin langjährige Erfahrungen in ehrenamtlicher Sterbebegleitung. Professor Dr. Ernst Richard Petzold, nach Studium der Evangelischen Theologie und Humanmedizin Facharzt für Innere Medizin und Psychotherapeutische Medizin; 1991 - 2003 Lehrstuhlinhaber sowie Klinikdirektor für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der RWTH Aachen; 1997 - 2009 erster Vorsitzender der Deutschen Balintgesellschaft; Mitbegründer und Herausgeber des Balint Journals. Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Klaus Strasser, Klaus Körber, Ernst Richard Petzold 11 Geleitwort Monika Müller 12 1. Gelingendes Begleiten am Lebensende Klaus Strasser, Marion Kutzner 15 1.1 Entwicklungstendenzen zum Lebensende in der modernen Gesellschaft 16 1.2 Das Besondere der letzten Lebensphase 17 1.3 Kommunikation am Lebensende – Basale Stimulation 18 1.3.1 Atemstimulierende Einreibung 21 1.3.2 Arm- und Handeinreibung 21 1.3.3 »Es ist unvorstellbar« 22 1.3.4 Nonverbale – verbale Signale 22 1.3.5 Noch ein Beispiel aus dem Leben 25 1.4 Wahrheit und Wahrhaftigkeit 26 1.5 Angst und Furcht infolge einer Auseinandersetzung mit der Wahrheit 28 1.6 Hoffnung, Hoffnungsinhalte, Phasen der Hoffnung 28 1.6.1 Phasen der Hoffnung 30 1.6.2 Hoffnungskonflikte zwischen Patient und Angehörigen 31 1.7 Regeln zur Begleitung am Lebensende 32 1.8 Auf dem Weg zum Gelingenden Begleiten 33 2. Palliative Therapiekonzepte am Lebensende – Schmerztherapie und Symptomkontrolle Marianne Kloke 35 2.1 Schmerztherapie 35 2.1.1 Was ist Schmerz? 35 2.1.2 Entstehung und Erfassung von Schmerzen 36 2.1.3 Planung der Schmerzbehandlung 37 2.1.4 Methoden der Schmerzbehandlung 37 2.1.5 Schmerzbehandlung mit Medikamenten 38 2.1.6 Grundregeln medikamentöser Schmerzbehandlung 38 2.2 Fragen und Antworten zu Opiaten 41 2.3 Ergänzende Schmerzmittel (Ko-Analgetika) 44 2.4 Behandlung von Symptomen des Magen-Darm-Traktes 47 2.4.1 Appetitlosigkeit außerhalb der Sterbephase 47 2.4.2 Übelkeit und/oder Erbrechen 51 2.4.3 Verstopfung (Obstipation) 53 2.4.4 Durchfall (Diarrhoe) 56 2.4.5 Bauchwasser (Aszites) 57 2.4.6 Gelbfärbung von Haut und Augenbindehaut (Gelbsucht = Ikterus) 58 2.4.7 Darmlähmung/-verschluss (Ileus) 58 2.5 Symptome des Atemtraktes 59 2.5.1 Husten 59 2.5.2 Luftnot (Dyspnoe) 60 2.5.3 Erstickungsangst 63 2.6 Psychische und neurologische Symptome 63 2.6.1 Akutes Verwirrtheitssyndrom (Delir) 63 2.6.2 Innere Unruhe und Angst 66 2.6.3 Depression 67 2.6.4 Erschöpfung (Fatigue) 69 2.7 Symptome der Haut 71 2.8 Therapeutische Sedierung 72 2.8.1 Was tun, wenn alles nicht mehr hilft? 72 2.8.2 Durchführung einer Sedierung 72 2.9 Besonderheiten der Sterbephase 74 2.9.1 Einleitung 74 2.9.2 Kennzeichen der letzten Lebensphase 74 2.9.3 Medizinisch pflegerische Betreuung 76 2.9.4 Spirituelle Begleitung 76 2.9.5 Rechte des Sterbenden und ihre Anwendung 77 3. Supervision – Besonderheiten in der Arbeit mit Ehrenamtlichen im ambulanten Hospizdienst Cornelia Jakob-Krieger 82 3.1 Wie kann Supervision in diesem Feld aussehen? 83 3.1.1 Integrative Supervision – theoretischer Hintergrund 83 3.1.2 Der komplexe Leibbegriff 83 3.1.3 Die Intersubjektive Ko-respondenz 84 3.1.4 Die hermeneutische Spirale 85 3.1.5 Komplexes Lernen 86 3.1.6 Das Tetradische System 87 3.1.7 Ein Praxisbeispiel 87 3.1.8 Bezug zur Theorie 90 3.2 Was kann (oder sollte) Supervision für die Ehrenamtlichen im ambulanten Hospizdienst leisten? 93 3.3 Weiterbildungen als Ergebnis von Supervision 95 4. Balintarbeit – eine Heimat für Ärzte, warum nicht auch für Ehrenamtliche? Ernst Richard Petzold 97 4.1 Michael Balint 98 4.2 Gott in der Vorlesung 99 4.2.1 Ganzheit von Körper und Seele 99 4.2.2 Es kann aber auch anders sein 100 4.3 Sterben? 101 4.4 Struktur und Methoden der Balintarbeit 102 4.5 Zur Weiterentwicklung der Balintarbeit 104 4.5.1 Frau A. – »Ich möchte sie am liebsten schütteln!« 105 4.5.2 Frau O. – teilnehmende Fragen 107 4.5.3 »Begleitung auf dem letzten Weg« 111 4.6 Balintarbeit – drei Verständnis-Positionen 113 4.6.1 Training verbunden mit Beziehungsforschung 113 4.6.2 Patientenzentrierte Selbsterfahrung 114 4.6.3 Herrschaftsfreier Raum 114 4.7 Balint – Anthropologische Medizin – Evidence Based Medicine 114 4.8 »Balintarbeit – eine Art Heimat, eine Art Urlaub« 116 4.9 Abschied und Neubeginn 118 5. Sind wir auf dem Weg zu einer neuen Sterbekultur? Klaus Körber 120 5.1 »Oh Herr, gib jedem seinen eignen Tod« – Statt einer Einleitung 120 5.2 »Der Tod ist immer gleich, doch jeder stirbt seinen eigenen Tod« 123 5.3 »Sterben wird in der Neuzeit aus der Merkwelt der Lebenden immer weiter herausgedrängt« 127 5.4 »Der Tod hat keine eigenständige Bedeutung mehr« 130 5.5 »Die Aufgabe des Arztes ist es, manchmal zu heilen, häufig zu lindern, immer zu trösten« 132 5.6 Vom »Heiligen Tod im Felde« zu »Thanatotainment« und »Tod 2.0« 137 5.7 »Der Tod und was danach kommt« 142 5.8 Auf dem Weg zu einer neuen Sterbekultur 148 6. Angehörige, Freunde, Ehrenamtliche – Sterbebegleitung, persönliches Vertrauen und bürgerschaftliches Engagement Klaus Körber 149 6.1 Karins Geschichte 150 6.2 Vertrauen in die Medizin und dessen Grenzen 152 6.3 Zusammenbruch der existenziellen Selbstgewissheit 156 6.4 Angehörige und Freunde: Vertraute Begleiter – hilfreiche Wirkungen 160 6.5 Spontanremission, Selbstheilung, Spiritualität 164 6.6 Die meisten wollen zu Hause sterben – aber nicht alle 170 6.7 Palliativmedizin, Palliative Care und Zu-Hause-Sterben 175 6.8 Die Hospizbewegung »am Scheideweg« zwischen Gesundheitssystem und bürgerschaftlichem Engagement 180 6.9 Zur Zukunft der Hospizbewegung 184 6.10 Bürgerschaftliches Engagement ist unverzichtbar 189 7. Ärztliche Aufgaben am Lebensende Klaus Strasser 191 7.1 Die Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung 192 7.2 Begriffe zur Sterbehilfe 193 7.2.1 Sterbehilfe – der Begriff 193 7.2.2 Passive Sterbehilfe 194 7.2.3 Indirekte Sterbehilfe 194 7.2.4 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung 195 7.3 Meinungen und Erwartungen in Gesellschaft und Ärzteschaft 197 7.4 Beispiele der Meinungsänderung bei Betroffenen zur Lebensbeendigung 198 7.5 Aktuelle, brisante Fragestellungen 200 7.6 Regelungen zur Euthanasie in europäischen Ländern 202 7.6.1 Niederlande 202 7.6.2 Belgien 203 7.6.3 Dänemark 204 7.6.4 Deutschland 204 7.7 Kommunikation – Gespräche mit Sterbenden 204 7.7.1 Kommunikation mit Demenz-Patienten 205 7.7.2 SPIKES-Protokoll 205 7.7.3 Befähigung zur Kommunikation 209 7.8 Patientenverfügung 209 7.8.1 Das neue deutsche Gesetz 210 7.8.2 Gedanken zur Patientenverfügung aus ärztlicher Sicht 211 7.8.3 Gründe und Anlässe zur Erstellung einer Patientenverfügung 212 7.8.4 Das Beratungsgespräch 212 7.8.5 Ärztliche Kompetenz für die Beratung 214 7.8.6 Besondere Situationen für die Patientenverfügung 214 7.8.7 Zusammenfassende Schlussgedanken zur Patientenverfügung aus ärztlicher Sicht 217 7.9 Palliativmedizin 218 7.9.1 Situation in Deutschland 218 7.9.2 AAPV und SAPV 220 7.9.3 Künstliche Ernährung 221 7.10 Die wichtigsten ärztlichen Aufgaben am Lebensende – Resümee 223 8. Gibt es einen guten Tod? – Fragen nicht erst zum Lebensende Michael Zenz 224 8.1 Sterben in Würde 224 8.2 Für einen guten Tod 227 8.3 Divergierende Studienergebnisse 227 8.4 »Bist du im Frieden mit dir selbst?« 229 8.5 Vorbereiteter, natürlicher Tod 229 9. Leben und Sterben – Kirche, Religion, Spiritualität und unsichtbare Bindungen Ernst Richard Petzold 231 9.1 »Ehrenamtliche« 232 9.2 Geschichten für die »große Reise« 233 9.2.1 Tolstoi – Parzival 233 9.2.2 Die Frage nach dem Himmel 234 9.2.3 Tod – Jenseitsglaube – Rituale 235 9.2.4 »Das Leben selbst stirbt nicht« 237 9.2.5 Religion: was den Menschen und seine Welt übersteigt 238 9.2.6 Gilgamesch, Orpheus – Himmel, Hölle, Fegefeuer 239 9.3 Leben im Übergang – Sterben und Tod 240 9.4 Rituale und Bräuche im Umgang mit Tod und Sterben 242 9.4.1 Totenglocke 242 9.4.2 Ewigkeits-/Totensonntag 243 9.4.3 »Liegen hier Menschen?« 243 9.4.4 Bestattungsweisen 244 9.4.5 Zur Funktion von Ritualen und Bräuchen 244 9.4.6 Zugang zur Transzendenz 245 9.4.7 Wozu Religion und Kirchen? 245 9.5 Unsichtbare Bindungen 247 9.6 Träume können unsichtbare Bindungen sichtbar machen 249 9.7 Spiritualität und Religion – Kontakt mit »drüben« 251 9.7.1 »Readings« 251 9.7.2 »Ewiges Leben« 253 9.7.3 »Spiritualität« – »Religiosität« 253 9.8 Fragen an die Religion sind Lebensfragen 254 9.8.1 Gegenwind Gottes 254 9.8.2 Worte und Zeichen 255 9.8.3 »Diktate über Tod und Sterben« 256 Literaturhinweise 259 Die Herausgeber, Autorinnen und Autoren 272 Vorwort Mit diesem Buch möchten wir Menschen erreichen, die sich engagiert mit der letzten Lebensphase beschäftigen und auseinandersetzen – Menschen, die dies aus ganz persönlichen Gründen tun, ebenso wie Menschen, die sich aufgrund beruflichen oder ehrenamtlichen Engagements für ein würdevolles Sterben einsetzen. Das Buch versammelt Wissen und Erfahrungen von Autoren und Autorinnen aus verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen und beruflichen Tätigkeitsfeldern. Sie alle beziehen sich auf Sterbebegleitung, Hospizarbeit oder Palliativmedizin. So ist ein Lern- und Lesebuch entstanden für alle, die Sterbende begleiten. Bei der Themenauswahl als auch bei der sprachlichen Darstellungsform haben wir deshalb besonderen Wert darauf gelegt, dass die einzelnen Beiträge für Laien verständlich sind und dennoch auch interessant und informativ für Fachleute. Leben im Übergang: Die letzte Lebensphase gehört noch zum Leben, aber sie unterscheidet sich bereits deutlich davon. Viele Erfahrungen der Sterbenden sind einmalig und ganz anders als die in ihrem bisherigen Leben. Die Unausweichlichkeit des Todes verleiht ihnen eine besondere existenzielle, oftmals bedrohliche und Angst machende Dringlichkeit. In dieser Situation kommt es auf persönliche Zuwendung und gelingendes Begleiten an. Es geht nicht mehr um Heilen und Leben-Verlängern, sondern darum, Schmerzen und andere Beschwerden zu lindern und ein »gutes Sterben« zu ermöglichen. Und es geht um Wertschätzung, Sinn und Trost. Deshalb spielen in dieser Phase neben angemessener medizinischer und pflegerischer Betreuung psychosoziale und spirituelle Achtsamkeit und Unterstützung eine so große Rolle. Das sind gemeinsame Aufgaben, an denen nicht nur professionelle Helfer und ehrenamtliche Begleiterinnen, sondern auch Angehörige und Freunde der Sterbenden zu beteiligen sind. Bei der Erstellung des Buches haben wir intensive Unterstützung von unseren Familien und Freunden erfahren, dafür sind wir allen sehr dankbar. Besonderer Dank für die finanzielle Förderung unseres Projektes gilt Herrn Prof. Dr. h. c. mult. Berthold Beitz, Vorsitzender und geschäftsführendes Mitglied des Kuratoriums der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Zum guten Gelingen des Vorhabens hat sicher beigetragen, dass die drei Herausgeber seit der Schulzeit Freunde sind und sich über einen längeren Zeitraum und lange vor dem Buchprojekt immer wieder über diese Thematik miteinander ausgetauscht haben. Wir hoffen, dass unser Buch einen Beitrag dazu leistet, Sterben und Sterbebegleitung endgültig aus der Tabuzone zu holen und eine neue Sterbekultur auf den Weg zu bringen, die einen Rahmen schafft für ein würdevolles und möglichst sinnerfülltes Sterben in unserer Gesellschaft. Im Februar 2013 Klaus Strasser, Klaus Körber, Ernst Richard Petzold Geleitwort Was bewirkt eine »neue Sterbekultur«? Wir wissen doch, was Hospizarbeit und Palliativmedizin bewirken oder bewirken sollen: ein Sterben in Schutz und Geborgenheit, Schmerzlinderung und sogar Schmerzfreiheit, eine Verbesserung der quälenden Symptome wie Atemnot, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen, auch die Erleichterung von Sorgen und Ängsten. Lebensqualität, so können wir es immer wieder werbend sagen, die Lebensqualität steht im Vordergrund, diese wollen wir bestärken oder wieder herstellen. Und – so wissen wir außerdem – es geht in der Hospizarbeit darum, nicht dem Leben mehr Tage hinzuzufügen, sondern den Tagen mehr Leben, wie es Cicely Saunders so treffend sagte. All das wissen wir und setzen es tagtäglich um. Unsere Dienste und Institutionen sind bekannt, stehen für Qualität, wir haben Ansehen, viele sterbende Menschen und ihre Familien danken es uns. Also: was soll die Frage? Nun, ich meine mit meiner Frage ja gar nicht die Patienten, die Gäste, die, denen unsere Sorge und Hingabe gilt, auch nicht ihre Angehörigen und Freunde. Ich meine: uns selbst. Uns, die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die anderen Hauptberuflichen in den Pflegediensten, Krankenhäusern, Altenheimen, Pfarren, Arztpraxen, die im weitesten Sinne mit zu unserem Team gehören. Was bewirkt in uns Hospizarbeit? Da ist vielleicht gar nicht so schnell zu antworten. Und mit verbesserter Lebensqualität können wir die Frage auch nicht abtun, denn da ist oft großes Leid, das uns nahe geht, ja häufig nachgeht, da ist die Frage nach dem Sinn und der Theodizee, da lassen uns Bilder von Krankheiten und Nöten manches Mal nicht schlafen, da entwickeln sich in uns Ängste, dass auch wir krank werden, einen geliebten Menschen verlieren können, da opfern wir viel Zeit und Kraft. Und doch. Die neue Sterbekultur bewirkt etwas in uns. Da ist vielleicht zum einen das Erkennen der Kostbarkeit von Leben. So zart, so zerbrechlich, und wir haben gelernt, behutsamer mit diesem Leben umzugehen. Vielleicht gelingt es uns heute mehr und öfter als früher, dieses Geschenk anzunehmen, es bewusst umzusetzen und nicht zu warten und zu verschieben auf ein Demnächst, auf ein Später, wenn … Vielleicht leben wir mehr und tiefer in den Minuten und Stunden und Tagen, die uns gegeben sind. Vielleicht haben wir auch gelernt, Ballast abzuwerfen von dem, was nicht nötig ist, was nur Beiwerk und Äußeres ist, was wir nicht durch unser Leben schleppen wollen bis zur letzten Stunde. Dazu gehören vielleicht auch Beziehungen, die uns nicht mehr gut tun, Menschen, die uns ausnutzen, Tätigkeiten, die uns nur noch ermüden. Es ist auch vorstellbar, dass uns die Arbeit und das Leben mit der Hospizidee in eine andere Kommunikation mit anderen und mit uns selber bringt. Indem sich der Mensch seiner selbst bewusst wird, ist es ihm möglich, eine Position außerhalb seiner selbst einzunehmen und von dort aus zu reflektieren. Sich von außen zu sehen heißt: Sich mit den Reaktionen anderer auf sich selbst und den eigenen Reaktionen auf andere beschäftigen. Auf diese Weise kommt der Mensch zu einer Selbstdefinition und zu einem Selbstverständnis, an denen er seine Handlungen, auch die kommunikativen, orientiert. Das Kommunikationsverhalten eines Menschen wird von seiner Selbstdefinition und seinem Selbstverständnis entscheidend geprägt. Seine Kommunikationen sind nachweisbar entsprechend der Art, wie er sich selbst versteht. Möglicherweise ist auch die Auseinandersetzung mit Leid etwas, was wir nach all den Jahren auf der Haben-Seite spüren. Gerade die Arbeit mit sterbenden Menschen, der Umgang mit Leid und unausweichlicher Endlichkeit erfordert eine intensive Auseinandersetzung und stellt intraindividuell die Frage an den Helfer: »Wie steht es mit dem eigenen Leid?«, also die Frage nach der eigenen Leidfähigkeit. Es scheint der moderne Mensch und hier besonders die Mitarbeiter des Gesundheitssystems von einer besonderen Krankheit befallen zu sein: er kann und will nicht mehr Leiden mit ansehen und zulassen. Zur Geschöpflichkeit des Menschen – auch des Arztes, der Pflegekraft, der anderen Berufsgruppenzugehörigen – gehören selbst in der Palliativmedizin und Hospizarbeit, bei allen Fortschritten in Schmerztherapie und Symptomkontrolle, Enttäuschungen, Verzichte, Frustrationen, Hilflosigkeit, schmerzliche Abschiede und angsterzeugende Neuanfänge. Sich mit diesen Leidspuren im eigenen Leben auseinander zu setzen und sich ihnen in Wahrheit zu stellen, muss geleistet werden, damit man sich den sterbenden Patienten und ihrer Wirklichkeit in Wahrheit stellen kann. Sich der Wahrheit zum eigenen Leiden und eigenen Tode zu stellen, meint das Hereinnehmen des Todes in die eigene Existenz. In eine solche Haltung wird man nicht hineingeboren, man kann in sie nur allmählich hineinwachsen. Man kann sie auch verfehlen, und es gibt mehr Beispiele für die letztere als für die erstere. Aber dadurch wird nicht widerlegt, dass Wert und Wirkung helfenden Beistandes beim fremden Tod eine Echtheit gegenüber der Tatsächlichkeit des Todes voraussetzten, die nur im Vorbewusstsein des eigenen Todes und durch innere Reifung zu ihm gewonnen werden kann. Es kommt nicht nur auf das Todesverständnis an, also auf die intellektuelle Akzeptierung einer Lehre vom Tod, sondern auf die Todesaneignung, also auf das existenzielle Annehmen einer über uns verhängten Bestimmung, die doch in Freiheit von uns beantwortet werden will. In der Wahrheit zum eigenen Leid und Tod stehen bedeutet, sich selbst auch als wesensmäßig Leidender und Sterbender zu erkennen und daraus die Folgerung zu ziehen, sein Leben darauf hin zu gestalten. Und wenn wir dieser ernsten Wahrheit dann auch noch mit Humor begegnen können, dann haben wir in der Hospizarbeit unseren größten Lehrmeister gefunden. Denn Ernst ist nicht das Gegenteil des Humors, sondern im Ernst hat der Humor seinen Wurzelgrund. Der Ernst besteht im Bewusstsein der vollkommenen Übereinstimmung und Kongruenz eines Begriffs oder Gedankens mit dem Anschaulichen oder der Wirklichkeit. Der Ernst kennt und weiß um die Tragik der Situation und ihre Ausweglosigkeit. Der Humor ergänzt ihn, geht noch einen Schritt weiter, benennt das Verhängnis ohne Peinlichkeit und verzichtet auf Ausflucht und Beschönigung. Der Humor versucht, durch Verschieben eine Diskrepanz zuwege zu bringen, um nicht in eine Identität mit dem Verhängnisvollen zu geraten. Der Humor bejaht; er könnte es nicht, wenn er nicht durchschaute und sich eine gewisse innere Unabhängigkeit bewahrte. Der Humor weiß um die Bedrohung, aber er stellt sich ihr aus einer tief eingewurzelten Lebensfreude und -wärme, begegnet ihr mit Güte, nicht mit Schärfe. Wir sind mehr als die Verhältnisse, in denen wir uns befinden. Wir können sie mit diesem Wissen auch verändern. Das kann die neue Sterbekultur bewirken. Und diese Wirkkraft wünsche ich Ihnen und mir und allen Leserinnen und Lesern dieses Buches von Herzen. Monika Müller Geleitwort 1. Gelingendes Begleiten am Lebensende 15 1. Gelingendes Begleiten am Lebensende | Klaus Strasser und Marion Kutzner | »Der Tod ist doch etwas so Seltsames, dass man ihn, unerachtet aller Erfahrung, bei einem uns teuren Gegenstand nicht für möglich hält und er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes eintritt. Er ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. Und dieser Übergang aus einer uns bekannten Existenz in eine andere, von der wir gar nichts wissen, ist etwas so Gewaltsames, dass es für die Zurückbleibenden nicht ohne tiefe Erschütterung abgeht.« Johann Wolfgang von Goethe im Gespräch mit Eckermann zum Tode eines nahen Menschen Einleitende Erklärung Die nachfolgend dargestellten Gedanken beruhen auf den Ergebnissen der hospizlichen Arbeit beider Autoren, zuletzt seit mehreren Jahren gemeinsam im ambulanten Hospizdienst am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen. Dieser wurde von mir 1994 gegründet und wurde zu Beginn getragen von den Teilnehmern meines Gesprächskreises Patientenbegleitung in der letzten Lebensphase, den ich mehr als 20 Jahre geleitet habe. Die zahlreichen und sehr eindrücklichen Darstellungen von Begegnungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer Hospizgruppe mit den Sterbenden haben unser Wissen über und unsere Erfahrung in der Hospizarbeit ebenso bereichert wie die wissenschaftlichen Veranstaltungen, davon sieben Symposien, die wir gemeinsam mit allen Essener Hospizgruppen durchgeführt haben. Ein wichtiges Ziel zur wesentlichen Verbesserung der Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase war auch die Vernetzung der in Essen tätigen Palliativ- und Hospizgruppen 2003 im Netzwerk Palliativmedizin Essen (NPE), zu dessen Gründungsmitgliedern ich gehörte. Wenn im Text die Ich-Form gewählt wird, so ist damit Klaus Strasser und auf der Seite 21 Marion Kutzner gemeint. 16 Klaus Strasser und Marion Kutzner 1.1 Entwicklungstendenzen zum Lebensende in der modernen Gesellschaft Sterben gehört zum Leben, Sterben ist Leben, Leben im Übergang. Während früher Sterben und Tod eine Angelegenheit der ganzen Familie waren, ist dies heute eher die Ausnahme, da die meisten Menschen im Krankenhaus oder Altenheim sterben. Unsere Gesellschaft hat den Bereich Sterben und Tod weitgehend aus ihrem Bewusstsein ausgeklammert. Die Ausgrenzung der letzten Lebensphase aus dem familiären und häuslichen Bereich hat letztendlich zur Tabuisierung und Anonymisierung geführt. Der Tod ist bei uns kein Thema. Darin ist einer der Hauptgründe für die Furcht in unserer Gesellschaft vor dem Umgang mit Sterben und Tod zu sehen. Beim Sterbenden kann es Furcht davor sein, die Belastung der letzten Phase nicht ertragen zu können oder auch den Angehörigen zu sehr zur Last zu fallen, auch Furcht davor, Schmerzen erleiden zu müssen. Bei den Angehörigen ist es oft Furcht davor, der Belastung nicht gewachsen zu sein, die sich aus vielschichtigen Problemen beim Sterbenden ergeben können. Bei allen Beteiligten wird Furcht auch durch die Frage nach dem Lebenswert ausgelöst, nicht zuletzt deshalb, weil schon die Frage danach, sowohl beim Fragenden als auch viel mehr noch beim Befragten, die verneinende Antwort impliziert. Der Theologe und Philosoph Ulrich Eibach lehnt in diesem Kontext sehr entschieden die in anderen philosophischen Richtungen vertretene Meinung ab, dass das Leben des Menschen dann beendet werden könne, »wenn er selbst kein bewusstes Interesse am Leben mehr äußern könne und/oder für andere, z. B. Angehörige, und die Gesellschaft zur dauernden Last werde« (vgl. Eibach, 1997). Vom australischen Philosophen Peter Singer werden zu dieser Personengruppe Demente, Komapatienten und Neugeborene gezählt (vgl. Singer, 1984). Als Vertreter einer utilitaristischen Philosophie misst er den Wert des Menschen an seinem Nutzen für die Gesellschaft. Da die Gesellschaft einen größtmöglichen Anspruch auf Autonomie in allen Lebenssituationen stellt, ist es verständlich, dass auch für die letzte Lebensphase der Ruf nach Regelung und Beseitigung von Unsicherheiten laut geworden ist. Aktive Sterbehilfe, also Tötung, ist nicht selten in unserer Gesellschaft eine der geforderten Lösungsmöglichkeiten. Auch der Theologe und Philosoph Hans Küng sieht unter Einhaltung gewisser Bedingungen in der Euthanasie eine Lösung für problematische Sterbesituationen: »Die Frage nach dem menschenwürdigen Sterben darf [...] nicht davon (von der aktiven Sterbehilfe) losgekoppelt bleiben« (Jens/Küng, 1995). 1. Gelingendes Begleiten am Lebensende 17 In den Niederlanden wird die strafrechtlich nicht verfolgte Euthanasie seit Beginn der 1990er Jahre praktiziert und ist seit Längerem gesetzlich geregelt. Der Philosoph Robert Spaemann und der Mediziner Thomas Fuchs weisen in ihrem Werk zur Euthanasiedebatte »Töten oder sterben lassen« sehr eindrücklich auf die Fragwürdigkeit der in unserem Nachbarland praktizierten Vorgehensweise hin (vgl. Spaemann/Fuchs, 1997). Sie erwähnen auch das von dem australischen Arzt P. Nitschke entwickelte computergesteuerte Death-Delivery-System, mit dem sich am 26.09.1996, drei Monate nach Legalisierung der Euthanasie in Nordaustralien, erstmals ein krebskranker Patient durch Tastendruck die programmierte tödliche Injektion verabreichte. Der Arzt brachte die Apparatur am Patienten an, der sie dann mittels eines Laptops startete und sich die tödliche Dosis injizierte. Vier Jahre später wurde die Legalisierung der Euthanasie in Australien wieder aufgehoben. Während Euthanasiebefürworter die letzte Lebensphase als nicht lebenswert verstehen und dem Leben deshalb ein Ende setzen wollen, besteht der Hospizgedanke darin, die Sterbephase so zu gestalten, dass diese für den Betroffenen (eben doch) lebenswert ist und er seine Würde bewahren kann. Dies ist das wertvolle Ziel des Gelingenden Begleitens. Möglich wird es durch das Engagement von Angehörigen und Freunden sowie den Einsatz der ehrenamtlichen und professionellen Mitarbeiter hospizlicher und palliativer Einrichtungen (vgl. Müller, 2004). 1.2 Das Besondere der letzten Lebensphase Die letzte Lebensphase erlebt jeder Mensch ganz persönlich (vgl. Körber, Kapitel 5: Sind wir auf dem Weg zu einer neuen Sterbekultur?). Sie ist gekennzeichnet durch Einmaligkeit und Bedingungslosigkeit. Bereits im Verlauf des Lebens erleben wir Situationen, die durch Einmaligkeit und Bedingungslosigkeit charakterisiert sind. Die Einmaligkeit ist Merkmal des menschlichen Lebens, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Nicht immer erkennen wir die Bedingungslosigkeit von Situationen und Entwicklungen. Im allerletzten Abschnitt unseres Lebens allerdings werden wir uns der Auseinandersetzung mit der Einmaligkeit und Bedingungslosigkeit nicht entziehen können, vorausgesetzt, unser Denkvermögen ist uns erhalten geblieben. Sterbende jedoch sind manchmal nicht oder noch nicht bereit, dies zu akzeptieren. Von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross wissen wir, dass es Phasen im letzten Lebensabschnitt gibt, in denen sich die Betroffenen auflehnen oder auch eine Verhandlungsstrategie entwickeln, um Sterben und 18 Klaus Strasser und Marion Kutzner Tod zu umgehen oder zumindest aufzuschieben (vgl. Kübler-Ross, 1971). In dem Abschnitt über die Hoffnung wird darauf in diesem Kapitel noch besonders eingegangen. Es ist gut und wichtig, um diese Dinge zu wissen, damit uns die Begleitung eines Menschen am Lebensende gelingt. Dem Betroffenen soll ein Sterben in Würde bei weitestgehender Erhaltung seiner Autonomie ermöglicht werden. Dazu gehören eine menschenwürdige Unterbringung, emotionale Zuwendung, Körperpflege, das Lindern von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie das Stillen von Hunger und Durst. So wird es auch als Basisbetreuung und ärztliche Aufgabe in der Präambel der »Grundsätze der Bundesärztekammer « von 2011 bezeichnet (Bundesärztekammer, 2011). Um diese Ziele zu erreichen, sind Liebe, Fürsorge, Demut, Toleranz und Bescheidenheit erforderlich. Sie bilden eine wichtige Voraussetzung für gelingendes Begleiten. Darüber hinaus sind Kenntnisse erforderlich über Bedingungen für eine gelingende Kommunikation, für den Umgang mit Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Hoffnung. Welche Orientierungshilfen gibt es nun für eine gute Begleitung? • Sich für die Zeit der Begleitung ganz einbringen, aber sich selbst nicht verlieren. • Offen für die Wünsche des Betroffenen sein, aber kritisch damit umgehen. • Sich auf Nähe einlassen, wenn der Betroffene es will, aber dabei Distanz wahren. • Auf Augenhöhe achten. • Bereit sein, zuzuhören, sich öffnen für das, was der Sterbende sagen will. So wird er ermutigt, auch über wichtige Themen zu sprechen, die ihn beschäftigen. • Daran denken, dass Menschen in der letzten Lebensphase oft nonverbale Kommunikationssignale geben. 1.3 Kommunikation am Lebensende – Basale Stimulation Kommunikation findet zu einem großen Teil nonverbal durch Körperhaltung, Mimik, Handbewegung, Blick, Gesten, Verhalten und Grundstimmung statt. Stimmhafte Kommunikation hingegen vollzieht sich verbal durch Worte und hat einen vokalen Anteil durch Lautstärke, Stimmlage, Betonung, Pausen und Sprechgeschwindigkeit (vgl. Bucka-Lassen, 2005). 1. Gelingendes Begleiten am Lebensende 19 Für die Kommunikation am Lebensende ist es wichtig, diese Komponenten zu kennen, wobei zusätzlich einige Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Oft spüren die Betroffenen eher als die Angehörigen und das medizinische Personal ihr nahendes Ende. Wir nehmen an, dass sie Informationen aus einer Welt erhalten, die uns verschlossen ist, aus der Welt des Sterbens. Es ist für Sterbende schwer bzw. unmöglich, das in der Welt des Sterbens Erfahrene wiederzugeben. Dafür lassen sich nur schwer oder gar keine Worte finden, denn unsere Sprache kommt ja aus der Welt des Lebens. Dennoch kann Kommunikation am Lebensende zwischen Sterbenden und Begleitenden gelingen. Eine besondere Form nonverbaler Kommunikation ist die Basale Stimulation. Sie basiert auf dem Grundgedanken hospizlicher Begleitung, dass einem Sterbenden die Nähe eines anderen Menschen guttut. Sterbende sollen die Gewissheit haben, nicht allein gelassen zu werden, wenn sie ihre letzten Lebensschritte gehen. Da in der letzten Lebensphase häufig eine verbale Kommunikation nicht mehr möglich ist, kann die Anwendung der Basalen Stimulation in der Begleitung eines schwerstkranken sterbenden Menschen Kommunikationsmöglichkeiten bieten, die keiner Worte bedürfen. Körperkontakt und nonverbale Kommunikation spielen im menschlichen Sozialverhalten eine zentrale Rolle. Körperkontakt ist die ursprüngliche Form der sozialen Kommunikation. Kein Mensch kann auf Dauer ohne Berührung und Kontakt existieren. Behutsame zwischenmenschliche Berührung vermittelt von der Geburt bis zum Tod das Gefühl von Nähe und Geborgenheit und beeinflusst entscheidend unsere Wahrnehmung, Gefühle, Gedanken, unser Wohlbefinden und unsere Heilungsprozesse (vgl. Sieveking, 1997). Basale Stimulation sieht den Menschen als ganzheitliches Wesen, dem Respekt gebührt, das für sich Verantwortung trägt und in Autonomie lebt. »Wenn es gelingt, Menschen dabei zu unterstützen, sich in dieser entscheidenden letzten Lebensphase nicht zu verlieren, die Orientierung auf sich selbst zu behalten, die Sinne langsam ausklingen zu lassen und so die Lösung von dieser Welt zu bewältigen, so scheint uns das wertvoll und wichtig« (Fröhlich, 2004). Basale Stimulation hat ihren Ursprung in der Sonderpädagogik. 1975 entwickelte Andreas Fröhlich, zu diesem Zeitpunkt Sonderpädagoge an einem Rehabilitationszentrum für körper- und mehrfach-behinderte Kinder und Jugendliche, das Konzept der Basalen Stimulation zur Förderung geistig und körperlich behinderter Kinder und Jugendlicher. Durch die Anwendung der Basalen Stimulation ist es möglich, den Mangel an Eigenerfahrung, Eigenbewegung und Auseinandersetzung mit der Umwelt zu kompensieren. 20 Klaus Strasser und Marion Kutzner In den 1980er Jahren entwickelten Andreas Fröhlich und Christel Bienstein das Konzept der Basalen Stimulation weiter, sodass es von Krankenhäusern und Einrichtungen der stationären Altenhilfe in der Pflege eingesetzt wurde. Folgende Voraussetzungen sollten für die Anwendung der Basalen Stimulation gegeben sein: • Ein Grundlagenkurs für Basale Stimulation ist nach Möglichkeit vom Begleiter/ Pflegenden absolviert worden. Hierbei spielt die gemachte Selbsterfahrung eine wichtige Rolle. (Im ambulanten Hospizdienst am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen ist der Basiskurs Bestandteil des Befähigungskurses für Ehrenamtliche und wird auch immer wieder als Tagesveranstaltung angeboten.) • Die Biografie und die Gewohnheiten des Sterbenden sind bekannt. • Zum Sterbenden und zu den Angehörigen besteht ein vertrauensvolles Verhältnis, welches durch die Anwendung der Basalen Stimulation vertieft werden kann. • Der Begleiter, die Pflegekraft machen Hilfsangebote, die vom Sterbenden angenommen, aber auch abgelehnt werden können. • Die Angebote sollten einfach und eindeutig sein. Folgende Qualitäten von Wahrnehmung werden bei der Durchführung der Basalen Stimulation angesprochen: • Somatische Wahrnehmung (Haut, Muskeln und Gelenke) • Die Haut als unser größtes Wahrnehmungsorgan • Taktil-haptische Wahrnehmung (Tast- und Greifsinn) • Vestibulare Wahrnehmung (Gleichgewichtssteuerung) • Vibratorische Wahrnehmung (Informationen über Körpertiefe und -fülle) • Orale Wahrnehmung (Geschmackssinn) • Olfaktorische Wahrnehmung (Geruchssinn) • Auditive Wahrnehmung (Richtungshören, Schallquellen orten, Warnfunktion) • Visuelle Wahrnehmung (die Umwelt und sich selbst wahrnehmen) An folgenden Beispielen aus der Pflegepraxis und der Begleitung durch Ehrenamtliche soll aufgezeigt werden, wie die Methode der Basalen Stimulation als Türöffner für verbale Kommunikation wirkt. 1. Gelingendes Begleiten am Lebensende 21 1.3.1 Atemstimulierende Einreibung Ein Patient mit Lungenkrebs litt unter starker Atemnot. Er saß auf der Bettkante, inhalierte Sauerstoff über eine Sauerstoffbrille und hatte die vom Arzt verordneten Medikamente bereits eingenommen. Medikamente und Sauerstoffzufuhr halfen ihm anscheinend nicht. Ich bot ihm an, seinen Rücken einzureiben. Der Patient willigte ein. Ich führte eine atemstimulierende Einreibung, die fünf Minuten dauerte, durch. Der Patient atmete schon nach kurzer Zeit ruhiger. Nach Beendigung der Einreibung setze ich mich mit dem Einverständnis des Patienten auf die Bettkante, und der Patient, der als sehr verschlossen galt, sprach mit mir über seine Befürchtung, nicht mehr genügend Zeit zu haben, all seine »Dinge« erledigen zu können, und auch über seine Angst zu ersticken. In den folgenden Wochen führte ich die atemstimulierende Einreibung noch einige Male durch, und jedes Mal folgte ein intensives Gespräch. 1.3.2 Arm- und Handeinreibung Eine Patientin mit Brustkrebs und Metastasen, die zur Querschnittslähmung führten, wurde von einer ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterin begleitet. Zwischen ihnen bestand ein vertrauensvolles Verhältnis. Bei einem ihrer Besuche fragte sie die Patientin, was sie ihr Gutes tun könne. Die Patientin, erst sehr zurückhaltend, fragte, ob die Ehrenamtliche ihr die Arme und Hände eincremen könne, ihr Ehemann könne das nicht. Die Mitarbeiterin strich die Arme von der Schulter an in kreisenden Bewegungen zum Handgelenk aus und rieb sie mit einem Körperöl ein. Anschließend führte sie eine Handmassage durch. Die Patientin fühlte sich sehr wohl, das Vertrauen und die Freude, die Ehrenamtliche wieder zu sehen, wuchs von Besuch zu Besuch. Die Ehrenamtliche besuchte die Patientin noch während sechs Monaten ein- bis zweimal in der Woche und führte selbst dann, als die Patientin nicht mehr ansprechbar war, die Massage behutsam durch. Bei Schwerkranken und Sterbenden, die sehr unruhig sind oder Schmerzen haben, sollte eine Einreibung oder Massage wegen der beruhigenden Wirkung immer mit der Haarwuchsrichtung erfolgen. Häufig sind es kleine Dinge, die dem Kranken guttun und das Vertrauen zwischen Begleiter und Patient fördern, und oft haben wir die beruhigende Wirkung der Basalen Stimulation auf Menschen in der letzten Lebensphase wahrgenommen. |
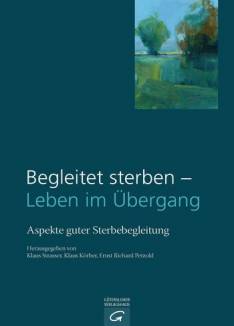
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen