|
|
|
Umschlagtext
Jede Diskussion über Patientenverfügungen (PV) muss von der Frage nach einem tragfähigen Menschenbild geleitet werden. Dabei erweisen sich Krankheit und Sterben als dynamische Prozesse, in deren Verlauf sich Einstellungen von Patienten wesentlich ändern können. Menschen verfügen aber auch über langfristige Perspektiven auf ein gutes und geglücktes Leben. Diese Spannung zwischen personaler Identität und Prozess gilt es bei antizipierten Willensentscheidungen besonders zu beachten. Deshalb konzentriert sich die vorliegende Arbeit vor allem auf die Erstellung eines adäquaten Autonomiemodells, und zwar aus ethisch-anthropologischer und theologischer Sicht. Die Analysen zeigen sowohl den Nutzen als auch die Grenzen von PV: Sie sind einerseits ein wertvolles Reflexions- und Kommunikationsmittel in Bezug auf das eigene Leben und Sterben. Andererseits beschränken gerade gewisse Krankheitsumstände die Selbstbestimmung des Menschen. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Buch nicht nur Wege zu einer „sinnvollen“ Errichtung von PV aufgezeigt, sondern auch die Gesetzeslage in Österreich und Deutschland diskutiert.
Rezension
Kein Patient darf gegen seinen Willen behandelt werden, und zwar auch dann nicht, wenn eine medizinische Behandlung aus ärztlicher Sicht noch geboten erscheint. Was aber, wenn jemand nicht mehr entscheidungs- oder artikulationsfähig ist? Vorausverfügungen wie die Patientenverfügung können hier Abhilfe schaffen. Der Umgang mit Patientenverfügungen aber hängt wesentlich vom jeweiligen Verständnis von Autonomie und Fürsorge ab, die der Autor in dieser Studie thematisiert. Autonomie- und Fürsorge-Verständnis aber hängen wiederum elementar am Menschenbild. Deshalb konzentriert sich diese Studie vor allem auf die Erarbeitung eines zeitgemäßen Personverständnisses und Autonomiemodells. Kann aber eine Person zum gegenwärtigen Zeitpunkt sich eine zukünftige Krankheitssituation so exakt vorstellen, dass ein zukünftiger Wille erklärt werden kann?
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Der Autor Johann Platzer studierte Theologie in Graz. Nach der Magisterarbeit in Philosophie über Friedrich Nietzsche promovierte er 2010 mit der vorliegenden Arbeit. Er ist u. a. als Lektor an der Medizinischen Universität Graz tätig. Inhaltsverzeichnis
Abstract 13
Einleitung 15 I. Autonomie und Fürsorge 21 l Hinführung: Auf dem Weg zu einer säkularen Bioethik 21 1.1 Vom hippokratischen Fürsorgegedanken zum Prinzip der Autonomie 22 1.2 Kritikpunkte traditioneller ethischer Theorienbildungen 28 1.3 Die Begründung und Anliegen des prinzipienethischen Ansatzes 33 2 Autonomie und Fürsorge im Kontext der Prinzipienethik 37 2.1 Ethische Konfliktlösungen durch das Vier-Prinzipien-Paradigma 38 2.2 Das Prinzip des Respekts vor Autonomie 41 2.3 Das Prinzip des Nichtschadens und des Wohltuns 45 3 Autonomie als oberstes Prinzip einer wertpluralen Ethik 51 3.1 Säkulare Moral und die Unmöglichkeit letzter Begründungen 51 3.2 Autonomie und Fürsorge - Inhalt und Voraussetzungen 53 3.3 Die autonomieorientierte Arzt-Patienten-Beziehung 57 4 Fürsorge als oberstes Prinzip des ärztlichen Ethos' 60 4.1 Die Ethik der Fürsorge als Quelle unbedingten Lebensschutzes 61 4.2 Das Ärzte-Ethos als Bezugspunkt tugendhafter Fürsorge 64 4.3 Die „tugendhafte" fürsorgliche Arzt-Patienten-Beziehung 70 5 Zusammenfassung und Diskussion 74 II. Autonomie und Personverständnis 81 l Menschenbilder im Wandel 81 1.1 Hinführung: Der Mensch im Horizont der Trias Natur, Kultur und Gott 81 1.2 Der Mensch in den Epochen 84 1.3 Die Infragestellung des menschlichen Subjekts 91 1.4 Der Mensch der Gegenwart 97 1.5 Fazits 104 2 Person als Prozess 107 2.1 Der Personenbegriff108 2.1.1 Vorbemerkungen 108 2.1.2 Personale Merkmale und deren Kritik 110 2.1.3 Von der Notwendigkeit eines zeitgemäßen Personverständnisses 114 2.1.4 Prozessuale Personalität 116 2.2 Menschenwürde als regulatives Prinzip einer modernen Bioethik 126 2.2.1 Hinführung 126 2.2.2 Begriffsbestimmung 128 2.2.3 Begründungsstrategien 130 2.2.4 Das Extensionsproblem 138 2.2.5 Die Implementierungsproblematik 140 2.3 Fazits 142 3 Autonomie als Authentizität 143 3.1 Autonomie - Begriff s geschichte und gegenwärtiger Sprachgebrauch 144 3.1.1 Autonomie in der Antike 145 3.1.2 Immanuel Kants Idee einer objektiven, essentiellen Autonomie 147 3.1.3 Vorläufiges Zwischenergebnis 151 3.1.4 John Stuart Mill und Isaiah Berlin: Subjektive, funktionale Autonomie 153 3.2 Patientenautonomie - Bedingungen und Grenzen 162 3.2.1 Von der Notwendigkeit eines positiven Freiheitsverständnisses 162 3.2.2 Willensfreiheit - Infragestellung eines Begriffs 164 3.2.3 Über die Vereinbarkeit von Freiheit und Determinismus 167 3.2.4 Autonomie durch authentische Identifikation 170 3.2.5 Komponenten authentischer Identifikation 174 3.2.6 Ein Modell autonomer Entscheidungsfindungen 178 3.3 Fazits 187 4 Theologische Hermeneutik von Autonomie 189 4.1 Hinführung 189 4.2 Betrachtungen zur theologischen Ethik 191 4.2.1 Aufgaben und Ziele gegenwärtiger theologischer Ethik 191 4.2.2 Religiöse Authentizität durch Sinneinsicht 197 4.2.3 Das christliche Ethos im Kontext biomedizinischer Theoriebildungen 202 4.3 Autonomie und Fürsorge aus religiöser Sicht 210 4.3.1 Aspekte eines christlichen Ethos' 211 4.3.2 Autonomie - Theonomie: Genese eines unzeitgemäßen Gegensatzes 216 4.3.3 Theonome Autonomie 220 4.3.4 Fürsorge als Ausdruck des christlichen Propriums 223 5 Das Gute für den Patienten - Zusammenfassende und weiterführende Gedanken 228 5.1 Das Gute und die Philosophie 230 5.2 Das Gute im Horizont der Theologie 233 5.3 Das Gute im Kontext des Verhältnisses zwischen Ethik und Recht 237 III. Patientenverfügungen und Autonomieverständnis 243 l Zur Entstehung 243 1.1 Einleitung und Definition 243 1.2 Die amerikanische Diskussion über Living Will-Statutes 245 l.3 Deutsche Rechtsurteile im Kontext der Sterbehilfe-Debatte 250 1.4 Zur Genese der deutschen Gesetzesentwürfe über Patientenverfügungen 256 2 Ausgewählte Stellungnahmen und Diskussionspunkte 263 2.1 Kirchliche Erklärungen und theologische Aspekte zur Patientenverfügung 263 2.2 Wachkoma und Demenz: Verlängerte oder vorweggenommene Autonomie? 271 2.3 Zum Widerrufsrecht 280 2.4 Der Mensch als Fragment - Relationale Autonomie durch Vorausverfügungen 288 3 Ein vorläufiges Resümee 293 4 Das österreichische Patientenverfügungsgesetz 298 4.l Entstehungsgeschichte und Ausgangslage 299 4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 301 4.2.1 Verfassungsrecht 302 4.2.2 Strafrecht 304 4.2.3 Zivilrecht 305 4.2.4 Berufsrecht 306 4.3 Zielsetzungen und Grundzüge 310 4.3.1 Inhaltlicher Anwendungsbereich 310 4.3.2 Persönlicher Anwendungsbereich 313 4.3.3 Die verbindliche Patientenverfügung - Voraussetzungen 314 4.3.4 Die beachtliche Patientenverfügung - ein aliud und kein minus 321 4.3.5 Gemeinsame Bestimmungen und sonstige Regelungen 325 5 Zusammenfassende Kernpunkte und praktische Relevanz 330 5.1 Rückblicke 330 5.2 Aspekte zur Verbindlichkeit und Reichweite 332 5.3 Von der Notwendigkeit ärztlicher Aufklärung und unterstützender Beratung 336 5.4 Ausblicke auf sonstige Begleitmaßnahmen 339 5.5 Schritte zur „sinnvollen" Errichtung einer Patientenverfügung 342 5.6 Patientenverfügungen im Horizont christlichen Glaubens 348 Anhang: Gesetzestext des österreichischen Patientenverfügungsgesetzes 355 Literatur 359 |
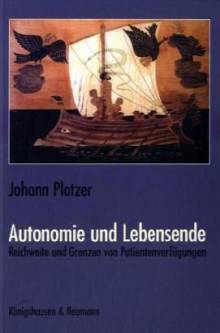
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen