|
|
|
Umschlagtext
Subsidiarität: Was die jeweils kleinste Einheit leisten kann und will, das darf dieser nicht entzogen, das muss aber umgekehrt auch von dieser durchgeführt werden. Erst wenn die untere Ebene nicht mehr kann oder will, soll die nächsthöhere - eben "subsidiär" - eintreten. Dieses Prinzip gilt für unterste, mittlere und höchste Ebenen bis hinauf zur Obrigkeit und zum Abstraktum Staat. Das Buch geht den geistesgeschichtlichen Wurzeln dieses Prinzips nach und zeigt die Dringlichkeit dieser Dynamik an zwei Fallstudien aus dem 21. Jahrhundert auf: an dem Humanitären Korridor in Italiens Flüchtlingspolitik und an einem Bildungsprogramm für benachteiligte Kinder in Rumänien. Auf diese Weise kann auf theoretischem Fundament (von Homer bis Grillparzer) und auf anschauliche Weise die Bedeutung von Subsidiarität als Grundlage menschlichen Zusammenlebens erwiesen werden.
Wilhelm Blum, Dr. phil., geb. 1943, war Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Regensburg und Lehrer am Maximiliansgymnasium in München; heute ist er als wissenschaftlicher Schriftsteller tätig. Helmut P. Gaisbauer, Dr. phil., geb. 1971, ist Präsident des Internationalen Forschungszentrums für soziale und ethische Fragen (ifz) und Senior Scientist am Zentrum für Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg. Clemens Sedmak, Dr. theol., Dr. phil., geb. 1971, ist Professor für Sozialethik an der University of Notre Dame (Indiana, USA). Rezension
Dieses Buch zum Subsidiaritätsprinzip besteht aus drei Teilen (vgl. Inhaltsverzeichnis): einer Grundlegung zum Prinzip der Subsidiarität incl. Beispielen und zwei Fallstudien zur Subsidiarität aus dem 21. Jahrhundert: dem Humanitären Korridor in Italiens Flüchtlingspolitik und einem Bildungsprogramm für benachteiligte Kinder in Rumänien. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass höhere staatliche Institutionen nur dann regulativ eingreifen sollten, wenn die Möglichkeiten des Einzelnen, einer kleineren Gruppe oder niedrigeren Hierarchie-Ebene allein nicht ausreichen, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Die Regulierungskompetenz soll möglichst immer „so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig“ angesiedelt sein. Das Subsidiaritätsprinzip ist ein wichtiges Konzept für föderale Systeme. Die geistesgeschichtlichen Wurzeln dieses Prinzips gehen bis in die Antike zurück
und stelt eine Grundlage menschlichen Zusammenlebens dar. Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Das Prinzip der Subsidiarität
Grundlegung und Beispiele aus Geschichte, Literatur und Politik Wilhelm Blum Einleitung 13 1. Grundlegung: Das Wesen der Subsidiarität 14 1.1 Die Erklärung des Begriffs 14 1.2 Die Katholische Soziallehre und die Subsidiarität 15 1.3 Die allumfassende Subsidiarität 16 1.4 Folgen der Subsidiarität 17 2. Die Subsidiarität bei einigen (frühen) Christen 19 2.1 Grundsätzliches zur Theologie der Antike 19 2.2 Der Erste Klemens-Brief 20 2.3 Der Brief des Bischofs Ignatios 21 2.4 Aus dem Ersten Brief des Paulus an die Korinther 22 2.5 Die „Monarchie" von Dante Alighieri 23 2.6 Aus der Regel des heiligen Benedikt 24 3. Die Subsidiarität in der Philosophie der Heiden 26 3.1 Der Konsul Menenius Agrippa 494 vor Christus 26 3.2 Platon und die Subsidiarität 28 3.3 Ciceros Schrift „Vom pflichtgemäßen Handeln" 30 3.4 Heidnische Autoren über Machtträger und Subsidiarität 31 3.4.1 Der Heide Salu(s)tios (4. Jahrhundert) 32 3.4.2 Der Heide Georgios Gemistos Plethon (ca. 1355-1452) 33 4. Die Subsidiarität in ausgewählten Verfassungen 36 4.1 Der Verzicht des Staates auf Macht 36 4.2 Die Verfassung Frankreichs vom 3. September 1791 36 4.3 Die Verfassung Belgiens vom 7. Februar 1831 37 4.4 Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 38 4.5 Das Bundesverfassungsgesetz Österreichs von 1929 43 5. Beispiele von Gegnern der Subsidiarität 58 5.1 Pscudo-Dionysios Areopagita 58 5.2 Papst Gelasius I 61 5.3 Papst Innozenz III 63 5.4 Bonifaz VIII. und die Bulle „Unam Sanctam" 64 5.5 Jean-Jacques Rousseau 68 5.6 Der „Demokratische Zentralismus" Lenins und die ehemalige DDR 70 5.7 Der Nationalsozialismus 73 5.8 Überleitung zu Kapitel 6: Pater Alfred Delp SJ 76 6. Beispiele für Subsidiarität aus der Literatur 77 6.1 Franz Grillparzer „Ein treuer Diener seines Herrn" 79 6.2 Der Stoiker Epiktet 81 6.3 Der Briefwechsel des Jüngeren Plinius mit Kaiser Trajan 82 6.4 Der Sauhirt Eumaios in Homers Odyssee 90 7. Der Gott der Christen und die Subsidiarität 92 7.1 Die Dreieinigkeit in Gott 92 7.2 Die Menschwerdung Jesu Christi 94 7.3 Der Verzicht auf die Macht durch Gott selbst 96 7.4 Das Gleichnis von den Talenten 98 7.5 Christus, der Richter im Jüngsten Gericht 99 7.6 Die Ewigkeit der Liebe 100 Subsidiarität und Flüchtlingspolitik Eine Fallstudie in systematischer Absicht Clemens Sedmak (unter Mitarbeit von Ilaria Schnyder von Wartensee) Einleitung: Zum Begriff der Subsidiarität 105 Einführung in die Fallstudie 109 1. Personen als soziale Wesen 111 1.1 Der Orientierung gebende Status der Familie 115 1.2 Gebundene Loyalitäten 118 1.3 Schlussbemerkung 122 2. Liminalität und relationale Autonomie 122 2.1 Humanitärer Korridor als liminales Programm 125 2.2 „Bleiben" im Zwischenraum 127 2.3 Liminalität, Identität und Relationale Autonomie 129 2.4 Liminalität und Subsidiarität 133 2.5 Schlussbemerkung 135 3. Die Teilung der moralischen Arbeit: Lebenswelt und System 136 3.1 Moralische Arbeitsteilung und das Projekt des Humanitären Korridors 141 3.2 Rahmenbedingungen und soziales Klima 143 3.3 Die ambivalente Rolle von Institutionen in der Integration 145 3.4 Moralische Arbeitsteilung und Subsidiarität 149 3.5 Schlussbemerkung 151 4. Begleitung und die Grenzen von „Accompaniment" 151 4.1 Begleitungsbedarf und Begleitung 152 4.2 Grenzen der Begleitung 158 4.3 Begleitung und Subsidiarität 161 4.4 Schlussbemerkung 164 Epilog: Konfliktlinien und ein europäisches Dilemma 165 Subsidiarität und persistente Familienarmut Aufschlüsse aus einem bildungsorientierten Projekt in Rumänien Helmut P. Gaisbauer 1. Hinführung 169 2. Über Relationen: Subsidiarität und Armut 172 2.1 Relationale Armut 172 2.2 Individualisierung von Armut 173 2.3 Fremde und disruptive Armut 174 2.4 Armut als schwerwiegendes soziales Problem und Menschheitsfrage 177 2.5 Armutsverstärkung durch „predatory narratives" und feindselige öffentliche Meinung 178 2.6 Armut und Subsidiarität 179 3. Über Bildung: Befähigung zu Selbstwirksamkeit und Reflexion 182 3.1 Über Bildungslosigkeit als Armut 182 3.2 Herzensbildung, Urteilskraft, Handlungsfähigkeit 184 3.3 Erziehung, Bildung und Subsidiarität 187 4. Über konkrete Beziehungen: Subsidiarität und gelebte bzw. verfehlte Verantwortung 189 4.1 Das Projekt „Lernen.Integration.Förderung.Tagesbetreuung — L.I.F.T." in Dumbräveni 189 4.2 Armut konkret in Dumbraveni 190 4.3 Intersektionale Diskriminierung 195 4.4 Zur symbolischen Geografie Dumbrävenis 197 4.5 Liminale Rand-Existenz 199 4.6 (Gescheiterte) Bildung als auferlegte Liminalität 203 4.7 Institutionenversagen: armutsverfestigende Pathologien des Schul- und Sozialsystems 208 4.7.1 Absentismus 210 4.7.2 Fehlgeleitete Förderpädagogik 213 4.7.3 Ethnisch separierendes Schulsystem 214 4.7.4 Fehlgehende Wirkung von armutspolitischen Maßnahmen 215 4.8 Im heiklen Feld zwischen den Ebenen: Grenzfragen 216 4.9 Stärkung durch Unterstützung in Notlagen 217 4.10 Stärkung durch Elternbildung 219 4.11 Stärkung durch Einbindung: Hilfe zur Selbsthilfe 220 4.12 Konklusion im Lichte der drei Fragen an die Subsidiarität 224 Epilog 227 |
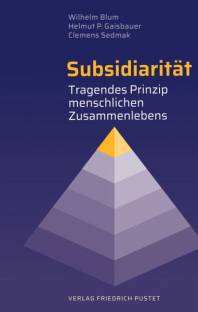
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen