|
|
|
Umschlagtext
»Was aber machen Lyriker, wenn der Knochenmann an sie persönlich herantritt? Sie entwetzen nicht, sie machen sich einen Reim auf ihn« (R. Gernhardt). Im Mittelpunkt dieser Studie stehen die letzten Gedichte dreier sehr unterschiedlicher Autoren, deren Gemeinsamkeit die Reflexion des eigenen Sterbens ist. Alter und Körperverfall, Krankheit und Tod sind die Themen, mit denen sich die Autoren auseinandersetzen. Dabei stehen ihre Texte im Spannungsfeld zwischen der universalen Bedingtheit des Menschen als sterbliches Wesen und einer individuellen Erfahrung Denn »jeder ist der erste, der stirbt« (E. Ionesco). Die je eigene Positionierung zum Sterbenmüssen wird anhand von Gedichtanalysen herausgearbeitet, die im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Unter Rückgriff auf verschiedene Formen von ars moriendi entwickeln Gernhardt und Müller eine eigene Form der Sterbekunst, während Jandls negative Anthropologie jede Möglichkeit von Sterbekunst negiert.
Rezension
Dieser Band ist für die Hand des Sek.II-Lehrers in doppelter und fächerverbindender Weise von Relevanz: Für den Deutschlehrer wird Gegenwarts-Lyrik anhand der Autoren Heiner Müller, Robert Gernhardt und Ernst Jandl verhandelt, für den Religions- und Gemeinschaftskunde-Lehrer das Thema Tod und Sterben am Beispiel autobiographischer Texte der genannten Lyriker. So lassen sich nicht nur fächer-verbindende Aspekte gewinnen, es wird auch die wechselseitige Relevanz deutlich: Von (autobiographischer) Literatur her fällt ein neues Licht auf Sterben und Tod und von dem gesellschaftlichen und religiösen Wissen um Sterben und Tod fällt ein neues Licht auf die literarischen Aspekte: "Lyrisch reflektiertes Sterben".
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Im Mittelpunkt dieser Studie stehen die letzten Gedichte dreier sehr unterschiedlicher Autoren, deren Gemeinsamkeit die Reflexion des eigenen Sterbens ist. Denn was macht der Dichter, wenn der Knochenmann an ihn herantritt? Er entwetzt nicht, er macht sich einen Reim auf ihn (R. Gernhardt). Alter und Körperverfall, (Krebs-)Erkrankung und Tod sind die Themen, mit denen sich die Autoren auseinandersetzen. In kulturhistorischer Perspektive stehen die Gedichte in Beziehung zur Tradition der ars moriendi, wobei der Begriff ‚Sterbekunst’ hier sowohl als Kunst des rechten Sterbens als auch als Sprachkunstwerk über das Sterben zum Tragen kommt. Vorläufer des Typus ‚Sterbegedicht‘ finden sich schon in der Frühen Neuzeit, wenngleich erst mit Heines Gedichten aus der „Matratzengruft“ in vergleichbarer Weise über das eigene Sterben gedichtet worden ist. Anhand ausführlicher Textanalysen wird herausgearbeitet, wie sich die jeweilige Auseinandersetzung mit dem Sterbenmüssen vollzieht und inwiefern insbesondere die Textform, das Gedicht, dabei von Bedeutung ist. Wird für Müller und Gernhardt das Dichten selbst zur Sterbekunst, ist für Jandl die absolute Negation jeglicher Form von Sterbekunst festzustellen. Die Autorin Debora Helmer studierte Germanistik, Komparatistik und Philosophie in Göttingen und wurde 2012 promoviert. Sie ist wiss. Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und arbeitet an einer Neuedition der Theaterkritiken Theodor Fontanes. Inhaltsverzeichnis
1 Das Sterben des Autors 11
1.1 Standortbestimmung 11 1.2 Erkenntnisinteresse 15 1.3 Methodische Vorüberlegungen 19 1.4 Begründung der Textauswahl 31 2 Der Begriff der Sterbekunst 35 2.1 „male vivet quisquis nesciet bene mori": Antike ars moriendi 35 2.1.1 Platon: Phaidon, Apologie 35 2.1.2 Epikureismus: Epikur, Lukrez 37 2.1.3 Stoa: Seneca, Epiktet 40 2.2 Sterbekunst im Spätmittelalter: Ars moriendi und Totentanz 42 2.3 Exkurs: Das Makabre 46 2.4 Der Begriff der Euthanasie 48 2.5 "Frei lebt, wer sterben kann" — Sterbekunst in fiktionaler Literatur 50 3 Lyrische Vorgänger 57 3.1 Frühe Neuzeit: Janus Pannonius, Petrus Lotichius Secundus — „De se aegrotante" 57 3.2 Barock: Andreas Gryphius, Simon Dach, Paul Fleming 62 3.2.1 Andreas Gryphius 62 3.2.2 Simon Dach 65 3.2.3 Paul Fleming 67 3.3 Das Gebot des Schweigens im 18. Jahrhundert 69 3.4 Heinrich Heines Gedichte der Agonie 74 4 „Lasst mich mit eurem Krebs in Ruhe." — Zeitgenössische Literatur über Krankheit und Tod 87 5 Heiner Müller: Werke I. Die Gedichte 95 5.1 Textauswahl 95 5.2 Die Fernsehgespräche mit Alexander Kluge 97 5.3 Gedichtanalysen: Das eigene Spiegelbild/Selbstporträts 102 5.3.1 HERZKRANZGEFÄSS 102 5.3.2 im Spiegel mein zerschnittener koerper 105 5.3.3 auftauchen in der isolierstation 107 5.3.4 ENDE DER HANDSCHRIFT 108 5.3.5 im schädel königreiche universen 109 5.3.6 ICH KAUE DIE KRANKENKOST DER TOD 111 5.3.7 ein kind weint in der cafeteria 112 5.4 Bilder vom Tod/Spiegelung in Fremdbildern 115 5.4.1 SENECAS TOD 115 5.4.2 STERBENDER MANN MIT SPIEGEL 122 5.4.3 GESPRÄCH MIT YANG TSCHU „DEM PESSIMISTEN" 126 5.5 „Auf der Bühne stirbt / Ein Spieler nach den Regeln seiner Kunst" — Die Veröffentlichung des Sterbens bei Heiner Müller 129 6 Robert Gernhardts Später Spagat — Sterbekunst als sprachliche Formkunst 143 6.1 Textauswahl 143 6.2 Überlegungen zur Poetik: Was das Gedicht alles kann: Alles 144 6.3 Gedichtanalysen 154 6.3.1 Rückblick, Einsicht, Ausblick 155 6.3.2 Krebsfahrerlied 158 6.3.3 Zyklus: Aus dem Lieder- und Haderbüchlein des Robert G 159 6.3.3.1 Schuldchoral I 160 6.3.3.2 Geh aus mein Herz 164 6.3.3.3 Von Fall zu Fall 167 6.3.3.4 Frage und Antwort 167 6.3.3.5 Trotz 169 6.3.3.6 Schuldchoral II 170 6.3.4 Finger weg 174 6.3.5 Asymmetrie 176 6.3.6 Von viel zu viel 178 6.3.7 Als er von Tag zu Tag 1 kg weniger wog 180 6.3.8 Fibitux 182 6.3.9 Blut, Scheiß und Tränen 183 6.3.10 Worte, Worte 184 6.4 „Das Singen wird es bringen": Robert Gernhardts Reim auf den Tod 186 7 Portrait of the artist as a dying man — Ernst Jandls Letzte Gedichte als Negation von Sterbekunst 193 7.1 Ernst Jandls letzte Gedichte? 194 7.2 Jandl über Jandl 199 7.2.1 Autobiographisches Schreiben 199 7.2.2 Jandls lyrische Selbstporträts 203 7.2.3 „den menschen in seiner totalen auflösung zeigen, seinen zeitlebens sich vollziehenden tod." 206 7.3 Ernst Jandls Letzte Gedichte: „Portrait of the artist as a dying man" 212 7.3.1 ab einem gewissen alter 212 7.3.2 Selbstporträt, mit desolatem Körper 214 7.3.2.1 wir sind alt und das ist schön 214 7.3.2.2 end of a speaker 218 7.3.2.3 handkreuz 221 7.3.2.4 auf deinem einstigen bauch 223 7.3.3 Selbstporträt, auf dem Sterbebett 225 7.3.4 widmungsgedicht 227 7.3.5 Selbstporträt, der Dichter am Lebensabend 229 7.3.5.1 wozu besitze ich 229 7.3.5.2 gegen abend 231 7.3.6 Selbstporträt, im Frühling 232 7.4 Jandls Sterbegedichte als Negation von Sterbekunst 235 8 Schlusswort und Ausblick 245 Literaturverzeichnis 251 Dank 267 Weitere Titel aus der Reihe Epistemata Literaturwissenschaft |
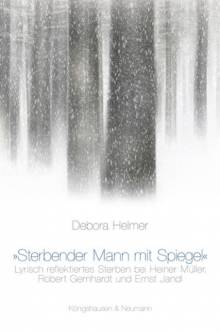
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen