|
|
|
Umschlagtext
Nach didaktischen Gesichtspunkten aufgebaut, stellt dieses Lehrbuch den modernen Forschungsstand des Faches systematisch, umfassend und verständlich dar. Diese Neuauflage ist vollständig überarbeitet worden. Sie behandelt - den aktuellen Schwerpunkten der sozialpsychologischen Forschung und Theoriebildung folgend - die Bereiche Soziale Motive, Soziale Kognitionen, Einstellungen, Interaktion und Gruppeneinflüsse einschließlich Führung in Gruppen. Neu aufgenommen wurde ein Kapitel über Bestätigung von Erwartungen sowie theoretische Ansätze, die sich mit den sozialen Auswirkungen des Selbstschemas befassen. Außerdem wurden folgende Themen hinzugefügt: Stimmung und Soziale? Verhalten, Einstellungs-Repräsentations-Theorie, Stigmatisierung und neuere Ansätze über Stereotype und Vorurteile.
Prof. Dr. Hans-Werner Bierhoff ist Leiter der Abteilung Sozialpsychologie an der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum. Rezension
Meiner Meinung nach handelt es sich um ein inhaltlich wie didaktisch überaus gelungenes Lehrbuch der Sozialpsychologie (wie auch die 5. Aufl. belegt). Begründung: A) Das Buch ist überaus prägnant und nachvollziehbar gegliedert. Jedes Kapitel enthält vor dem Lesetext erneut eine Untergliederung im vorangestellten Kästchen. Alle wesentlichen Aspekte der Sozialpsychologie werden systematisch behandelt. B) Alle Kapitel werden mit einer hilfreichen Zusammenfassung und abschließenden Fragen beendet. C) Zahlreiche Tabellen, Graphiken und Zusammenfassungen von Positionen in sog. Boxen sind didaktisch hilfreich. D) Unterschiedliche Positionen werden deutlich und abgewogen. E) Weiterführende Literatur auf fast 70 Seiten und ein mehr als 10-seitiges enges Sachregister. – Spätestens in Verbindung mit dem vom gleichen Verfasser im gleichen Verlag erstellten „Begriffswörterbuch Sozialpsychologie“ dürften für diese Teildisziplin der Psychologie kaum Fragen offen bleiben.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Systematisch, umfassend und verständlich stellt dieses bewährte Lehrbuch, das für die 5. Auflage grundlegend aktualisiert wurde, den modernen Forschungsstand des Faches dar. Themenbereiche wie Attraktion und Liebe, Fairness und Gerechtigkeit, Aggression und Gewalt, Konformität und Gruppendenken, Kooperation und Führung werden ausführlich behandelt. Stereotype und Vorurteile werden detailliert erörtert. Jedes Kapitel endet mit Zusammenfassungen und Fragen zum Text. Zielgruppe/Target groups: Studenten der Psychologie. Inhaltsverzeichnis
I. Einführung 1
II. Soziale Motive 5 1. Gesellung 5 1.1. Bindung undEinsamkeit 6 1.2. Wenn Gefahr droht 12 1.3. Furchtreduktion: Seid nett zueinander! 14 1.4. Wenn es peinlich wird 17 1.5. Soziale Vergleiche 18 1.6. Zusammenfassung 39 1.7. Fragen 40 2. Attraktion und Liebe 41 2.1. Physische Attraktivität 43 2.2. Ähnlichkeit 52 2.3. Romantische Zuneigung 56 2.4. Beziehungsqualität und Aufkündigung einer Beziehung 66 2.5. Zusammenfassung 71 2.6. Fragen 72 3. Hilfreiches Verhalten 73 3.1. Prosoziale Normen und kulturelle Unterschiede 74 3.2. Extrinsisch motivierte Hilfe 80 3.3. Intrinsisch motivierte Hilfe 83 3.4. Zur Psychologie des Hilfe-Erhaltens 91 3.5. Ideologien der Hilfeleistung 98 3.6. Zusammenfassung 100 3.7. Fragen 101 4. Fairness und Gerechtigkeit 102 4.1. Rechtfertigung und Selbstdarstellung 104 4.2. Gerechte-Welt-Glaube 106 4.3. Gerechtigkeitsregeln 112 4.4. Equity-Theorie und Liebesbeziehungen 120 4.5. Verfahrensgerechtigkeit 122 4.6. Zusammenfassung 124 4.7. Fragen125 5. Aggression und Feindseligkeit 126 5.1. Wie wird Aggression definiert und gemessen? 127 5.2. Sozialpsychologische Theorien der Aggression 133 5.3. Anwendungsgebiete 146 5.4. Zusammenfassung 152 5.5. Fragen 153 6. Kontrolle, Kontrollverlust und Freiheit der Wahl 154 6.1. Reaktanz und Hilflosigkeit 156 6.2. Typ A und Kontrollverlust 167 6.3. Zusammenfassung 172 6.4. Fragen173 III. Soziale Kognition 174 1. Soziale Urteilsbildung: Eindrucksbildung als Kombinations aufgabe174 1.1. Algebraische Modelle in der Personenwahrnehmung 175) 1.2. Summationsmodell oder Durchschnittsmodell? 17ö 1.3. Polarisierung 179 1.4. Zusammenfassung 181 1.5. Fragen181 2. Bestätigung von Hypothesen 182 2.1. Illusionäre Korrelationen 182 2.2. Retrospektive Irrtümer 185 2.3. Konfirmatorische Fragestrategien 186 2.4. Priming 190 2.5. Automatische vs. Kontrollierte Verarbeitung von Informationen 193 2.6. Zusammenfassung 197 2.7. Fragen198 3. Heuristiken 199 3.1. Zugänglichkeit 201 3.2. Repräsentativität 202 3.3. Anpassung an einen Anker und Korrespondenzneigung 205 3.4. Was wäre wenn: Kontrafaktisches Denken als Simulation alternativer Welten208 3.5. Zusammenfassung 211 3.6. Fragen 213 4. Personenwahrnehmung 214 4.1. Eindrucksbildung 215 4.2. Selbstschema und Arbeitsselbst 220 4.3. Sich-selbst-erfüllende-Prophezeiungen 223 4.4. Komödie oder Tragödie? 231 4.5. Zusammenfassung 237 4.6. Fragen 238 5. Attribution 239 5.1. Konfigurationskonzepte 244 5.2. Kovariationskonzepte 246 5.3. Wie mentale Systeme arbeiten 251 5.4. Attribution, wenn die Situation da ist 254 5.5. Akteur-Beobachter-Unterschiede 259 5.6. Zusammenfassung 263 5.7. Fragen 264 IV. Einstellungen 265 1. Definitionen, Typologien, Funktionen 265 1.1. Typologie von Einstellungen 268 1.2. Einstellungsstärke 269 1.3. Funktionen der Einstellung 272 1.4. Zusammenfassung 274 1.5. Fragen 275 2. Nachdenken oder nicht 276 2.1. Theorie des überlegten und geplanten Handelns 276 2.2. Periphere und zentrale Einstellungsänderung 279 2.3. Zusammenfassung 282 2.4. Fragen 283 3. Wahrnehmung von Gruppen 284 3.1. SoziokulturellerAnsatz 287 3.2. Psychodynamischer Ansatz 291 3.3. Kognitiver Ansatz 293 3.4. Theorien der sozialen Diskriminierung 299 3.5. Was heißt es, Zielscheibe von Stereotypen und Vorurteilen zu sein?... 306 3.6. Abbau von Stereotypen 309 3.7. Zusammenfassung 310 3.8. Fragen 312 4. Einstellung und Verhalten 313 4.1. Heute so, morgen so: Keine 1 zu 1-Relation zwischen Einstellung und Verhalten 313 4.2. Einstellungs-Repräsentations-Theorie 316 4.3. Das Selbst als Moderator von Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz 321 4.4. Zusammenfassung 324 4.5. Fragen 325 5. Konsistenz und Dissonanz 326 5.1. Wahlsituationen, in denen sich eine Person zwischen zwei Alternativen entscheiden muss... 326 5.2. Einstellungskonträres Verhalten: Wie es sich auswirkt, wenn mein Verhalten gegen meine Überzeugen verstößt 327 5.3. Anstrengungsrechtfertigung 331 5.4. Selektive Informationsaufnahme 333 5.5. Anwendung der Dissonanztheorie 333 5.6. Zusammenfassung 334 5.7. Fragen 336 V. Interaktion und Gruppeneinflüsse 337 1. Sozialer Einfluss, Konformität und Macht 338 1.1. Grundlagen der Macht 339 1.2. Gruppensozialisation und Gruppenkohäsion 341 1.3. Leistungen in Anwesenheit von Beobachtern 343 1.4. Ringelmann-Effekt 345 1.5. Destruktiver Gehorsam und Nachgiebigkeit gegenüber Autoritäten .. 348 1.6. Deindividuation 355 1.7. Gruppendenken: Wenn Gruppenentscheidungen in ein Fiasko fuhren 360 1.8. Minoritäten, Innovationen und Stigmatisierung 367 1.9. Zusammenfassung 371 1.10. Fragen 373 2. Vertrauen und soziale Interaktion 374 2.1. Ziel/Erwartungs-Theorie der Kooperation 375 2.2. Dreieckshypothese der Kooperation 376 2.3. Mit Konflikten umgehen 377 2.4. Zusammenfassung 379 2.5. Fragen 379 3. Sozialer Austausch und Strategien der Interaktion 380 3.1. Sozialer Austausch 381 3.2. Strategien der Interaktion 383 3.3. Soziale Motive in der Interaktion 386 3.4. Es kommt nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird 388 3.5. Zusammenfassung 391 3.6. Fragen 392 4. Die Evolution der Kooperation 393 4.1. Das Gefangenendilemma als Paradigma sozialer Konflikte 394 4.2. Die Tit-for-Tat-Strategie 396 4.3. Computer-Turniere: Auf der Suche nach der erfolgreichen Konfliktstrategie 397 4.4. Soziobiologische Betrachtung: Evolutionsstabile Strategien 398 4.5. Soziale Dilemmata 399 4.6. Framing-Effekte: Die sprachliche »Verpackung« als Entscheidungsfaktor 401 4.7. Normen und Kooperation 404 4.8. Zusammenfassung 405 4.9. Fragen 406 5. Prinzipien der Führung in Gruppen und Organisationen 407 5.1. Handlungsmuster des Vorgesetzten und ihre Wirkung auf die Mitarbeiter 408 5.2. Dimensionen des Vorgesetzenverhaltens und situative Führungstheorien 413 5.3. Führung von unten 420 5.4. Übergreifende Themen der Führung 423 5.5. Zusammenfassung 425 5.6. Fragen 427 Literatur 429 Sachregister 495 |
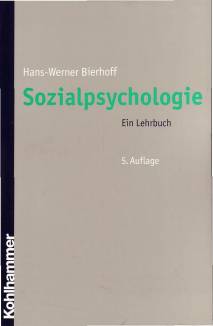
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen