|
|
|
Umschlagtext
Gesetzliche Lohnuntergrenzen, Arbeitsaufteilung in Familien, Justizirrtümer, betriebliche Mitbestimmung, Managergehälter, frühkindliche Förderung, Studiengebühren - so unterschiedlich und unzusammenhängend diese Themen auf den ersten Blick auch klingen mögen, sie haben eines gemeinsam: Sie werfen Fragen auf, in denen mit „Gerechtigkeit" argumentiert wird und werden muss. Dass Gerechtigkeit ein wünschbares Ideal darstellt und Ungerechtigkeit zu Konflikten und unter Umständen sogar zu gewaltvollen Auseinandersetzungen führen kann, ist schon seit der Antike bekannt. Der Band analysiert typische sowie aktuelle Konflikte und Diskussionen aus einem gerechtigkeitspsychologischen Blickwinkel heraus.
Viele Fragen im Zusammenhang mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind noch lange nicht vollständig geklärt: Wann führen unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen zu Konflikten und wie lassen sich solche Gerechtigkeitskonflikte lösen? Welche speziellen Gerechtigkeitsprobleme lassen sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen und Kontexten (Wirtschaft, Familie, Bildung, Strafrecht) identifizieren? Wie lässt sich das Verhalten unterschiedlicher Akteure in Diskursen um Gerechtigkeit erklären? Der aktuelle Erkenntnisstand der Forschung zu diesen Fragen wird in diesem Buch detailliert skizziert. Das Buch zeigt auf, dass psychologische Gerechtigkeitsforschung dazu beitragen kann, Gerechtigkeitsdebatten besser zu verstehen und Gerechtigkeitskonflikte potenziell zu lösen oder zu verhindern. Rezension
Gerechtigkeit als soziale Leitvorstellung ist nicht nur moralisch wünschenwert sondern auch in gesellschaftlicher Perspektive wertvoll; denn bereits seit der Antike ist bekannt, dass allzu große Gerechtigkeits-Unterschiede in der Gesellschaft zu Konflikten, womöglich zu gewaltsamen Konflikten führen, die eine Gesellschaft teuer zu stehen kommen können, jedenfalls teurer, als wenn Gerechtigkeitsaspekte sofort berücksichtigt worden wären. Der hier anzuzeigende Band verdeutlicht an konkreten gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragestellungen wie Mitbestimmung, Managergehälter, frühkindliche Förderung, Studiengebühren u.a. die Bedeutung von Erkenntnissen der Gerechtigkeitspsychologie für unsere bestehende Gesellschaft. Das Buch zeigt auf, dass psychologische Gerechtigkeitsforschung dazu beitragen kann, Gerechtigkeitsdebatten besser zu verstehen und Gerechtigkeitskonflikte potenziell zu lösen oder zu verhindern.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Prof. Mario Gollwitzer, Dipl.-Psych., ist seit April 2005 in Landau Juniorprofessor im Bereich Diagnostik, Differentielle und Persönlichkeitspsychologie und Methoden an der Universität Koblenz-Landau Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Gerechtigkeit als Forschungsgegenstand Sebastian Lotz, Mario Gollwitzer, Bernhard Streicher und Thomas Schlösser 13 1 Gerechtigkeit als Forschungsgegenstand vieler wissenschaftlicher Disziplinen 13 1.1 Der Argumentationsrahmen der Gerechtigkeitspsychologie 14 1.2 Gerechtigkeit in den Teilbereichen der Psychologie 15 2 Psychologische Gerechtigkeitstheorien 16 2.1 Theorie der relativen Deprivation 17 2.2 Theorien distributiver Gerechtigkeit 18 2.3 Theorie der Verfahrensgerechtigkeit 20 2.4 Informationale und interpersonale Gerechtigkeit 22 2.5 Retributive und restaurative Gerechtigkeit 22 3 Warum ist den Menschen Gerechtigkeit wichtig? Gerechtigkeitsmotiv-Theorien 24 3.1 Die Soziale Austauschtheorie - ein instrumenteller Blick auf Gerechtigkeit 25 3.2 Die Soziale Identitätstheorie - ein relationaler Blick auf Gerechtigkeit 26 3.3 Gerechtigkeit als Strategie zur Vermeidung von Unsicherheit und Wahrung von Kontrolle 27 3.4 Gerechtigkeit als Ausdruck des sozialen Anschlussbedürfnisses 28 3.5 Gerechtigkeit als primordiales Motiv 28 4 Zusammenfassung - Anwendungsbereiche psychologischer Gerechtigkeitsforschung 29 Literatur 29 Kapitel 2 Gerechtigkeitskonflikte und Möglichkeiten ihrer Lösung Leo Montada 35 1 Merkmale eines sozialen Konflikts 35 1.1 Konflikte sind nicht gleich Unvereinbarkeiten 35 1.2 Konflikte resultieren aus verletzten normativen Erwartungen 36 1.3 Empörung ist der Leitindikator von Konflikten 37 2 Gerechtigkeitskonflikte 38 2.1 Gerechtigkeit und Gleichheit 39 2.2 Gibt es Wahrheiten bezüglich Gerechtigkeit oder nur Überzeugungen? 42 3 Was heißt es, einen Konflikt beizulegen? 43 3.1 Beilegung durch Verständigung über die Geltung normativer Überzeugungen 44 3.1.1 Unverhandelbare „Werte" als Problem in Diskursen 45 3.2 Beilegung durch Relativierung der Wichtigkeit des normativen Konflikts 45 3.2.1 Konflikte schaffen oft einen psychischen Ausnahmezustand 45 3.2.2 Erkundung positiver Austauschmöglichkeiten zwischen den Streitparteien 46 3.2.3 Einbezug der Anliegen wichtiger dritter Personen 46 3.2.4 Einbezug vorausgegangener Konflikte in eine Gesamtlösung 47 3.2.5 Erweiterung des Erwägungsraums 47 3.3 Beilegung durch eine Neugestaltung des Beziehungsverhältnisses zwischen den Streitparteien 47 3.4 Beilegung durch Grenzziehungen unterschiedlicher Art 48 3.5 Beilegung von Konflikten durch einen gerechten Vertrag 49 3.5.1 Gerechtigkeit im Verhältnis zu Dritten und zur Allgemeinheit 50 3.5.2 Mediation im Vergleich zu anderen Verfahren 51 3.5.3 Die Rolle der Mediatoren 52 4 Zusammenfassung 52 Literatur 53 Kapitel 3 Gerechtigkeitspsychologische Aspekte der Aufteilung von Familienarbeit zwischen Frauen und Männern Gerald Mikula 55 1 Familienarbeit und deren Aufteilung zwischen Frau und Mann 56 1.1 Empfundene Gerechtigkeit der Aufteilung der Familienarbeit zwischen Frau und Mann 56 1.2 Eigene Forschungsarbeiten 58 2 Empfundene Gerechtigkeit der Aufteilung der Familienarbeit als Mediator zwischen Arbeitsbelastung, Arbeitsaufteilung und Beziehungszufriedenheit 58 2.1 Geschlechtsunterschiede 60 2.2 Ungerechtigkeit, Beziehungskonflikte und Beziehungszufriedenheit 62 2.3 Ein vorläufiges Resümee 63 2.4 Verschiedene Bereiche von Familienarbeit und verschiedene Formen von Gerechtigkeit 63 2.4.1 Haushaltsarbeit versus Kinderbetreuung 63 2.4.2 Distributive versus prozedurale Gerechtigkeit 64 3 Langzeiteffekte zwischen empfundener Gerechtigkeit und Beziehungszufriedenheit 64 4 Partnereffekte empfundener Gerechtigkeit 65 5 Worauf beruht empfundene Gerechtigkeit der Aufteilung der Familienarbeit? 67 5.1 Soziale Vergleiche 69 5.2 Wechselseitige Einflüsse zwischen sozialen Vergleichen und empfundener Gerechtigkeit? 70 6 Abschließende Bemerkungen 70 Literatur 72 Kapitel 4 Gerechtigkeit im Bildungssystem Sebastian Lotz und Christoph Feldhaus 77 1 Einleitung 77 2 Disparitäten im Bildungssystem 79 2.1 Soziale Herkunft 79 2.2 Migrationshintergrund 80 2.3 Alleinerziehung 83 2.4 Wege zu mehr Bildungsgerechtigkeit 84 3 Institutionelle Chancen für mehr Bildungsgerechtigkeit am Beispiel der frühkindlichen Förderung: Die gerechte Verteilung von Chancen 84 4 Bildungsgerechtigkeit aus Sicht der Psychologie 86 4.1 Leitfragen für die Psychologie der Bildungsgerechtigkeit 87 5 Lehrergerechtigkeit 88 6 Zusammenfassung 89 Literatur 90 Kapitel 5 Gerechtigkeitsaspekte des wirtschaftlichen Handelns auf der mikroökonomischen Ebene Thomas Schlösser 93 1 Der Markt als soziales System und seine Akteure 93 2 Ein Streik im Experiment 96 3 Prosozialität, prozedurale Gerechtigkeit, soziale Distanz und Normen 97 4 Kooperation und (Un-)Gerechtigkeit 101 5 Kooperation und die Institution der Strafe 103 6 Die altruistische Strafe und Emotionen 104 7 (Ökonomische) Modelle menschlichen Handelns und ihre Grenzen 106 8 Gerechtigkeitsgeleitetes Verhalten und Persönlichkeit 107 9 Auf dem Weg zu besseren Verhaltensmodellen 108 Literatur 110 Kapitel 6 Gerechtigkeitsaspekte in Organisationen Bernhard Streicher und Magdalena Öttl 113 1 Welche Wirkungen haben Gerechtigkeitsbedingungen in Organisationen? 116 1.1 Vertrauen 117 1.2 Organisationales Commitment 118 1.3 Akzeptanz von Entscheidungen 118 1.4 Leistung 118 1.5 Freiwillige Arbeitsleistungen 119 1.6 Stress 119 1.7 Destruktives Verhalten 120 2 Was ist eine gerechte Vergütung? 121 3 Wie kann Gerechtigkeit in Organisationen gemessen werden? 124 4 Kann faires Führungsverhalten trainiert werden? 125 5 Wann sind Gerechtigkeitsbedingungen besonders wichtig? 129 5.1 Gerechtigkeit im Recruitingprozess 129 5.2 Gerechtigkeit bei Organisationsentwicklungsprozessen 132 6 Fazit 134 Literatur 135 Kapitel 7 Gerechtigkeit im Sozialstaat Sebastian Lotz 139 1 Einleitung 139 2 Verteilungsgerechtigkeit im Sozialstaat 140 2.1 Der Sozialstaat im Spannungsfeld zwischen Leistungs- und Bedürfnisgerechtigkeit 141 2.2 Soziale Beziehungen und die Wahl von Verteilungsprinzipien 143 2.3 Entstehung von Gütern, Verteilung und Gerechtigkeit 144 2.4 Lösung von Gerechtigkeitsproblemen durch Anwendung von Mischformen 144 3 Der Sozialstaat und die Befriedigung von Gerechtigkeitsmotiven 145 3.1 Rentensystem und Sozialer Austausch: Generationengerechtigkeit 145 3.2 Arbeitslosen- und Krankenversicherung und die Vermeidung von Unsicherheit 146 3.3 Armut: Grundsicherung und identitätsstiftende soziale Einbindung 148 4 Der Sozialstaat und die Bildung von Gerechtigkeitsurteilen 149 4.1 Empirische Gerechtigkeitsforschung und die Beurteilung von Wirtschafts- und Sozialpolitik 150 4.2 Marktwirtschaft vs. Sozialstaat als Problem eines Tabu-Trade-Offs 151 5 Zusammenfassung 153 Literatur 154 Kapitel 8 Gerechtigkeitsaspekte sozialer Sanktionssysteme Mario Gollwitzer und Michael Wenzel 157 1 Vergeltungsgerechtigkeit als Forschungsgegenstand 158 2 Funktionen von Strafe 161 3 Die Funktion von Strafe in und zwischen sozialen Gruppen 163 4 Formen sozialer Sanktionen 165 5 Rache und Vergeltung 167 6 Fazit: Wieso überhaupt psychologische Vergeltungsforschung? 170 Literatur 171 Kapitel 9 Interkulturelle Aspekte von Gerechtigkeit Susanne Jodlbauer und Bernhard Streicher 175 1 Der Einfluss der Kultur auf das Gerechtigkeitserleben - Der Beginn einer neuen Forschungsrichtung 175 2 Kulturelle Unterschiede in Gerechtigkeitsnormen 177 3 Das Drei-Stufen-Modell der Gerechtigkeit 178 3.1 Interkulturelle Forschung zu distributiver Gerechtigkeit 180 3.1.1 Interkulturelle Unterschiede im Erleben distributiver Gerechtigkeitsregeln 180 3.1.2 Interkulturelle Unterschiede im Erleben distributiver Gerechtigkeitskriterien 183 3.1.3 Interkulturelle Unterschiede im Erleben distributiver Gerechtigkeitspraktiken 184 3.2 Interkulturelle Forschung zu prozeduraler Gerechtigkeit 186 3.2.1 Interkulturelle Unterschiede im Erleben prozeduraler Gerechtigkeitskriterien 186 3.2.2 Interkulturelle Unterschiede im Erleben prozeduraler Gerechtigkeitspraktiken 189 3.3 Interkulturelle Forschung zu informationaler Gerechtigkeit: Gerechtigkeitskriterien und -praktiken 190 3.4 Interkulturelle Forschung zu interpersonaler Gerechtigkeit: Gerechtigkeitskriterien und -praktiken 190 4 Fazit 193 Literatur 194 Kapitel 10 Gerechtigkeit in sozialen Systemen: Ein Resümee Mario Gollwitzer, Sebastian Lotz, Thomas Schlösser und Bernhard Streicher 199 Literatur 204 Die Autorinnen und Autoren des Bandes 205 Sachregister 207 |
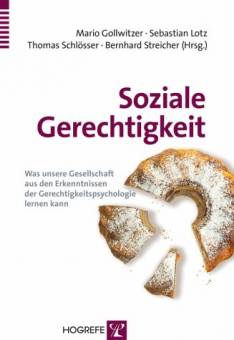
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen