|
|
|
Umschlagtext
Bei der Behandlung von Kindern mit Entwicklungsstörungen spielt in der Ergotherapie seit einigen Jahren die Sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres eine bedeutsame Rolle. Der ständige Wissenszuwachs in der Neurophysiologie verlangt es, das Konzept von Jean Ayres weiterzuentwickeln, um ein zielorientiertes und indikatives Behandeln zu ermöglichen.
Das interdisziplinäre Autorenteam Karoline Borchardt, Dietrich Borchardt, Jürgen Kohler, Franziska Kradolfer hat sich in dem nun vorliegenden Buch der Aufgabe gestellt, umfassend die aktuellen theoretischen und neurophysiologischen Grundlagen der Wahrnehmungsprozesse bzw. der sensorischen Integration sowie der Diagnostik zur Abklärung von Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten darzustellen. Der indikative Einsatz der Sensorischen Integrationstherapie wird differenziert und praxisorientiert dargestellt und durch Behandlungsbeispiele konkretisiert. Die Autoren haben mit diesem Buch eine Lücke in der deutschsprachigen Literatur gefüllt und eine „Pflichtlektüre“ für alle Ergotherapeuten verfasst, die das Konzept der sensorischen Integration als wesentlich für ihr therapeutisches Handeln ansehen. Rezension
Lehrerinnen und Lehrer begegnen nicht wenigen Kindern mit Entwicklungsstörungen und sollten dafür sensibilisiert sein. In diesem Buch werden die neurophysiologischen Grundlagen der Wahrnehmungsprozesse bzw. der sensorischen Integration sowie die Diagnostik zur Abklärung von Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten umfassend dargestellt. Nach der Diagnotik wird dann praxisnah die neuere Sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres auch mit konkreten Behandlungsbeispielen vorgestellt. Dabei wird die Integration von sensomotorischen
Sinnesreizen und basalen Sinneseindrücken als wichtigste Voraussetzung für die psychomotorische und mentale Entwicklung angesehen. Das gilt es in der Ergotherapie zu fördern. Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort . 9
Einleitung 11 Teil I: Theorie 1 Grundlagen 21 1.1 Sensorische Integration / Sensorische Verarbeitung 22 1.1.1 Bezugsrahmen der Ergotherapie22 1.1.2 Entwicklungsgeschichte der Sensorischen Integration27 1.1.3 Terminologie, Postulate und Annahmen von J. Ayres 33 1.1.4 Wirkfaktoren der Sensorischen Integrationstherapie 37 1.1.5 Klinische Beschreibung und funktionelle Auswirkungen39 1.1.6 Sensorische Verarbeitungsstörungen im Kontext von Störungsklassifikationen41 1.1.7 Prävalenz42 1.1.8 Ätiologie 43 1.2 Sensorische Verarbeitungsstörung44 1.2.1 Abgrenzung zu klassifi zierten Störungen 44 1.2.2 Qualitative Beurteilung 46 1.2.3 Merkmale51 1.3 Theorie und Grundprinzipien der Sensorischen Verarbeitung52 1.3.1 Übergeordnete sensorische Systeme 55 1.3.2 Untergeordnete sensorische Systeme 63 1.3.3 Motorische Aspekte der Sensorischen Integration 66 1.3.4 Die Bedeutung der Sensorischen Verarbeitung (Integration) für die Entwicklung67 1.4 Dysfunktionsmuster 73 1.4.1 Sensorische Verarbeitungsstörung79 1.4.2 Sensorische Diskriminationsstörung 81 1.4.2.1 Merkmale der Sensorischen Diskriminationsstörung 82 1.4.2.2 Untersuchungsprozess einer Sensorischen Diskriminationsstörung 87 1.4.3 Sensorische Modulationsstörung 88 1.4.3.1 Merkmale einer Sensorischen Modulationsstörung95 1.4.3.2 Untersuchungsprozess der Sensorischen Modulationsstörung ....99 1.4.4 Sensorisch basierte Motorikstörung99 1.4.4.1 Merkmale einer Sensorisch basierten Motorikstörung 103 1.4.4.2 Untersuchungsprozess einer Sensorisch basierten Motorikstörung108 Anhang Historische Entwicklung: Sensorische Integration – Sensorische Verarbeitung 110 2 Kenntnisse 115 2.1 Neurophysiologische und neurobiologische Grundlagen der Sensorischen Verarbeitung (Integration) ..116 2.1.1 Allgemeine Übersicht117 2.1.2 Sensorische Systeme122 2.1.2.1 Somatosensorisches System 122 2.1.2.2 Vestibuläres und auditives System 124 2.1.2.3 Olfaktorisches und gustatorisches System127 2.1.2.4 Visuelles System 129 2.1.3 Sensorische Verarbeitung und Zeitwahrnehmung131 2.1.4 Der Thalamus als zentrales Relais der Sensorischen Verarbeitung (Integration) 132 2.1.5 Affektive und kognitive Kontrolle der Sensorischen Verarbeitung (Integration) 134 2.1.5.1 Das limbische System 135 2.1.5.2 Motivations- und Belohnungssystem 137 2.1.6 Motorische Systeme 138 2.1.6.1 Basalganglien 141 2.1.6.2 Kleinhirn142 2.1.7 Die Neurobiochemie der Sensorischen Verarbeitung (Integration) – Grundlagen der chemischen Signalübertragung im ZNS146 2.1.8 Pharmakologische Interventionen am Beispiel der Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADS / ADHS) 148 2.2 Neuropsychologische Aspekte 150 2.2.1 Multisensorische Integration und Gehirnfunktion 151 2.2.2 Sensorische Verarbeitung (Integration) und Gedächtnis 154 2.2.3 Intelligente Leistungen des Gehirns 157 2.2.4 Sensorische Verarbeitung und Lernen 161 2.2.4.1 Lernpsychologisches Vorgehen165 2.2.4.2 Lernen am Erfolg (operantes Konditionieren) 166 2.2.4.3 Lernen am Modell167 2.2.5 Die Verhaltensanalyse (Diagnostik) 170 Teil II: Therapie 3 Untersuchungsprozess 175 3.1 Medizinische Diagnosen176 3.2 Ergotherapeutischer Untersuchungsprozess177 3.2.1 Bedeutung und Inhalt 177 3.2.2 Untersuchungsprozess in der Pädiatrie177 3.3 Untersuchungsprozess der Sensorischen Verarbeitungsstörung 182 3.3.1 Nicht standardisierte Untersuchungsverfahren185 3.3.2 Teilstandardisierte Untersuchungsverfahren188 3.3.3 Standardisierte Untersuchungsverfahren 191 3.4 Zusammenstellung und Interpretation der Befunde 195 3.5 Dokumentation der Ergebnisse 198 Anhang A Klinische Beobachtungen zur Sensorischen Integration (KB-SI) Anweisung 205 B Klinische Beobachtungen zur Sensorischen Integration (KB-SI) Interpretation259 C Übersichtstabelle geeigneter Untersuchungsverfahren zur Überprüfung Sensorischer Verarbeitungsstörung277 4 Therapie und Beratung bei Dysfunktionen der Sensorischen Verarbeitung 289 4.1 Therapiemethoden290 4.1.1 Therapeutischer Rahmen 290 4.1.2 Therapeutische Vorgehensweise 293 4.1.2.1 Therapie als Problemlöseprozess 293 4.1.2.2 Auswahl der geeigneten Behandlungsmethode 297 4.2 Therapie bei primärer Sensorischer Verarbeitungsstörung 300 4.2.1 Sensorische Verarbeitungsstörung300 4.2.2 Sensorische Diskriminationsstörung 329 4.2.3 Sensorische Modulationsstörung 342 4.2.4 Sensorisch basierte Motorikstörung356 4.3 Therapie bei sekundärer Sensorischer Verarbeitungsstörung377 4.3.1 Hyperkinetische Störung oder Aufmerksamkeitsdefi zit 377 4.3.2 Autismus 386 4.4 Therapiemittel 410 4.4.1 Therapiegeräte und -material 410 4.4.2 Geräte- und Materialanalyse 411 Literaturverzeichnis 434 Glossar 446 Die Autorinnen und Autoren 455 Leseprobe: Vorwort Die Ergotherapie hat bei Kindern mit Entwicklungsstörungen in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung erlangt. Therapieziele und die entsprechenden „Heilmittel“ sind im Heilmittelkatalog aufgeführt. Bei ein und demselben „Heilmittel“ können allerdings unterschiedliche Therapieverfahren eingesetzt werden. Ein häufiges Verfahren ist die Sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres, bei dem Wahrnehmungsverarbeitungsprozesse im Mittelpunkt stehen. Die Integration von sensomotorischen Sinnesreizen und basalen Sinneseindrücken (taktil, kinästhetisch, propriozeptiv und vestibulär) wird als wichtigste Voraussetzung für die psychomotorische und mentale Entwicklung angesehen. Somit wird im therapeutischen Prozess der Förderung der „neurophysiologischen Grundlagen“ für die sensorische Integration eine außerordentlich große Bedeutung beigemessen. Aus einer detaillierten und umfassenden Darstellung des aktuellen Wissensstandes der neurophysiologischen Grundlagen der Wahrnehmungsprozesse ergibt sich eine Weiterentwicklung des Konzeptes von J.Ayres. Die Sensorische Integration wird nun als ein Prozess verstanden, bei dem Informationen aus den Sinnessystemen so verarbeitet und moduliert werden, dass sie präzise in die kognitiven und motorischen neuronalen Strukturen eingebunden werden. Der Wahrnehmungsprozess soll bei der Therapie auf allen Ebenen im Hinblick auf die Verbesserung der Lernfähigkeit berücksichtigt und beeinflusst werden. Die therapeutischen Techniken und Vorgehensweisen ändern sich dabei und es wird der Interaktion, dem Modell-Lernen und Elementen der Spieltherapie ein größerer Wert zuerkannt. Die eigenen Ressourcen des Kindes sollen in den Therapieaufbau eingebunden werden, der damit sehr flexibel zu gestalten ist. Die direkte Beeinflussung der festgestellten oder vermuteten Funktionsstörungen respektive Wahrnehmungsstörungen wird erweitert um die Gestaltung der Lernsituation (Beziehung: Spiel und Therapiematerial). Besonderen Wert legen die Autoren auf eine exakte Diagnose und die Festlegung der Ziele der Therapie sowie der Evaluation des Therapieergebnisses. Die wichtigsten Tests werden im Einzelnen vorgestellt und interpretiert. Das Vorgehen bei der Therapie von „primären Dysfunktionen der sensorischen Integration“ wird differenziert beschrieben. Es wird auch eine ausführliche Material- und Geräteanalyse vorgelegt, bei der im Wesentlichen auf die Wirkfaktoren in Bezug auf die sensorische Aktivierung und Verarbeitung eingegangen wird. Dadurch sollen auch Erkenntnisse über die möglichen Wechselwirkungen von Wahrnehmung und Handlung vermittelt werden. Das Buch hat den Charakter eines Lehrbuches, in dem die theoretischen und neurophysiologischen Grundlagen der Wahrnehmungsprozesse bzw. der sensorischen Integration, die Diagnostik zur Abklärung von Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten und die Therapie bei Störungen der sensorischen Integration aus Sicht der Ergotherapie in vorbildlicher Weise beschrieben werden. Es kann als Pflichtlektüre für alle Lehrtherapeuten angesehen werden und muss allen Ergotherapeuten empfohlen werden, die das Konzept der sensorischen Integration als wesentlich für ihr therapeutisches Handeln ansehen. Es ist den Autoren gelungen, eine Wissenslücke in der deutschsprachigen Literatur zu füllen. Prof. Dr. Dieter Karch Einleitung Sensorische Integration* bezeichnet den Prozess, über aktivierte und modulierte Sinnessysteme Informationen so zu verarbeiten, dass diese präzise in die kognitiven und motorischen Bereiche neuronaler Strukturen eingebunden werden. Die Sinnessysteme steuern über Rückmeldung, Vorstellung und Vorwissen den Aufbau und die Umsetzung von Handlungsplänen. Sinnesempfi ndungen aus dem eigenen Körper und der Umwelt lenken den Wahrnehmungsverarbeitungsprozess für den Gebrauch. Über das Mit-sich-und-der-Umwelt-in-Kontakt-sein sowie über den adäquaten Umgang mit Anforderungen und Erfordernissen (im Sinne von Anpassung und Gestaltung) entwickeln sich beim Einzelnen Selbstwertgefühl, soziale Kompetenz und Lernfähigkeit. Der Prozess der Wahrnehmungsverarbeitung besteht aus den Komponenten Reizaufnahme, Reizweiterleitung, Reizunterscheidung, Reizbewertung, Reizspeicherung, Reizmodulation und Verknüpfung mit den kognitiv-emotionalen / kognitiv-motorischen Schemata im Gehirn. In jedem dieser Abschnitte werden die Sinnesinformationen in die neuronale Verarbeitung integriert. „Sensorisch integrierte“ Personen können durch ihr Verhalten in den Tätigkeitsbereichen des Alltags besser zurechtkommen und ihr Handlungsrepertoire zur Aufgabenbewältigung sinnvoller einsetzen und stetig erweitern. Zeigt nun ein Kind Auffälligkeiten im Verhalten und in der Alltagsbewältigung und weist das Ergebnis einer Ausschlussdiagnostik auf Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung hin, so bietet sich die spezifi sche Diagnostik zur Überprüfung der sensorischen Integration an. Die Wahrnehmungsverarbeitung wird dann hinsichtlich der Muster bzw. Erscheinungsbilder der Sensorischen Verarbeitungsstörung untersucht: Sensorische Diskriminationsstörung Sensorische Modulationsstörung Sensorisch basierte Motorikstörung Die Diagnostikverfahren ermöglichen nicht nur eine Differenzierung der Sensorischen Verarbeitungsstörung, sondern auch eine Unterscheidung zu anderen Störungen, sie tragen somit zur Optimierung des therapeutischen Vorgehens bei. Nach J. Ayres bildet die sensomotorische Entwicklung die Voraussetzung für die mentale Entwicklung („Bausteine der Entwicklung“). Über zunehmende Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten erforscht das Kind seine Umgebung, betätigt sich, bewältigt Aufgaben und gestaltet, was die Ausprägung kognitiver Strukturen fördert. * Der Begriff „sensorisch“ wird in diesem Buch zum einen als Teil eines Fachterminus eingesetzt, zum anderen in einem allgemeinen, übergreifenden Sinne. Je nachdem, wie er verwendet wird, erfolgt eine Groß- bzw. Kleinschreibung. Auf der sensomotorischen Ebene steuern vor allem die „basalen“ Sinneseindrücke des taktilen (Berührung), des propriozeptiven (Zug, Druck) und des vestibulären (Gleichgewicht) Systems Haltung und Bewegung. Die „höheren Sinne“ oder „Fernsinne“ wie Sehen und Hören (weniger: Geschmack und Geruch) steuern ebenfalls über den Kortex die Fein- und Willkürmotorik. Sensorisch angepasste Körperhaltung und Körperbewegungen gewährleisten gemeinsam mit den „Anordnungen“ des zerebralen Kortex (Überprüfung durch höhere Sinne, Handlungsplanung, Umsetzung) die Ausführung tätigkeitsbezogener motorischer Leistungen. „Einer top-down-Kontrolle der Willkürmotorik steht folglich eine von unten nach oben verlaufende bottom-up-Vorgabe der Stütz- und Gangmotorik gegenüber.“ (Pritzel, Brand, Markowitsch, 2003, S. 249). Im Teil I Theorie, Kap. 1 Grundlagen, werden die hier zusammengefassten Inhalte ausführlich behandelt. Besteht eine Sensorische Verarbeitungsstörung, ist es nicht oder nur bedingt möglich, die Sinneseindrücke aus verschiedenen Wahrnehmungsbereichen in einem Handlungsschema optimal zu nutzen. Damit sind nicht nur die neuromotorischen Bewegungsmuster und die kognitiv-emotionale Verarbeitung beeinträchtigt, sondern auch das beobachtbare (End-) Verhalten. Lern-, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen tragen beim Kind dazu bei, dass es den alltäglichen Anforderungen nicht gerecht werden kann. Die Ursachen der Verhaltensprobleme sind meist nicht erfahrbar und erfassbar. Somit sind Kinder und ihre Bezugspersonen aus eigener Analyse oft nicht in der Lage, die Probleme zu erkennen und zu verändern. Mit einsetzender Hilfl osigkeit meiden die Kinder ihre Probleme und Unzulänglichkeiten. Bei Eltern breitet sich Resignation aus oder sie fordern mehr Leistung ein. Einsetzende Misserfolge frustrieren beide Seiten. Das Kind entwickelt Widerstände gegenüber Tätigkeiten, bei denen es sich z.B. als ungeschickt erlebt. Werden die Ursachen des Problemverhaltens nicht erkannt, sind die überlegten Lösungswege ebenfalls nicht effektiv. Zur Verbesserung der eigenen Analysefähigkeit bei Problemen kann auf Kap. 2 Kenntnisse hingewiesen werden. Hier werden neuronale Abläufe und der Einfl uss von Intelligenzleistungen auf die sensorische Verarbeitung erklärt. Über „verstehende Diagnostik“ (Medizinische Diagnostik, Ergotherapeutisches Assessment, SI-Beobachtungen etc.) werden die Probleme erfasst und beschrieben, Therapieziele formuliert und der therapeutische Rahmen bestimmt. Der Untersuchungsprozess wird ausführlich in Teil II Therapie dargestellt. Das Kind steht im Mittelpunkt der Behandlung. Ressourcen des Kindes werden in die Therapie einbezogen, so dass der Therapieaufbau an dem Punkt (auf dem Niveau) beginnt, an dem das Kind durch eigenes Verhalten erfolgreich Tätigkeiten / Spielhandlungen verrichten kann. Abhängig von der Art der diagnostizierten Sensorischen Verarbeitungsstörung kommen entsprechende Therapiestrategien in Tätigkeitsfeldern und Therapiegeräte (s. Geräteanalyse) zur Anwendung, um Wahrnehmungssysteme über – für Tätigkeiten benötigte – Bewegungen zu aktivieren. Die resultierenden Sinnesinformationen können dann im Tätigkeitsmuster (praktisch und neural) mit dem Ziel der optimalen Umsetzung von Handlungsplänen / Ideen integriert werden. Aufgrund der nach Schwierigkeitsgrad gestuften Vorgehensweise, aber auch vom Erfolg beim Vorgehen abhängig, kann das Kind leichter seine erlernten Versagensängste erfahren und abbauen. Diese aktive Konfrontation in vivo gepaart mit der Erfahrung, die Aufgaben lösen und Tätigkeiten zu Ende bringen zu können, führt zur Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Beide Erfahrungen beeinfl ussen besonders die Motivation des Kindes, bewusst bzw. gezielt selbständig Tätigkeiten auszuführen, was sich fördernd auf die persönliche Entwicklung auswirkt. Fischer, Murray und Bundy (1998, S. 28, 30, 58-60) beschreiben in ihrem Spiralprozessmodell der Selbstaktualisierung, dass das Vertrauen des Kindes in seine Fähigkeiten die Grundvoraussetzung für sein Handeln bzw. Tätigsein darstellt. Jeder erfolgreiche, mit Freude erlebte Lösungsschritt, der bei der Bewältigung einer komplexen Aufgabe absolviert wird, trägt dazu bei, Vertrauen in sich selbst aufzubauen. Voraussetzung für die Ausbildung von Motivation Aufgaben zu bearbeiten ist das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, die Vorstellung über den Wert und die Bedeutsamkeit einer Tätigkeit. Außerdem spielt die Antizipation, ob eine Tätigkeit Erfolg verspricht und Freude bereitet, für den Aufbau von Motivation eine entscheidende Rolle. Lernfortschritte in der Therapie haben (meist) dann Bestand, wenn sie in die Tätigkeitsbereiche im sozialen Umfeld übertragen werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass nicht nur der Therapeut das Problem des Kindes und seine Lösung versteht, sondern auch Bezugspersonen des Kindes, damit es nicht zu Rückschritten kommt. Sowohl das Problem des Kindes, das Erklärungsmodell für Verursachung und Aufrechterhaltung der Störung als auch das entsprechende Vorgehen in der Behandlung sollten von allen Beteiligten gesehen und geteilt werden. Unter diesen Bedingungen ist ein Kind eher in der Lage seine weiterführenden Erfahrungen aus der Therapie in den Alltag, in die Familie und Schule zu übertragen. Eine ausführliche Darstellung fi ndet sich in Kap. 4 Therapie und Beratung bei Dysfunktionen der Sensorischen Verarbeitung. Zeigen sich Störungen der sensorischen Verarbeitung im Rahmen eines anderen Störungsbildes (z.B. beim Aufmerksamkeitsdefi zitsyndrom, bei Lese- und Rechtschreibschwäche etc.) können u.U. mehrere Behandlungsansätze (Pharmakotherapie, Sensorische Integrationstherapie, Elternberatung) in einem multidisziplinären Team zur Problemlösung eingesetzt werden. Bisher wurde der Begriff „Sensorische Integration“ (SI) zur Erklärung und Verarbeitung von Sinneswahrnehmung für den alltäglichen Gebrauch auf unterschiedliche Art benutzt: für eine Theorie: Theorie der SI für funktionelle Muster: normale SI-Fähigkeiten für Dysfunktionen der Muster: SI-Störungsbilder für eine Diagnose: SI-Assessment für eine therapeutische Anwendung: SI-Therapie Diese inzwischen gebräuchlichen Annahmen erklären nur ungenügend die neurobiologischen und neuropsychologischen Abläufe der sensorischen Integration. Aus Beobachtungsdaten wird auf Funktionen im ZNS geschlossen. Neuere Annahmen gehen davon aus, dass der Prozess der sensorischen Integration auf zellulärer Ebene im ZNS stattfi ndet und In- und Output (Reizaufnahme, Reizleitung, Reizverarbeitung) beeinflusst. Er ist nur über invasive elektrophysiologische Aufzeichnungstechniken beobachtbar. In diesem Zusammenhang bezieht sich sensorische Integration auf das Zusammenwirken (Konvergenz) erregender Signale, zu einem bestimmten Zeitpunkt aller aktivierten sensorischen Modalitäten, somit auf das aufeinander abgestimmte Wirken einzelner Neurone über ihre Integration in Netzwerke von Nervenzellen. Aus neurobiologischer Sicht werden über Neurone und deren Netzwerke im ZNS innere und äußere Anforderungen / Reize / Informationen (sensorischer Input) mit dem Ziel einer angepassten Reaktion (kognitiv) verarbeitet. Zeigen sich dabei Defi zite im Aufnehmen, Interpretieren und angepassten Reagieren kann von einer Sensorischen Verarbeitungsstörung gesprochen werden (Miller et al., 2004). Für den Gebrauch des Wortes „Verarbeitung“ spricht, dass es für ein Tun steht, bei dem eine Anzahl einzelner defi nierbarer Schritte und / oder Operationen abläuft, die zu einem spezifischen Ergebnis führen. Es kann angenommen werden, dass das Wort „Verarbeitung“ im Kontext der Sensorischen Verarbeitungsstörung für die Beeinträchtigung der bzw. für ein Unvermögen in der sensorischen Diskrimination, sensorischen Modulation und / oder der Interpretation von sensorischen Ereignissen steht. Ist dieser Verarbeitungsprozess in Verbindung mit dem kognitiven Handlungsschema gestört, zeigt sich eine atypische bzw. unangepasste motorische Verhaltensreaktion. Abhängig von diesen Überlegungen wird die Störung der Sensorischen Integration jetzt Sensorische Verarbeitungsstörung genannt (s. Kap. 1). Wenn es um eine Störung der Sensorischen Integration geht, wird in diesem Buch immer der Begriff „Sensorische Verarbeitungsstörung“ verwendet. Die Theorie der Sensorischen Integration und die SI-Therapie bleiben als Begriffe erhalten. Sie basieren auf den ursprünglichen Prinzipien von J. Ayres und beinhalten sowohl eine Methode als auch einen Bezugsrahmen innerhalb der Ergotherapie. In den Klinischen Beobachtungen zur Sensorischen Integration werden Formen der sensorischen Verarbeitung bei festgelegten motorischen Aufgaben erfasst. Dysfunktionales Verhalten wird als Sensorische Verarbeitungsstörung gewertet und den Störungsbildern Sensorische Diskriminationsstörung, Sensorische Modulationsstörung und Sensorisch basierte Motorikstörung zugeordnet. Diese veränderte Terminologie präzisiert die diagnostischen Kategorien für Kinder mit sensorischer Symptomatik. Sie hat die Chance in bestehende Klassifi kationssysteme (ICD-10, DSM-IV) aufgenommen zu werden. Hiermit würde auch die Kritik von D. Karch (2003, S. 220) berücksichtigt, der feststellt: „[...] die sensorische Integrationstherapie beruht auf theoretischen Annahmen, die dem heutigen Verständnis der Entwicklungsneurologie nicht mehr entsprechen.“ Er sieht zwar eine Modifi kation und Modernisierung der theoretischen Annahmen, zweifelt aber an deren Umsetzung in der Therapie. Er regt an, die Existenz neurophysiologisch begründeter Verarbeitungsstörungen sensorischer Informationen konkreter nachzuweisen, als dies bisher mit den vorhandenen diagnostischen Mitteln möglich war. In diesem Buch wird ein Überblick über diagnostische Mittel für verschiedene sensorische, sensomotorische und perzeptiv-kognitive Verarbeitungsbereiche und über die Therapiemittel gegeben (s. Teil II). Der Einfachheit halber haben wir uns entschieden, durchweg die männliche Form zu verwenden. |
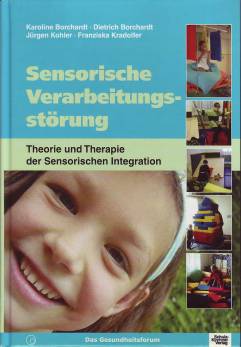
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen