|
|
|
Umschlagtext
Bisher hat ein Konzeptentwurf für Schulpastoral angesichts religiöser Pluralität gefehlt. Diese Leerstelle füllt Ulrich Kumher mit einem Vorschlag, der zwei Theoriestränge miteinander verbindet, das interkulturelle Seelsorgekonzept und die Reflexionen Raimon Panikkars. Die Kombination erlaubt es, sowohl Einzelseelsorge und Beratung als auch die Begegnung zwischen Gruppen im Blick zu behalten. Kern des Konzeptentwurfs ist die Entfaltung von Begegnungen in interreligiöser und interkultureller Perspektive. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Themenkomplex Geschlechterdifferenz und Geschlechtersensibilität. Durch die Zuspitzung auf die Situation an Berufsschulen und mit Hilfe der kirchlichen Grundvollzüge werden die konzeptionellen Überlegungen in die Praxis verlängert.
Autor: Ulrich Kumher, geb. 1976, Studium in Würzburg, 2002 Diplom in Kath. Theologie, 2003 Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in Kath. Religionslehre und Deutsch, 2004 – 2007 Stipendiat im Graduiertenkolleg „Wahrnehmung der Geschlechterdifferenz in religiösen Symbolsystemen“, 2008 bis 2010 Studienreferendar, weiterer Forschungsschwerpunkt: Religion in den Medien. Rezension
Schulpastoral / Schulseelsorge möchte einen Beitrag zur Humanisierung der Schule leisten, dazu gehört auch die religiös-plurale Begegnung, um die es in dieser Würzburger Dissertation geht. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag für die Konzeptentwicklung einer Schulpastoral zu leisten, die auf die Anforderungen religiöser Pluralität an deutschen Schulen Bezug nimmt.Schulbezogene Jugendarbeit und Schulseelsorge eröffnen Orte der Begegnung; die Begegnung der Religionen ist ein immerwährender Prozeß. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund sowie mit einem zunehmenden Orientierungsbedürfnis in einer multioptionalen Gesellschaft erlangt Schulpastoral wie interreligiöse Begegnung gleichermaßen verstärkt öffentliches Interesse. Religiöse Pluralität wird mit Fragestellungen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen verbunden. Um die Komplexität religiöser Pluralität anzudeuten, seien einige dieser Fragestellungen genannt: Nach welcher Logik funktioniert das Zusammenleben zwischen den Angehörigen verschiedener Religionen und Weltanschauungen? Wie lassen sich Konflikte, bei denen die Religiosität der Beteiligten eine Rolle spielt, konstruktiv lösen? Wie steht es um den Wahrheitsgehalt bzw. den Wahrheitsanspruch der einzelnen Religionen angesichts ihrer Vielzahl?
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort XII
Einleitung 1 1. Schulpastoral vor einer neuen Herausforderung 1.1. Schulpastoral 1.1.1. Gegenstand der Praktischen Theologie, speziell der Pastoraltheologie 1.1.2. Historische Entwicklung 1.1.3. Definitionen, Begründung und Konzeptionen von Schulpastoral 1.1.4. Schulpastoral, Schulseelsorge und Schülerseelsorge 1.1.5. Ziele der Schulpastoral 1.1.6. Abgrenzungen: Schulsozialarbeit und Religionsunterricht 1.1.7. Kirchliche Grundvollzüge und Schulpastoral 1.1.8. Organisation und Trägerschaft von Schulpastoral 1.2. Religiöse Pluralität als Kennzeichen unserer Epoche 1.2.1. Religiöse Unterschiede 1.2.2. Religion und Kultur 1.2.3. Verschiedene Wissens-, Verstehens- und Glaubenshorizonte der Religionen 1.2.4. Anmerkungen zur interreligiösen Kommunikation 1.2.5. Prozesse der Veränderung 1.2.6. Konsequenzen der religiösen Pluralisierung 1.2.7. Konflikte und Friedensbemühungen 1.2.8. Religionsdiagnostische Modelle 1.3. Religiöse Pluralität als Herausforderung für die Schule und für die Schulpastoral 1.3.1. Religiöse Pluralität in der Schulwirklichkeit 1.3.2. Herausforderungen innerhalb und außerhalb des Unterrichts 1.3.3. Religiöse Pluralität als Herausforderung für die Schulpastoral 1.3.4. Herausforderungen religiöser Pluralität entlang der kirchlichen Grundvollzüge 2. Forschungs- und Entwicklungsstand zu „religiöser Pluralität und Schulpastoral“ 2.1. Aufsätze und Lexikonartikel zur Schulpastoral 2.2. Kirchliche Verlautbarungen und Dokumente 2.2.1. II. Vatikanum (1962-1965) 2.2.2. Würzburger Synode (1972-1975) 2.2.3. Vereinigung der Deutschen Ordensoberen (1990) 2.2.4. Die deutschen Bischöfe (1996) 2.2.5. Die deutschen Bischöfe (2003) 2.2.6. Die deutschen Bischöfe (2005) 2.3. Fernstudienmaterial „Fort- und Weiterbildung Schulpastoral“ (Würzburg) 2.4. Beiträge zur interkulturellen Seelsorge 2.5. Zusammenfassung der Befunde und Formulierung des Forschungsdesiderats 2.6. Anforderungen an eine interreligiös engagierte Schulpastoral gemäß der Analyse religiöser Pluralität 2.6.1. Interkulturalität 2.6.2. Differenzierte und multiperspektivische Wahrnehmung 2.6.3. Sensibilität für Ursachen von Verständigungsproblemen und Konflikten 2.6.4. Geschlechtersensibilität 2.6.5. Rücksicht auf Freiheits- und Identitätssicherungsbedarf 2.6.6. Ermöglichung und Gestaltung von Kontakten 2.6.7. Suche nach Verständigungsbrücken, gemeinsamen Werten und Aufgaben 2.6.8. Mehrdimensionales Engagement 2.7. Anfragen an das Konzept einer interreligiös engagierten Schulpastoral 2.7.1 Konzeptauswahl und Leitideen? 2.7.2. Begründung? 2.7.3. Religionstheologisches Modell? 2.7.4. Ziele? 2.7.5. Dreh- und Angelpunkt des Konzepts? 2.7.6. Kompetenzprofil? 2.7.7. Ort und Adressaten von Schulpastoral? 2.7.8. Grundvollzüge? 3. Einsatzort für eine interreligiös engagierte Schulpastoral 3.1. Wirklichkeit an berufsbildenden Schulen und speziell an Berufsschulen 3.1.1. Heterogenität 3.1.2. Vielzahl an Übergangsphasen und Entscheidungssituationen 3.1.3. Umbrüche und Orientierungswechsel 3.1.4. Drohende (Jugend-)Arbeitslosigkeit 3.2. Schulpastorales Engagement an berufsbildenden Schulen und speziell an Berufsschulen 3.3. Ziele der Untersuchung 3.4. Beschreibung des Fragebogens 3.4.1. Religiosität 3.4.2. Ambiguitätstoleranz, Perspektivenwechsel, Empathie und Goldene Regel im Kontext religiöser Pluralität 3.4.3. Konfliktbewältigungsmodi im Kontext religiöser Pluralität 3.4.4. Zukunftsängste 3.4.5. Geschlecht 3.5. Hospitationsphase und Try out 3.6. Auswahl der Stichprobe und Durchführung der Erhebung 3.7. Beschreibung der Stichprobe 3.8. Ergebnisse 3.8.1. Religiosität 3.8.2. Ambiguitätstoleranz, Perspektivenwechsel, Empathie und Goldene Regel im Kontext religiöser Pluralität 3.8.3. Konfliktbewältigungsmodi im Kontext religiöser Pluralität 3.8.4. Zukunftsängste 3.8.5. Geschlecht 3.9. Kommentare 4. Konzeptentwurf für eine interreligiös engagierte Schulpastoral 4.1. Konzeptauswahl und Leitideen 4.1.1. Kombination 4.1.2. Kultur und Religion 4.1.3. Ermöglichung und Bewahrung von Vielfalt und Verschiedenheit 4.1.4. Multidimensionales Menschenbild 4.1.5. Begegnungen 4.1.6. Sensibilität für Natur und soziale Beziehungen 4.1.7. Interkulturelle Kommunikation 4.2. Begründung für die Auseinandersetzung mit religiöser und kultureller Pluralität 4.3. Religionstheologisches Modell 4.4. Ziele 4.5. Dreh- und Angelpunkt des Konzepts 4.5.1. Fünf Möglichkeiten des Zusammentreffens von Menschen unterschiedlicher Religionen 4.5.2. Begegnung und Dialog 4.5.3. Spielregeln der religiösen Begegnung 4.5.4. Kennzeichen von Begegnungen 4.6. Kompetenzprofil 4.6.1. Aufgeschlossenheit 4.6.2. Vertrauen 4.6.3. Pluralitätstoleranz 4.6.4. Wahrnehmungssensibilität und Selbstreflexivität 4.6.5. Wissen 4.7. Ort und Adressaten von Schulpastoral 4.7.1. Eine gegenüber Orthodoxie mit Zurückhaltung rechnende Schulpastoral 4.7.2. Eine für Pluralität einstehende und ihre Bewältigung gestaltende Schulpastoral 4.7.3. Eine die Angst vor Arbeitslosigkeit und sinkendem Lebensstandard bändigende Schulpastoral 4.7.4. Eine geschlechtersensible Schulpastoral 4.8. Schulpastoral entlang der kirchlichen Grundvollzüge 4.8.1. Einander und anderen dienen und helfen 4.8.2. Glauben gegenseitig vorleben 4.8.3. Gemeinsambeten und meditieren 4.8.4. Gemeinschaft üben und pflegen 5. Rituale als Begegnungschancen 6. Rückblick und Ausblick 6.1. Zusammenfassung der Ergebnisse 6.2. Ergänzung und Kombination weiterer Theoriestränge: Multiperspektivität 6.2.1. Bedingungen von Begegnungen 6.2.2. Dialogebenen und -hindernisse 6.2.3. Themenzentrierte Interaktion 6.2.4. Historische Hypotheken und mediale Tendenzen 6.3. Desiderate 7. Abkürzungsverzeichnis 8. Filmregister 9. Internetadressen 10. Literaturliste 11. Anhänge 11.1. Beschreibung der Stichprobe 11.1.1. Religionszugehörigkeit 11.1.2. Ausbildungsberuf 11.1.3. Schulabschluss 11.1.4. Herkunft der Jugendlichen 11.1.5. Herkunft der Mütter 11.1.6. Herkunft der Väter 11.2. Religiosität 11.2.1. Engagement in einer Religionsgemeinschaft 11.2.2. Kirch-, Synagogen- oder Moscheegang 11.2.3. Gebet 11.2.4. Religiöse Orientierungen 11.3. Bewältigung religiöser Pluralität 11.3.1. Ambiguitätstoleranz, Perspektivenwechsel, Empathie, Goldene Regel 11.3.2. Konfliktbewältigungsmodi 11.4. Zukunftsängste 11.5. Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern Leseprobe: Einleitung Schulpastoral ist darum bemüht, ihr Richtziel – einen Beitrag zur Humanisierung der Schule zu leisten – durch verschiedene Subziele einzuholen. Zu diesen Zielen gehört es, den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern und dem Schulpersonal in Notlagen und Konflikten beizustehen, Glaubenserfahrungen zu ermöglichen und die Persönlichkeitsentwicklung der Menschen im Bereich der Schule zu fördern. Inzwischen liegen einige schulpastorale Konzepte vor, die schulpastoralem Engagement verschiedene Ausprägungen geben. Bitter (2003) unterscheidet ein mystagogisches Konzept, ein karitatives Konzept, ein kommunikatives Konzept, eine personenzentrierte Schulseelsorge und ein diakonisches Konzept. Neben dem Begriff „Schulpastoral“ ist der Begriff „Schulseelsorge“ geläufig. Es gibt einige Bemühungen, diese Begriffe voneinander abzugrenzen und auf unterschiedliche Konnotationen festzulegen. Oft werden die Begriffe aber nicht voneinander unterschieden und synonym verwendet – wie in dieser Arbeit (vgl. 1.1.4.). „Schulsozialarbeit“ von Schulpastoral und Schulseelsorge zu unterscheiden, ist sinnvoll, da Schulsozialarbeit nicht damit verbunden wird, auf eine Glaubenswirklichkeit aufmerksam zu machen. Aufmerksamkeit für Schulpastoral In den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit für Schulpastoral sowohl evangelischerseits als auch katholischerseits angewachsen (z. B. Dam/Spenn 2007, 11; Mette 2007, 159). Dafür können verschiedene Gründe angeführt werden. Für Dam und Spenn (2007, 11) hängt dies zum einen „mit einem neuen Stellenwert der Frage nach Religion und Religionen auf dem Hintergrund eines zunehmenden Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund sowie mit einem zunehmenden Orientierungsbedürfnis in einer multioptionalen Gesellschaft“ zusammen. „Zum anderen gewinnen Aspekte wie Schulkultur, Schulleben, informelles Lernen und lebensweltliche Perspektiven auch in der Erziehungswissenschaft und in der Schulpädagogik bei Fragen der Schulentwicklung an Bedeutung, weil sie offenbar auch zur Verbesserung von Lernchancen förderlich sind“ (Dam/Spenn 2007, 11). In diesem Zusammenhang sind die Potenziale von Schulpastoral relevant, die dazu geeignet sind, aktuelle Herausforderungen an den Schulen zu bewältigen. Schulpastoral bringt die religiöse Dimension menschlichen Lebens durch Feiern und Feste, durch vielfältige Hilfestellungen und Unterstützung, durch Gemeinschaftsbildung sowie durch Verkündigung, Begegnungs- und Fortbildungsmöglichkeiten ins Spiel. Dies lässt Schulpastoral als Kooperationspartnerin und Unterstützungsmöglichkeit für die Schule interessant werden (z. B. Vierling-Ihrig 2007, 39). Als aktuelle Herausforderungen an Schulen sind u. a. die sinnvolle Gestaltung von Zeiten außerhalb des Unterrichts speziell an Ganztagsschulen oder ein gestiegener Leistungsdruck und die damit verbundenen Folgen wie Angst, Konkurrenz und Stress oder die mit religiöser Pluralität verbundenen Schwierigkeiten zu nennen. Um letztgenannte Herausforderung an der Schule soll es im Kontext von Schulpastoral in dieser Arbeit insbesondere gehen, zumal zum Thema „Schulpastoral und religiöse Pluralität“ aus pastoraltheologischer Perspektive bisher noch keine deutschsprachige Monographie vorliegt. Das gewachsene Interesse an Schulpastoral kann aber auch daran liegen, dass kirchlicherseits einiges von diesem Engagement erwartet wird. In einer Zeit, in der immer weniger Menschen die Kirchen aufsuchen, bietet Schulpastoral für Christinnen und Christen die Chance, auf Menschen zu zugehen und unter ihnen zu sein. Es wird nicht verschwiegen, dass Schulpastoral „den Boden für die Offenheit und das Interesse an religiösen Themen und kirchlichen Einrichtungen“ bereitet, einen „Beitrag zu einer höheren Akzeptanz von Kirche“ leistet und „durch ihr Auftreten im öffentlichen Raum der Schule auch eine Werbung für eine zeitgemäße und sympathische Gestalt von Kirche“ darstellt (Konferenz der bayerischen Referent/- innen für Schulpastoral 2007, 39). Vierling-Ihrig (2007, 41) sieht das kirchliche Engagement an der Schule als Gelegenheit für die Kirche, „ihr Profil und ihre Kernkompetenzen allen Menschen, die mit dem schulischen Kontext tangiert sind, aufzuzeigen und zu vermitteln.“1 Aus kirchlicher Perspektive mag die Aufmerksamkeit für Schulpastoral auch Frucht früherer Erkenntnisse und Forderungen sein. Im Jahr 1986 hatte Schneider (217) darauf hingewiesen, dass es für die Praxis der Schulseelsorge wichtig ist, „daß sich die Kirche ‚zur Welt bekehrt’ und in den Gemeinden die Verantwortung für den Bildungsbereich erneut bewußtmacht. Die Kirche muß das Getto fürchten. Um ihrer Identität willen muß sie möglichst weit aus dem eigenen Bereich heraustreten und den Dienst in den verschiedenen gesellschaftlichen Arbeits- und Lebensfeldern antreten. Sie muß sich allen öffnen, die sie beanspruchen wollen, muß sich aufgeschlossen und gastfreundlich erweisen. Für die S. [Schulseelsorge] bedeutet das auch, aus eigenem Entschluß den Weg zu allen Schulen zu suchen und Schüler, Eltern und Lehrer zu vielfältig denkbaren Begegnungen und Foren einzuladen.“ Schulpastoral kann einen Beitrag dafür leisten, dass es nicht bei einem Zerfall der „Volkskirche“ in Deutschland bleibt, sondern dass ein Übergang zu einer „Kirche für das Volk“ gestaltet wird. Gröger (2007, 32ff) sieht die Anfragen an die Kirche auch als pastorale Chancen. Seine Überlegung, dass der Moment gekommen sei, von der traditionellen Vorstellung Abschied zu nehmen, „wonach die Menschen zur 1 „Gleichzeitig zeigt die Kirche durch die Schulseelsorge ihre Präsenz an einem gesellschaftlich immer bedeutender werdenden Ort. Es ist wichtig, dass diese Präsenz authentisch und kontinuierlich ist sowie allen Menschen hilft, ihre Gegenwart zu gestalten und ihrer Zukunft positiv zu begegnen“ (Vierling-Ihrig 2007, 41). Wenn Kirche außerdem „in einer neuen Wachsamkeit wahrnimmt, dass junge Menschen die Frage nach dem Glauben an Gott im schulischen Kontext für sich in einer neuen Intensität stellen, dann muss sie sich wahrlich als Kirche ‚für das Volk’ in den Dienst nehmen lassen. Nicht zuletzt dadurch wird sie an Glaubwürdigkeit gewinnen“ (Gröger 2007, 35). Religiöse Pluralität Die religiöse Landschaft in Deutschland ist vielfältiger geworden. Dies macht sich auch an vielen deutschen Schulen bemerkbar. Vor allem Angehörige islamischer Glaubensrichtungen erweitern das Spektrum der Religiosität an den Schulen. Zudem gibt es vermehrt Schülerinnen und Schüler, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, aber als religiös eingestuft werden können, sowie Schülerinnen und Schüler, die den Glauben an einen Gott oder an eine höhere Macht zwar bewusst ablehnen – auch wenn sie vielleicht (noch) formell einer Religionsgemeinschaft angehören –, aber dennoch an einen Lebenssinn glauben. Religiöse Pluralität wird mit Fragestellungen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen verbunden. Um die Komplexität religiöser Pluralität anzudeuten, seien einige dieser Fragestellungen genannt: Nach welcher Logik funktioniert das Zusammenleben zwischen den Angehörigen verschiedener Religionen und Weltanschauungen? Wie lassen sich Konflikte, bei denen die Religiosität der Beteiligten eine Rolle spielt, konstruktiv lösen? Wie steht es um den Wahrheitsgehalt bzw. den Wahrheitsanspruch der einzelnen Religionen angesichts ihrer Vielzahl? Schulpastoral ist auf religiöse Pluralität aufmerksam geworden, da sie als kirchliches Engagement mit dem Ziel einer Humanisierung der Schulwirklichkeit Herausforderungen an Schulen registriert. Angesichts religiöser Pluralität bieten sich für die Schulpastoral zwei Wege an. Entweder sie beschränkt sich bei ihrem Engagement darauf, die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer anzusprechen, die Christinnen und Christen sind bzw. es (evtl.) noch werden wollen, oder aber sie hält ihre Angebote für alle Personen an der Schule offen, ungeachtet ihres jeweiligen religiösen Bekenntnisses. In der vorliegenden Arbeit wird aus mehreren Gründen der zweite Weg befürwortet: Erstens soll dem oft vorgebrachten Ansinnen Rechnung getragen werden, dass Schulpastoral für alle Menschen in der Schule da sein will, gerade für die, die Hilfe benötigen. Das Bemühen, sich um der Kirche fern stehende Menschen zu kümmern, bekommt nicht nur von dem diakonischen Impetus der Schulpastoral Rückenwind, nämlich allen Menschen zu helfen, sondern auch von der Nachfrage derjenigen Menschen, die Seelsorge als Zweig kirchlicher Arbeit nicht nur akzeptieren sondern sogar wünschen und in Anspruch nehmen. Zweitens wird in der Perspektive einer Öffnung für alle eine große Chance für die Schulen gesehen: Es besteht so leichter die Möglichkeit, mit allen Menschen an der Schule ins Gespräch zu kommen und Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen herzustellen. Diese Möglichkeit ist im konfessionellen Religionsunterricht im Vergleich zur Schulpastoral nur eingeschränkt gegeben. Eine Schulpastoral für alle hat es leichter, einen Beitrag für die gesamte Schulkultur (Holtappels 1995, 12f) zu leisten, als eine Schulpastoral, die sich nur an eine bestimmte Gruppe an der Schule richtet. Ein neuer Entwurf für Schulpastoral Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag für die Konzeptentwicklung einer Schulpastoral zu leisten, die auf die Anforderungen religiöser Pluralität an deutschen Schulen Bezug nimmt. Dabei rücken insbesondere Begegnungen zwischen Personen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit und Kultur an der Schule in den Blick. Weiterhin geht es darum, auf der Basis dieser Reflexionen eine praktische Perspektive für die Schulpastoral zu entwickeln. Der entwickelte Konzeptentwurf soll in Zusammenhang mit der Berufsschule gebracht werden, da hier die religiöse und kulturelle Pluralität häufig weit fortgeschritten ist (z. B. Over/Mienert 2006, 47). Es erfolgt nicht nur eine Analyse religiöser Pluralität, um sich über ihre Anforderungen klar zu werden, sondern es wird zudem speziell die Situation an Berufsschulen betrachtet. Hierfür werden Ergebnisse einer eigenen empirischen Untersuchung eingebracht, die zwar keine Repräsentativität beansprucht, aber einen Blick auf verschiedene Einstellungen bestimmter Berufsschülerinnen und Berufsschüler ermöglicht, die im Kontext dieser Arbeit von Bedeutung sind. Kontakte zwischen Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden, gehören in der Schule zum Alltag. „Nirgendwo sonst im öffentlichen Raum begegnen sich Menschen unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft und religiöser Zugehörigkeit in gleicher Vielfalt, Nähe und Intensität – was Schule vor besondere Aufgaben stellt“ (Kramer 2005, 187). Oftmals wird aber aneinander vorbei gelebt oder es gibt Probleme, wenn Menschen unterschiedlicher Gruppen aufeinander treffen. Bei den Personen, die an der Schule zusammentreffen, handelt es sich um Eltern, Lehrerinnen und Lehrer (inklusive Schulleitung), Schülerinnen und Schüler (z. B. Weidmann 1997, 414ff) und das Schulpersonal. Begegnungen bieten sich aus mehreren Gründen als Dreh- und Angelpunkt für den Entwurf einer Schulpastoral an, die sich interreligiös engagiert: Die Sozialpsychologie hat die Effekte von Begegnungen zwischen Angehörigen verschiedener Gruppen intensiv erforscht und gibt Auskunft über spezielle Bedingungen, damit Begegnungen prosoziale Effekte bei den an ihnen beteiligten Personen nach sich ziehen. Begegnungen haben eine theologische Dimension und sind für das schulpastorale Engagement unverzichtbar. Schließlich lassen sich Begegnungen speziell im konfessionellen Religionsunterricht eher selten durchführen und stellen vor diesem Hintergrund eine Perspektive dar, welche die Chancen der Schulpastoral gegenüber dem herkömmlichen Religionsunterricht vor Augen führt. Für die Erarbeitung des Konzeptentwurfs von Schulpastoral angesichts religiöser Pluralität wird auf zwei Theoriestränge Bezug genommen, einerseits auf das interkulturelle Seelsorgekonzept (v. a. Schneider-Harpprecht 2001), andererseits auf die Gedanken Raimon Panikkars (z. B. 1991). Weil in beiden Theoriesträngen sowohl der Zusammenhang von Religion und Kultur als auch Religion als kulturelle Dimension Berücksichtigung findet, wird der erarbeitete Entwurf als interkultureller Konzeptentwurf für Schulpastoral bezeichnet. Bei Panikkar und beim interkulturellen Seelsorgekonzept spielen Begegnungen eine bedeutende Rolle. Während das interkulturelle Seelsorgekonzept die Begegnung vor allem als Seelsorge und Beratung erhellt und orientiert, geht es Panikkar um ein offeneres Verständnis von Begegnungen. Diese Arbeit konzentriert sich auf das Begegnungsverständnis von Panikkar, da es allgemeiner anwendbar ist und im Vergleich zum interkulturellen Seelsorgekonzept viele weitere Aspekte bei Begegnungen berücksichtigt, die sich im Kontext einer religiös pluralen Schule als wichtig und fruchtbar erweisen können. Neben Seelsorge und Beratung ist es im Rahmen von Schulpastoral auch notwendig, Begegnungen zwischen Gruppen zu arrangieren und zu moderieren – wofür bisher für Schulpastoral im interreligiösen Kontext eine Fundierung fehlte. Die Produktivität von Panikkars Ansatz haben u. a. Mendonca, D’Sa und Kim enthüllt. Zudem berücksichtigt Panikkars Perspektive viele verschiedene Aspekte hinsichtlich der Beziehungen von Personen unterschiedlicher Religionen und Kulturen. Panikkar bedenkt bei seinen Überlegungen zu Begegnungen nicht nur die an einer Begegnung beteiligten Menschen, sondern auch das damit verbundene göttliche Geheimnis und den Kosmos. Ihm geht es nicht nur um die Rettung der Menschen und den dafür nötigen (bloßen) Erhalt der Natur, sondern um ein lernendes Zusammenleben mit der Natur, um eine Symbiose mit ihr und gleichzeitig um eine Emanzipation von einer Mensch und Natur versklavenden Technokratie. Eine besondere Aufmerksamkeit der Arbeit liegt auf dem Themenkomplex „Geschlechterdifferenz und Geschlechtersensibilität“, da Schulpastoral eine spezielle Achtsamkeit für das Thema „Geschlecht“ entwickelt hat (z. B. Noffke 2007), da dieses Thema im Kontext religiöser Pluralität auch als Konfliktpotenzial eine bedeutende Rolle spielt (z. B. Renz/Leimgruber 2005, 215ff) und da das interkulturelle Seelsorgekonzept für dieses Thema eine spezielle Valenz aufweist (z. B. Schneider-Harpprecht 2001, 168ff, 321ff). Im Ausklang der Arbeit werden Rituale als hervorragende Chance entdeckt, mit deren Hilfe sich der interkulturelle Konzeptentwurf in der schulpastoralen Praxis umsetzen lässt, da sich Rituale als Symbolhandlungen begreifen lassen. |
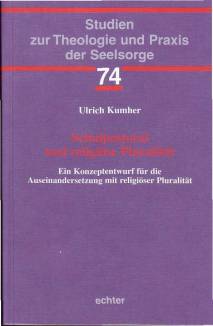
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen