|
|
|
Umschlagtext
Über die Herausgeber:
Alexander Trost, Prof. Dr. med., Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und für Psychotherapeutische Medizin, Gestalt- und Familientherapeut (DGSF), NLP-Master-Practitioner, Supervisor (DGSv), Diplom-TZI-Gruppenleiter. Seit 1990 Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Heilpädagogische Psychologie und systemische Konzepte an der Katholischen Fachhochschule NW, Abteilung Köln und Aachen. Langjährige Berufserfahrung in Klinik und Praxis der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Mitarbeiter eines integrativen Frühförderzentrums und Supervisor für Angehörige medizinischer, pädagogischer und psychologischer Berufe. Derzeitige Arbeitsschwerpunkte: Interaktion drogenkranker Mütter mit ihren Säuglingen, Bindungsstörungen im Kindesalter. Wolfgang Schwarzer, Prof. Dr. med., M.A., nach Studium der Humanmedizin und Germanistik Facharzt für Nervenheilkunde und für Psychotherapeutische Medizin, seit 1991 Professor für Sozialmedizin einschl. Psychopathologie und Psychiatrie an der Katholischen Fachhochschule NW, Abteilung Köln, daneben in nervenärztlicher Praxisgemeinschaft und als Supervisor in einer psychiatrischen Fachklinik und in sozialpsychiatrischen Einrichtungen tätig. Herausgeber des „Lehrbuchs für Sozialmedizin für Sozialarbeit, Sozial- und Heilpädagogik“ (5. Aufl. 2004). In den letzten Jahren hat sich die Arbeit mit psychisch kranken Menschen in und außerhalb der Kliniken sehr gewandelt. “Psychiatrie” ist als Arbeitsfeld für soziale und pädagogische Berufe wichtig geworden. Zum einen bedeutet dies eine Herausforderung an die traditionell medizinisch geprägte (klinische) Psychiatrie, zum anderen erfordern diese Veränderungen hohe Kompetenz und Professionalität der SozialarbeiterInnen und PädagogInnen in diesem Bereich. In Ausbildung und Berufspraxis bestehen hier noch deutliche Defizite. Das Buch will eine Lücke schließen. Es liefert – verständlich für medizinische Laien geschrieben – wichtige Basisinformationen über psychische Störungen, ihre möglichen bio-psycho-sozialen Ursachenzusammenhänge, ihre Ausdrucksformen und Behandlungsmöglichkeiten. Neben der Kinder- und Jugend-, der Allgemein-, der Geronto-Psychiatrie, der Psychosomatik, Psychotherapie und den Abhängigkeitserkrankungen werden klinische und besonders außerklinische (“komplementäre”) Institutionen und Arbeitsfelder für soziale und pädagogische Berufe kritisch reflektierend vorgestellt. Das Buch ergänzt und korrigiert die medizinische Sicht durch wesentliche Grundlagen sozialpsychiatrischer Theorie und Praxis. Ein Abschnitt zur Psychohygiene nimmt die Person des professionellen Helfers in den Blick. In dieser völlig neu bearbeiteten Ausgabe werden zusätzliche Kapitel der immer aktueller gewordenen Psychotraumatologie, den Neurobiologischen Grundlagen der Psychiatrie und der Problematik der kombinierten Psychose- und Suchterkrankungen gewidmet. Das Buch möchte Studierenden pädagogischer und sozialer Berufe ein aktuelles, gut verständliches und ausführliches Lehrbuch sein, den bereits praktisch Tätigen will es Anregungen und Arbeitshilfen geben. Rezension
Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie haben zwar auch eine erhebliche Relevanz für pädagogische Berufe, zum einen aber werden sie dort nur bedingt rezipiert, zum anderen erschweren sie diese Rezeption selbst durch eine oft fachspezifische Terminologie und eigene Fixierung auf die Medizin. Zugleich hat sich die Psychiatrie in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt und hat sich (nicht nur räumlich) geöffnet. - Dieses Buch bietet auf für medizinische Laien verständliche Art und Weise Basisinformationen zu psychischen Störungen, ihren Ursachen, Ausdrucksformen und Behandlungsmöglichkeiten. Weiterführende Literatur ist genannt. Fachbegriffe werden verständlich erläutert und zahlreiche Fallbeispiele veranschaulichen die Sachverhalte. Inhaltlich bietet es gerade auch für Schulpädagog/inn/en relevante Informationen zu Themenfeldern wie Kinder- und Jugendpsychiatrie, Suizid, Sucht / Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik (z.B. Essstörungen). Ein Sachregister erhöht die Handhabbarkeit.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber zur 3. Auflage 13
1. Einführung: Psychiatrie in Sozialer Arbeit und Pädagogik 15 1.1 Psychische Störungen in unserer Gesellschaft 15 1.2 Was ist „Psychiatrie"? 17 Literatur 20 2. Grundlagen: Erkenntnistheoretische Aspekte, Diagnostik, Klassifikation 21 2.1 Erkenntnistheorie und Psychiatrie 21 2.2 Psychiatrische Diagnostik 23 2.3 Psychiatrische Klassifikation 27 Literatur 35 3. Neurobiologische Grundlagen der Psychiatrie 37 3.1 Einführung 37 3.2 Die Funktion der Nervenzelle 37 3.3 Der strukturelle und funktionelle Aufbau des Gehirns 42 3.4 Entwicklungsprozesse 50 3.5 Chemie der Psyche 54 3.6 Neurobiologische und -chemische Grundlagen psychiatrischer Krankheitsbilder 60 Literatur 67 4. Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie 69 Vorbemerkung und Gliederung 69 4.1 Einführung 69 4.2 Kinderpsychiatrie als Entwicklungspsychopathologie 72 4.2.1 Pathogene und protektive Faktoren der Entwicklung 72 4.2.2 Gehirnentwicklung und Psyche 76 4.2.3 Psychische Störung und Krise 78 4.2.4 Normale und gestörte Entwicklung: Entwicklungsaufgaben und ihre Bewältigung 80 4.3 Klassifikation psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter 89 4.4 Eine Übersicht über die wichtigsten Störungsbilder 93 4.5 Symptome, Diagnostik und Therapie 97 4.6 Ein Störungsbild konkret: Das Hyperkinetische Syndrom(ICD-10: F.90) 104 4.6.1 Definition 105 4.6.2 Entwicklungsverlauf 106 4.6.3 Diagnostik 108 4.6.4 Ursachenhypothesen 110 4.6.5 Behandlung bei ADHS 113 4.7 Kinderpsychiatrie konkret: Peter, seine Familie und die Tagesklinik 114 4.7.1 Vorstellungsanlass 114 4.7.2 Die Geschichte der Mutter und Peters erste Lebensjahre 115 4.7.3 Peters weitere Geschichte 118 4.7.4 Peters Weg in die Tagesklinik 119 4.7.5 Das Definieren der Verantwortungsbereiche 126 4.7.6 Die Ebenen der therapeutischen Arbeit 127 4.7.7 Zum Verlauf der Behandlung 130 4.7.8 Peters schulische Entwicklung in der Tagesklinik 131 4.7.9 Wie es nach der Behandlung weiterging 132 4.8 Berufe der Sozialen Arbeit im Kontext der Kinder- und Jugendpsychiatrie 134 Literatur 136 5. Psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter 139 5.1 Organische psychische Störungen (ICD-10: F 0) 139 5.1.1 Demenz (F 00 - F 03) 140 5.1.2 Delir und Verwirrtheitszustand (F 05) 140 5.1.3 Andere organische psychische Störungen (F 06, F 07) 140 5.2 Schizophrenie (Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis) (F 2) 141 5.3 Affektive Erkrankungen: Depression und Manie (F 3) 156 5.3.1 Depression (F 32 - F 33) 157 5.3.2 Manie (F 30) 165 5.3.3 Bipolare affektive Störung (Manisch-depressive Erkrankung) (F 31) 168 5.4 Schizoaffektive Störungen (F 25) 169 5.5 Persönlichkeitsstörungen (F 6) 170 5.5.1 Borderline - Persönlichkeitsstörung (F 60.31) 174 5.6 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F 4) 180 5.6.1 Angststörungen (F 40, F 41) 180 5.6.2 Zwangsstörung (F 42) 182 5.6.3 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen (F 43) 183 Literatur 186 6. Zum Umgang mit Suizid und suizidgefährdeten Personen 189 6.0 Einleitung 189 6.1 Relevanz des Themas für psychosoziale Berufe 189 6.2 Basiswissen Suizidalität 191 6.2.1 Epidemiologie 191 6.2.2 Risikofaktoren und Risikogruppen 194 6.2.3 Internet, Suizidforen und Suizidalität 195 6.3 Charakteristika von und Erklärungsmöglichkeiten für suizidale Krisen 196 6.3.1 Zum Verlauf von suizidalen Krisen 196 6.3.2 Präsuizidales Syndrom 198 6.4 Theorien zum Suizid 198 6.5 Umgangsmöglichkeiten und Kriseninterventionskonzepte für suizidale Krisen 199 6.5.1 Das Erkennen von Suizidalität 199 6.5.2 Ambulante Krisenintervention bei Suizidgefahr 200 6.6 Weiterführende Tipps: Ausbildungsziele, Adressen, Literatur 203 Literatur 204 7. Abhängigkeitserkrankungen 207 7.0 Einleitung 207 7.1 Abhängigkeitserkrankungen als sozialmedizinisches Thema 209 7.2 Definitionen 211 7.2.1 Abusus (=Missbrauch) 211 7.2.2 Abhängigkeit 211 7.2.3 Toleranzentwicklung 213 7.2.4 Polytoxikomanie 213 7.2.5 Komorbidität 213 7.3 Suchtmittel: Wirkungen, Risiken, Folgen 214 7.3.1 Legale Drogen 214 7.3.2 Illegale Drogen 232 7.4 Notfallmaßnahmen bei Alkohol- oder Drogenintoxikation 240 7.5 Entstehungsfaktoren 241 7.6 Soziale Auswirkungen 243 7.7 Kinder, Jugendliche und Sucht 244 7.7.1 Gefährdung als Embryo und Fötus im Mutterleib einer Abhängigen 244 7.7.2 Kinder und Jugendliche als Angehörige suchtkranker Eltern(-teile) 245 7.7.3 Kinder als Konsumenten von Suchtmitteln 247 7.8 Behandlung und Rehabilitation 250 7.8.1 Allgemeines, Co-Abhängigkeit 250 7.8.2 Behandlungskette bei der Alkoholkrankheit 252 7.8.3 Therapie Opiat-Abhängiger 255 7.8.4 Behandlung anderer Abhängigkeitsformen 258 7.9 Prävention 258 Literatur 260 8. Doppeldiagnosen: Sucht und Psychose 263 8.1 Begriffsdefinition 263 8.2 Ein wachsendes Problem? 264 8.3 Die soziale Realität der F1/F2 Komorbiden 266 8.4 Die Symptomatik der F1/F2 Komorbidität 268 8.5 Doppeldiagnosepatienten in der Behandlungskette 271 8.6 Voraussetzungen der Wiedereingliederung 277 8.7 Ausblick 278 Literatur 278 9. Psychosomatische Medizin 281 9.1 Was bedeutet „Psychosomatik"? 281 9.2 Wie hat sich die Psychosomatische Medizin entwickelt? 285 9.3 Welche theoretischen Grundlagen hat die Psychosomatische Medizin? 286 9.3.1 Psychoanalytische Modelle zur Entstehung neurotischer Symptome 286 9.3.2 Kommunikative Aspekte 289 9.3.3 Das Alexithymiekonzept 292 9.4 Was ist Psychosomatische Diagnostik? 295 9.5 Mit welchen Beschwerden kommen Menschen zu einem Psychosomatischen Arzt? 301 9.5.1 Essstörungen 306 9.5.2 Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen) 315 9.5.3 Psychosomatosen 318 9.6 Ausführliches Fallbeispiel einer psychosomatischen Erkrankung 323 9.7 Welche Therapiemöglichkeiten gibt es in der Psychosomatik? 330 9.7.1 Familientherapeutische Behandlung somatisierender Patienten und ihrer Familien 330 Literatur 332 10. Psychotraumatologie 335 10.1 Definitionen 335 10.2 Formen psychischer Traumatisierung 335 10.2.1 Sexualisierte Gewalt 336 10.2.2 Andere Gewaltverbrechen 337 10.2.3 Holocaust-Überlebende 337 10.2.4 Kriegstraumata und politische Verfolgung 337 10.2.5 Technische Katastrophen und Naturkatastrophen 338 10.2.6 Verkehrsunfälle 338 10.2.7 Körperliche Erkrankungen und medizinische Behandlungen 338 10.2.8 Traumatisierung von Helfern 338 10.2.9 Frühe Traumatisierungen 338 10.3 Folgen psychischer Traumatisierungen 340 10.3.1 Akute Belastungsreaktion 341 10.3.2 Posttraumatische Belastungsstörung (Post Traumatic Stress Disorder - PTSD) 341 10.3.3 Anpassungsstörungen 343 10.3.4 Folgen psychischer Traumatisierungen im Kindes- und Jugendalter 343 10.3.5 Dissoziative Identitätsstörung (Multiple Persönlichkeitsstörung) 345 10.4 Umgang mit und Behandlung von psychisch traumatisierten Menschen 348 10.4.1 Grundsätzliches 348 10.4.2 Erste Maßnahmen 349 10.4.3 Traumabearbeitung 352 10.4.4 Psychosoziale Reintegration 353 10.4.5 Relevanz für die Soziale Arbeit 353 Literatur 353 11. Psychotherapie 355 11.1 Definitionen 355 11.2 Berufsbild: Psychotherapeutin 359 11.2.1 Ärztliche Psychotherapeutin 360 11.2.2 Psychologische Psychotherapeutin 360 11.2.3 Sozialarbeitern und Sozialpädagogln als Psychotherapeutin 361 11.2.4 Heilpraktikern als Psychotherapeutin 361 11.3 Die Finanzierung einer Psychotherapie 362 11.3.1 Private Finanzierung 362 11.3.2 Finanzierung durch die Krankenkasse 363 11.4 Die Anwendungsformen der Psychotherapie 364 11.4.1 Ambulante Therapie 364 11.4.2 Stationäre Therapie 365 11.4.3 Tagesklinik 366 11.4.4 Sozialpsychiatrischer Dienst 366 11.5 Spezielle Psychotherapieverfahren 366 11.5.1 Beratung versus Psychotherapie 367 11.5.2 Einzel-, Gruppen- oder Familientherapie? - Settingfragen 367 11.5.3 Verhaltensorientierte Therapieverfahren 368 11.5.4 Einsichtsorientierte Therapieverfahren 375 11.5.5 Entspannende und suggestive Therapien 389 11.5.6 Erlebnisorientierte Therapieverfahren 393 12. Gerontopsychiatrie 399 12.1 Entwicklung und psychische Gesundheit im Alter 399 12.2 Häufigkeit und Einteilung psychischer Störungen 399 12.3 Bio-psycho-soziale Entstehungsfaktoren 400 12.4 Diagnostik psychischer Störungen im Alter 402 12.5 Umgang mit psychisch gestörten alten Menschen 402 12.6 Aufgaben der Sozialen Arbeit in der Gerontopsychiatrie 403 12.7 Spezielle Gerontopsychiatrie 404 12.7.1 Demenz 404 12.7.2 Delir oder akute psychotische Störung 429 12.7.3 Abhängigkeitserkrankungen im Alter 432 12.7.4 Schizophrenie im Alter 436 12.7.5 Affektive Störungen im Alter 440 12.7.6 Suizid im Alter (Selbsttötung) 442 12.7.7 Angst-und Zwangsstörungen 443 12.7.8 Psychosomatische Störungen im Alter 444 12.7.9 Persönlichkeitsstörungen 446 12.8 Sozialpsychiatrische Aspekte der Altenarbeit 447 12.8.1 Versorgungssituation der psychisch Alterskranken in der häuslichen Umgebung 447 12.8.2 Hilfen für Angehörige, die psychisch Alterskranke pflegen 449 12.8.3 Ambulante gerontopsychiatrische Einrichtungen 450 12.8.4 Übergangspflege 452 12.8.5 Teilstationäre Betreuung psychisch Alterskranker 453 12.8.6 Gemeindenahe Vernetzung durch Gerontopsychiatrische Zentren 454 12.8.7 Stationäre Versorgung alter psychisch Kranker 455 12.8.8 Krankenhaussozialdienst KSD in Gerontopsychiatrischen Krankenhausabteilungen 459 12.8.9 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 460 12.8.10 Ethische Aspekte der Sozialarbeit in der Gerontopsychiatrie 461 Literatur 462 13. Sozialpsychiatrisches Denken und Handeln und die gemeindenahe Versorgung psychisch kranker Menschen 465 13.1 Einleitung 465 13.2 Sozialpsychiatrie 466 13.2.1 Abriss der Geschichte der Psychiatrie 466 13.2.2 Die Bedeutungen des Begriffs „Sozialpsychiatrie" 469 13.3 Gemeindepsychiatrie 471 13.3.1 Grundideen gemeindenaher Versorgung 472 13.3.2 Gemeindenahe Versorgungsstrukturen und Einrichtungen 475 13.4 Gesetzliche Grundlagen für gemeindenahe psychosoziale Hilfen 480 13.5 Komplementäre Behandlungsansätze für psychisch Kranke 481 13.5.1 Soziotherapie 481 13.5.2 Psychoedukation 484 13.6 Abschließende Bemerkungen 486 Literatur 487 14. Schutz und Eingriffe in die persönlichen Rechte psychisch kranker Menschen 491 14.1 Patientenrechte gegenüber Ärzten und Therapeuten 491 14.2 Besondere Schutzbedürftigkeit psychisch beeinträchtigter Menschen 493 14.3 Zwangsweiser Aufenthalt in Klinik oder Heim 494 14.3.1 Die Unterbringung nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (öffentlich-rechtliche Unterbringung nach Landesrecht) 495 14.3.2 Die Unterbringung nach dem Betreuungsrecht (zivilrechtliche Unterbringung) 497 14.3.3 Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus durch ein Strafgericht 497 14.3.4 Die strafrechtlich begründete Unterbringung von Jugendlichen oder Heranwachsenden 499 14.4 Die rechtliche Betreuung 500 14.4.1 Die Ziele der rechtlichen Betreuung 500 14.4.2 Das Betreuungsverfahren beim Vormundschaftsgericht 500 14.4.3 Betreuende und betreute Person 502 14.4.4 Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmungsrecht 504 14.4.5 Das örtliche Betreuungswesen 505 14.5 Sachverständige Beratung von Gerichten und Behörden 506 14.5.1 Die Rolle des Gutachters 506 14.5.2 Grundsätze der Begutachtung 507 14.5.3 Zur Form des Gutachtens 508 14.5.4 Sachverständige Beratung im Betreuungsverfahren 509 Literaturhinweise 510 15. Psychohygiene - Hilfe für Helfer 513 15.1 Einleitung 513 15.2 „Burnout" und „Berufliche Deformation" 513 15.3 Psychiatrische Beziehungsgestaltung und Psychohygiene 515 15.4 Aspekte und Methoden der Psychohygiene 518 15.4.1 Als Erstes ist eine Diagnose vonnöten 518 15.4.2 Reflexion eigener Einstellungen, Glaubenssätze und Verhaltensweisen 520 15.4.3 Supervision 522 15.4.4 Praktische Maßnahmen der Psychohygiene (Auswahl) 525 15.4.5 Fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten 526 15.5 Schlussbemerkung 528 Literatur 528 Herausgeber und Autorinnen 530 Sachregister 533 Personenregister 541 |
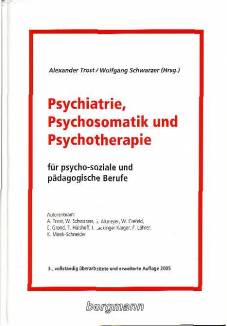
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen