|
|
|
Umschlagtext
Wann muß ich mich entschuldigen? Wie führe ich ein Gespräch? Auf welche Weise vermeide ich es, um etwas zu bitten oder "nein" zu sagen? Welche "Geschichten" erzähle ich unbewußt durch mein Verhalten? Um solche "Bausteine" unserer Beziehungen zu anderen und zu uns selbst geht es in diesem Buch. Es handelt von den unausgesprochenen Regeln (Basis-Prozeduren) über den Umgang mit Menschen in unserer Lebenswelt und von der individuellen Art, wie wir diese Regeln persönlich einfärben und anwenden und auch verdrehen oder vermeiden, weil sie uns zuwider sind, uns Angst machen oder weil wir sie nicht gelernt haben.
Die Autorin stellt die neuen Ergebnisse der Bindungs-, Beziehungs- und Gedächtnisforschung unter dem Gesichtspunkt des prozeduralen Lernens in unangestrengter Weise dar und verknüpft diese locker mit anderen Wissensgebieten, z.B. mit der Erzähltheorie, der Biographieforschung und v.a. mit der praktischen Psychotherapie. Sie vertritt einen integrativen, interaktionellen Ansatz, wie er sich heute sowohl in der Verhaltenstherapie als auch in den tiefenpsychologischen Richtungen findet und gewinnt dabei einen neuen, frischen Blick auf das Geschehen in der Psychotherapie. Dr. Hilka Otte studierte Psychologie in Hamburg und London. Nach Tätigkeit im BM für Bildung und Wissenschaft wechselte sie zur Medizinischen Hochschule Hannover, wo sie 11 Jahre lang im Bereich psychosomatischer Forschung, Lehre und Therapie tätig war. Ausbildung in Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierter Therapie, Gruppentherapie und Integrativer Therapie. Seit 1987 ist sie als Psychotherapeutin, Lehrtherapeutin (FPI/EAG) und Supervisorin in freier Praxis tätig. Rezension
Wir Menschen leben in Beziehungen. Diese können positiv gestaltet oder durch fehlerhaftes Verhalten gestört werden. Die erlernten Verhaltensprozeduren wurden mit der Zeit verinnerlicht. Das vorliegende Buch von Hilka Otte geht diesen "Prozeduren sozialen Verhaltens" auf die Spur. Es wendet sich vor allem an Menschen, die ihre alltäglichen Beziehungen transparenter gestalten und die das eigene Kommunikationverhalten verbessern wollen. Dabei geht es vor allem darum, Störungen im Umgang miteinander besser zu verstehen und gegebenenfalls aufzulösen oder zu verändern. Anschaulich beschreibt die Autorin das menschliche Umgangswissen an vielen Episoden und macht so beispielhaft deutlich, wie unsere oft selbstverständlichen sozialen Grundfertigkeiten (Prozeduren des sozialen Verhaltens) auch unser Selbstbild prägen. Eine lohnende Hilfe mit vielen Anregungen, um sich selbst und den Umgang mit anderen Menschen zu reflektieren.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einleitung 9
I Die Grundlagen von Beziehungen 15 1.1 Empathisches und szenisches Verstehen 15 1.2 Soziale Prozeduren: eine Definition 19 1.3 Die Entwicklung sozialer Prozeduren im Lebenslauf 20 Wie wir Gefühle und Beziehungs-Prozeduren lernen 20 Wie Bindungssicherheit und Kohärenzgefühl entstehen 22 Der „Andere", unser ständiger Begleiter 25 Stichworte zur Sozialisation 26 1.4 Gedächtnis 28 Implizit und explizit 28 Emotionale Prägungen 29 Prozedurales Können: Wiedererkennen, Fertigkeiten und Gewohnheiten 30 Explizites Wissen und narratives Erinnern 32 II Verhaltensprozeduren und Seinsprozeduren (soziale Mega-Prozeduren) 35 II. 1 Rollen und Szenen: auf der Bühne unserer Lebenswelt 36 11.2 Narrationen und Metaphern: die großen und kleinen Geschichten 38 Narrationen 38 Metaphern 42 11.3 Festgefahrene Narrationen (kommentierte Einzel-Beispiele) 44 „Anlocken, vergifien, abstoßen ": Mini-Drama am Familien-Esstisch 44 Tabu 45 Eine überlegene Haltung bewahren!! 45 Käfighaltung 46 „Übergriff.!" 46 Beschützer der Bedrückten 47 III Typische Narrationen aus dem „Gerechtigkeits-Komplex" 49 III. 1 Verletzte Gerechtigkeit 49 III.2 Angeklagten- und Rechtfertigungs-Narrationen 51 Wer sich trennt, ist schuldig 51 Krank werden als letzte Rechtfertigung 52 Vermischung von Selbstbeschuldigung und Rechtfertigung 53 III3 Opfer-, Ankläger- oder Rächer-Narrationen 54 Chronisches Anklagen, passiv und aktiv 54 Das posttraumatische Verbitterungssyndrom 55 Festgefahrene Rachegefühle 56 III4 Unvollständige Gerichtsverhandlungen 58 Auf der Suche nach dem zuständigen Gericht 58 Der Verteidiger fehlt 59 IV Narrationen mit fixierter Zeitperspektive: Vergangenheit oder Zukunft 61 IV. 1 Zukunftsprojektionen: „Wenn ich erst mal " 61 „ Wenn ich erstmal die bin, die ich sein will!" 61 „Ich muss noch mal in die Entwicklungsabteilung" 62 IV.2 Vergangenheits-Fixierungen 63 Wiederherstellung der heilen Welt 63 Die verpasste Gelegenheit, die unwiederbringlich dahin ist 63 V Gesprächs- und Erzählformen und ihre Störungen 65 V.1 Die Gesprächssituation 65 V.2 Gespräche, gelungene und misslungene 67 V.3 Stimmiges Erzählen 68 V.4 Leere und serielle Geschichten 69 V.5 Verarmte, eindimensionale Erzählungen 70 V.6 Alexithymie: Gefühle nicht benennen können 71 VI Interaktive Basis-Prozeduren - wie sie funktionieren (oder auch nicht) 73 VI. 1 Grundsätzliches 73 VI.2 Die Basis-Prozeduren Ja und Nein 77 VI.3 Das Alltags-Ja und seine Trübungen 79 Ja als Verhaltensprozedur 79 Trübungen des Ja 79 VI.4 Das schwierige Nein 82 Trübungen des Nein 82 Warum es oft so schwer fällt, nein zu sagen 83 VI.5 Das unentbehrliche „Stopp, so nicht!" 86 Warum wir zu selten stopp sagen 86 VI.6 Bitten können - oder auch nicht 92 Was uns hindert, zu bitten 93 Was wir stattdessen tun 94 VI.7 Die Kunst des Dankens 98 Knigge alsprozeduraler Lehrmeister 98 Wie Danken verunglückt oder umgangen wird 100 VI.8 „Aua, es tut mir weh!" - Schmerzlaute, ihr Sinn und ihr Nutzen 102 VI.9 Sich entschuldigen und anderen verzeihen — oder auch nicht 105 Der Sinn von Entschuldigungsprozeduren 105 Prozeduren, mit denen Entschuldigungen umgangen oder getrübt werden 106 Das Verzeihen und seine Schwierigkeiten 109 VII Andere ausgewählte „situative" Prozeduren 113 VII. 1 Flirten und werben 114 Flirten 114 Werben 115 VII.2 Trost annehmen und trösten 116 VII.3 „Wie geht es dir?" (die „Parzival-Prozedur") 119 VII.4 SmallTalk 121 VII.5 Oberhand-Strategien 122 VII.6 Indirekte Formate („Trojanische Pferde") 124 VIII Konflikt /Ambivalenz / Entscheidung 127 VIII. 1 Konflikte verstehen — oder vernebeln 127 Die Struktur äußerer Konflikte (Ich so — Du so) 127 Die Struktur innerer Konflikte (Einerseits — Andererseits) 129 Pseudo-Lö'sungen 130 VIII.2 Entscheidungsprozeduren 133 Ambivalenz und Entscheidung 133 Verzicht 134 IX Paradoxe und andere bemerkenswerte Beziehungs-, Sprach- und Denkmuster 137 IX. 1 Inhalts-und Beziehungsebene der Verständigung (und ihre Diskrepanzen) . 137 IX.2 Doppelbindungen: Labyrinthe ohne Ausweg 142 IX.3 „Sei-spontan!"-Paradoxien 145 X Therapeutische Aspekte: zum prozeduralen Aspekt in der Psychotherapie 149 Anmerkungen 154 Literatur 158 Stichwortverzeichnis 163 |
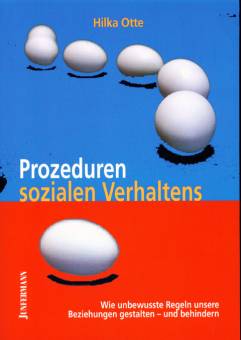
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen